Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » Femina Politica 1-2021 | Feministisch Wissen schaffen
Femina Politica 1-2021 | Feministisch Wissen schaffen
Erscheinungsdatum : 29.06.2021
0,00 € - 24,00 €
Inhalt
Femina Politica – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft
1-2021: Feministisch Wissen schaffen
Schwerpunkt
Gesine Fuchs / Patricia Graf: Feministisch Wissen schaffen: Erreichtes, in Arbeit und immer noch zu tun
Anne Cress: Die Situationsanalyse und ihr Potenzial für feministisch-kritische Politikfeldanalysen
Lisa Yashodhara Haller: Wirkung, Einfluss und Folgen im Mehrebenendesign – Steuerungsstrategien zur elterlichen Arbeitsteilung und ihre Übersetzung
Judith Conrads: Geschlecht, Subjekt und Macht empirisch erforschen, methodologisch neu denken: Ansätze für einen dekonstruktivistischen Blick auf vergeschlechtlichte Subjektwerdung
Simon Fetz / Johannes Korak: Können Männer feministisches Wissen produzieren? Von Hegemonieselbstkritik hin zur pro*feministischen Politisierung der Universität
Alena Sander: Producing Knowledge with Care. Building Mutually Caring Researcher-research Participants Relationships
Mariam Malik / Teresa Wintersteller / Veronika Wöhrer: Einverständniserklärungen für eine feministische Forschungspraxis. Überlegungen zur prozesshaften Gestaltung und gesellschaftlichen Einbettung von Einwilligung
Forum
Roberta Guerrina / Annick Masselot: Achille’s Heel: How Gendered Ideologies Undermined the UK Efforts to Tackle Covid-19
Natalie Imboden / Christine Michel: Die Risiken und Nebenwirkungen sind ungleich verteilt. Covid-19-Krise, Geschlecht und staatliches Handeln in der Schweiz
Elisia Bosisio: Care as a ‘New’ Feminist Rationality
Tagespolitik
Monika Remé: Häusliche Gewalt in der Pandemie bekämpfen
Anna-Lena von Hodenberg: Öffentlicher Hass gegen Frauen im Netz als politische Strategie
Jasna Strick: Das Digitale ist politisch: Häusliche Gewalt 2.0 und die fehlende öffentliche Sichtbarkeit
Anne Gwiazda: Feminist Protests, Abortion Rights and Polish Democracy
Olga Dryndova: Protestbewegung in Belarus: Frauen an der Front?
Interview with Kira Sonbanmatsu: Kamala Harris and the ‘Politics of Presence’ of Women in US Politics
Lehre und Forschung
Kurznachrichten
Melanie Bittner: Gender und Diversity in der (digitalen) Lehre. Auswirkungen der Corona-Pandemie
Rezensionen
Anica Waldendorf: Partizipative Forschung und Gender. Emanzipatorische Forschungsansätze weiterdenken
Barbara Degen: Beruf und Berufung transnational. Deutsche und polnische Akademikerinnen in der Zwischenkriegszeit
Christine M. Klapeer: Epistemische Gewalt. Wissen und Herrschaft in der kolonialen Moderne
Céline Barry: Race in Post-racial Europe: An Intersectional Analysis
Annette Henninger: Right-Wing Populism and Gender. European Perspectives and Beyond
Alicia Bernhardt: Familie und Biopolitik. Regulierung und Reproduktion von Bevölkerung in der „nachhaltigen Familienpolitik“
Friederike Beier: Entsorgung der Sorge. Geschlechterhierarchie im Spätkapitalismus
Marieke Fröhlich: New Directions in Women, Peace and Security
Call for Papers
Femina Politica Heft 1/2022: Vor der Tür. Intersektionale Dimensionen von Armut und Ausbeutung
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): fempol.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den FemPol-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1433-6359 |
| eISSN | 2196-1646 |
| Jahrgang | 30. Jahrgang 2021 |
| Ausgabe | 1 |
| Erscheinungsdatum | 29.06.2021 |
| Umfang | 180 |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 16,3 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Autor*innen
Schlagwörtercare, Dekonstruktion, development studies, elterliche Arbeitsteilung, Epistemologie, Ethik, Familienbild, Familienpolitik, feminism, feministische Kritik, Geschlechterkonstruktion, Geschlechterstereotyp, Gruppendiskussion, multilevel design, Männerbild, Partizipation, Politikfeldanalyse, Postmoderne, research ethics, Situationsanalyse, Wissen, Wissenschaft
Abstracts
Feministisch Wissen schaffen: Erreichtes, in Arbeit und immer noch zu tun (Gesine Fuchs, Patricia Graf)
Methoden in ihrer Vielfalt und ihrem Verknüpfungspotenzial bilden das innere Gerüst jeder Forschung und bestimmen in hohem Maße mit, welche Erkenntnisse gewonnen werden können. Ein integraler Bestandteil feministischer Wissenschaft ist die Reflexion darüber, was warum als gültiges Wissen gelten soll (Epistemologie), die Theorie und Analyse darüber, wie mit Forschung Erkenntnisse gewonnen werden sollen (Methodologie) und schließlich mit welchen konkreten Forschungswerkzeugen die Fragestellungen bearbeitet werden können (Methoden). Diese Einleitung resümiert, dass Epistemologien und Methodologien ein klares feministisches Profil haben können, jedoch grundsätzlich alle Forschungsmethoden für ein feministisches Erkenntnisinteresse und zur Analyse struktureller Ungleichheitsverhältnisse eingesetzt werden können. Mixed-Methods-Designs können hier hilfreich sein und erfreuen sich zunehmender Popularität. Auch das Aufkommen von Mixed-Method-Designs konnte aber bisher das Spannungsverhältnis zwischen qualitativen und quantitativen Forschungslogiken nicht auflösen, was auch den Logiken des Wissenschaftsbetriebs geschuldet ist. Eine kritische Perspektive auf Wissenschaft, die Politikwissenschaft eingeschlossen, muss auch die Vergabepraxen von Forschungsförderorganisationen, weiter bestehende Geschlechterstereotypen in Forschungsdesigns und bei Karrieren (Berufungen, Denominationen, Publikationsnormen) auf den Prüfstand stellen, welche eine feministische Praxis im Wissenschaftsbetrieb bremsen können. Keywords: Wissenschaft, Feministische Kritik, Geschlechterstereotyp
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die Situationsanalyse und ihr Potenzial für feministisch-kritische Politikfeldanalysen (Anne Cress)
Die Situationsanalyse (SiA) ist eine postmodern-feministische Weiterentwicklung der Grounded Theory, die seit den frühen 2000er-Jahren maßgeblich von der US-Soziologin Adele E. Clarke entworfen, in der Politikwissenschaft aber bislang kaum beachtet wurde. Dabei ist ihr Potenzial für politikwissenschaftliche Forschung im Allgemeinen sowie für feministisch-kritische Politikfeldanalysen im Besonderen nicht zu unterschätzen. Mit der SiA kann der gouvernementale Politikbegriff überwunden und eine umfängliche politikfeldspezifische feministische Machtanalyse realisiert werden. Die SiA steht im Einklang mit intersektionalen, postkolonial-feministischen und anderen konstruktivistischen Repräsentationstheorien und ermöglicht es, die feministische Idee einer Vielzahl von konfliktorisch angelegten Öffentlichkeiten in die Politikfeldanalyse zu integrieren. Hilfreich sind v.a. drei Strategien: (1) die Konzeptionalisierung des Politikfeldes als ‚Arena‘, in der verschiedene ‚soziale Welten‘ existieren und interagieren; (2) die Suche nach ‚implizierten Akteur*innen‘; (3) das Sichtbarmachen von epistemischer Diversität. Konkret bietet die SiA mit ihren Mapping-Strategien methodische Werkzeuge, mit deren Hilfe ein Politikfeld in seiner ganzen Heterogenität sichtbar gemacht werden kann. In diesem Beitrag gehe ich zunächst auf die lückenhafte politikwissenschaftliche Rezeption der SiA ein, um sodann aufzuzeigen, wie die SiA für die Politikwissenschaft und insbesondere für feministisch-kritische Politikfeldanalysen fruchtbar gemacht werden kann. Dies verdeutliche ich immer wieder skizzenhaft am Beispiel der deutschen Prostitutionspolitik. Keywords: Politikfeldanalyse, Feministische Kritik, Epistemologie, Postmoderne
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Wirkung, Einfluss und Folgen im Mehrebenendesign – Steuerungsstrategien zur elterlichen Arbeitsteilung und ihre Übersetzung (Lisa Yashodhara Haller)
Die Persistenz geschlechtlicher Arbeitsteilung im Anschluss an die Familiengründung fordert sowohl familienpolitische Steuerungsstrategien als auch deren Untersuchung heraus. Häufig wird in Wirkungsanalysen deterministisch vorausgesetzt, dass sich die staatliche Steuerungsfunktion unmittelbar auf die Handlungen von Subjekten auswirkt; das greift jedoch zu kurz. Ob ein Steuerungsziel erreicht wird, hat wesentlich mit den Interpretationen des Steuerungsinstrumentes und der entsprechenden Bedeutungszuschreibung auf unterschiedlichen Ebenen der Vermittlung und nicht zuletzt durch die adressierten Eltern zu tun. Letztere erzeugen insofern die Wirkung staatlicher Steuerung, statt sie nur zu beziehen. Der Beitrag fragt, wie Wirkung – begriffen als Übersetzung der Steuerungsabsicht durch interpersonelle Deutungen verschiedener Akteur*innen auf unterschiedlichen Ebenen der Politikvermittlung – konzeptualisiert werden kann. Dazu werden der Stand der Auseinandersetzung um die Analyse und Feststellung von Wirkung, Einfluss und Folgen staatlicher Steuerungsinstrumente dargestellt und der Nutzen der jeweiligen Ansätze anhand der Konzeptualisierung eines feministischen Mehrebenendesigns umrissen. Keywords: Familienpolitik, Multilevel Design, Familienbild
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Geschlecht, Subjekt und Macht empirisch erforschen, methodologisch neu denken: Ansätze für einen dekonstruktivistischen Blick auf vergeschlechtlichte Subjektwerdung (Judith Conrads)
Anhand einer qualitativen Studie zu vergeschlechtlichter Subjektwerdung Jugendlicher zeigt der Beitrag auf, wie eine diskursorientierte und dekonstruktivistische Analyse mit dem Fokus auf Subjekt, Geschlecht und gesellschaftliche Machtverhältnisse methodisch erfolgen kann. Für die empirische Analyse vergeschlechtlichter Subjektivierung werden Gruppendiskussionen mit der Grounded-Theory-Methodologie (GTM) verbunden. Das Spezifikum von Gruppendiskussionen, das aufeinander bezogene Sprechen, steht hierbei in poststrukturalistischer Rahmung im Mittelpunkt und bietet einen fruchtbaren Ansatzpunkt für feministische Fragestellungen. Keywords: Gruppendiskussion, Dekonstruktion, Geschlechterkonstruktion
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Können Männer feministisches Wissen produzieren? Von Hegemonieselbstkritik hin zur profeministischen Politisierung der Universität (Simon Fetz, Johann Korak) Feministische Standpunktepistemologien sind aus der feministischen Wissenschaftskritik am Androzentrismus in der Wissenschaft heraus entstanden. Vertreterinnen der feministischen Standpunktepistemologie diskutieren dabei Fragen nach dem wissenschaftsproduzierenden Subjekt und den Bedingungen der Wissenschaftsproduktion. Insbesondere das Verhältnis zwischen sozialer Positioniertheit – qua Geburt und Sozialisation – und der Einnahme einer epistemisch-politischen Positionierung auf Seiten der Marginalisierten steht im Mittelpunkt dieser Debatten. Wenn neues und differenziertes Wissen auch von privilegierten Positionen aus produziert werden kann, können dann Männer feministisches Wissen produzieren? Unter welchen Bedingungen ist dies möglich und welche Rolle spielt dabei die Institution Universität? Diese Fragen bearbeiten wir mit Blick auf die Figur des feministischen Wissenschaftlers, der zwar feministische Theorie rezipiert, jedoch neben seinem 15-stündigen Arbeitstag keine Zeit mehr für Reproduktionsarbeit hat. Wir schlagen daher eine profeministische Perspektive vor, die über das Individuum hinausgeht und letztlich auf eine profeministische Politisierung der Universität abzielt. Dabei greifen wir auf das Konzept der Hegemonieselbstkritik zurück und schlagen in Anknüpfung daran profeministische Praxen auf vier unterschiedlichen Ebenen vor, die in der Universität erprobt und theoretisch vertieft werden können. Keywords: Männerbild, Wissenschaft, Feministische Kritik
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Producing Knowledge with Care. Building Mutually caring Researcher-research Participants Relationships (Alena Sander)
Today’s development studies are going through a decolonial turn. At the heart of the debates surrounding the turn are discussions about the relationship between the researcher – often from the Global Norths – and her research participants – often from the Global Souths, and how this relationship may be constructed in a more reciprocal and respectful way. This paper uses the example of the author’s dissertation research with Jordanian women’s organizations in 2017 and 2018. It looks into how the feminist mutual-care-approach developed by Joan Fisher and Berenice Tronto may inform a reciprocal and respectful way of doing research and producing knowledge with and in the Souths in practice, and looks into the challenges that may arise from it. Keywords: Care, feminism, research ethics, development studies
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Einverständniserklärungen für eine feministische Forschungspraxis. Überlegungen zur prozesshaften Gestaltung und gesellschaftlichen Einbettung von Einwilligung (Mariam Malik, Terea Wintersteller, Veronika Wöhrer)
In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie ein feministisches und postkoloniales Verständnis von informierten Einverständnisprozessen aussehen kann und welche konkreten Schlussfolgerungen für die Forschungspraxis daraus resultieren können. Dabei wird zunächst der historische Entstehungskontext in der medizinischen Forschung beleuchtet und die daraus hervorgehenden Dimensionen – Kompetenz, Verständnis, Information, Freiwilligkeit und Autorisierung – erläutert. Ausgehend von Perspektiven der feministischen Sozialforschung und der feministischen Ethik wird aufgezeigt, dass informiertes Einverständnis über den rechtlich-formalen Akt hinausgehen und als kollaborative und prozessorientierte Aushandlung zwischen Forscher_innen und Forschungsteilnehmer_innen konzipiert werden sollte. Es ist wichtig, soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge in Einverständnisprozesse einzubeziehen, d.h. Subjekte im Sinne der intersektionalen Ethics of Care als relational zu begreifen und den Einfluss von sozialen Strukturen zu reflektieren. Auf Basis einer feministisch-postkolonialen Ethik wird hervorgehoben, dass es notwendig ist, bestehende Ungleichheiten anzuerkennen, um diese nicht zu reproduzieren. Flexible und wiederholbare Formate der Einverständniserklärung oder das Etablieren von gemeinsamen Diskussionen sowohl in den Einverständnisprozessen als auch in der Ergebnisdarstellung sind Beispiele für mögliche Umsetzungen in der Forschungspraxis. Keywords: Wissenschaft, Partizipation, Ethik
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
Femina Politica – Zeitschrift für feministische Politikwissenschaft
1-2021: Feministisch Wissen schaffen
Schwerpunkt
Gesine Fuchs / Patricia Graf: Feministisch Wissen schaffen: Erreichtes, in Arbeit und immer noch zu tun
Anne Cress: Die Situationsanalyse und ihr Potenzial für feministisch-kritische Politikfeldanalysen
Lisa Yashodhara Haller: Wirkung, Einfluss und Folgen im Mehrebenendesign – Steuerungsstrategien zur elterlichen Arbeitsteilung und ihre Übersetzung
Judith Conrads: Geschlecht, Subjekt und Macht empirisch erforschen, methodologisch neu denken: Ansätze für einen dekonstruktivistischen Blick auf vergeschlechtlichte Subjektwerdung
Simon Fetz / Johannes Korak: Können Männer feministisches Wissen produzieren? Von Hegemonieselbstkritik hin zur pro*feministischen Politisierung der Universität
Alena Sander: Producing Knowledge with Care. Building Mutually Caring Researcher-research Participants Relationships
Mariam Malik / Teresa Wintersteller / Veronika Wöhrer: Einverständniserklärungen für eine feministische Forschungspraxis. Überlegungen zur prozesshaften Gestaltung und gesellschaftlichen Einbettung von Einwilligung
Forum
Roberta Guerrina / Annick Masselot: Achille’s Heel: How Gendered Ideologies Undermined the UK Efforts to Tackle Covid-19
Natalie Imboden / Christine Michel: Die Risiken und Nebenwirkungen sind ungleich verteilt. Covid-19-Krise, Geschlecht und staatliches Handeln in der Schweiz
Elisia Bosisio: Care as a ‘New’ Feminist Rationality
Tagespolitik
Monika Remé: Häusliche Gewalt in der Pandemie bekämpfen
Anna-Lena von Hodenberg: Öffentlicher Hass gegen Frauen im Netz als politische Strategie
Jasna Strick: Das Digitale ist politisch: Häusliche Gewalt 2.0 und die fehlende öffentliche Sichtbarkeit
Anne Gwiazda: Feminist Protests, Abortion Rights and Polish Democracy
Olga Dryndova: Protestbewegung in Belarus: Frauen an der Front?
Interview with Kira Sonbanmatsu: Kamala Harris and the ‘Politics of Presence’ of Women in US Politics
Lehre und Forschung
Kurznachrichten
Melanie Bittner: Gender und Diversity in der (digitalen) Lehre. Auswirkungen der Corona-Pandemie
Rezensionen
Anica Waldendorf: Partizipative Forschung und Gender. Emanzipatorische Forschungsansätze weiterdenken
Barbara Degen: Beruf und Berufung transnational. Deutsche und polnische Akademikerinnen in der Zwischenkriegszeit
Christine M. Klapeer: Epistemische Gewalt. Wissen und Herrschaft in der kolonialen Moderne
Céline Barry: Race in Post-racial Europe: An Intersectional Analysis
Annette Henninger: Right-Wing Populism and Gender. European Perspectives and Beyond
Alicia Bernhardt: Familie und Biopolitik. Regulierung und Reproduktion von Bevölkerung in der „nachhaltigen Familienpolitik“
Friederike Beier: Entsorgung der Sorge. Geschlechterhierarchie im Spätkapitalismus
Marieke Fröhlich: New Directions in Women, Peace and Security
Call for Papers
Femina Politica Heft 1/2022: Vor der Tür. Intersektionale Dimensionen von Armut und Ausbeutung
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): fempol.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den FemPol-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1433-6359 |
| eISSN | 2196-1646 |
| Jahrgang | 30. Jahrgang 2021 |
| Ausgabe | 1 |
| Erscheinungsdatum | 29.06.2021 |
| Umfang | 180 |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 16,3 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
Schlagwörtercare, Dekonstruktion, development studies, elterliche Arbeitsteilung, Epistemologie, Ethik, Familienbild, Familienpolitik, feminism, feministische Kritik, Geschlechterkonstruktion, Geschlechterstereotyp, Gruppendiskussion, multilevel design, Männerbild, Partizipation, Politikfeldanalyse, Postmoderne, research ethics, Situationsanalyse, Wissen, Wissenschaft
Abstracts
Abstracts
Feministisch Wissen schaffen: Erreichtes, in Arbeit und immer noch zu tun (Gesine Fuchs, Patricia Graf)
Methoden in ihrer Vielfalt und ihrem Verknüpfungspotenzial bilden das innere Gerüst jeder Forschung und bestimmen in hohem Maße mit, welche Erkenntnisse gewonnen werden können. Ein integraler Bestandteil feministischer Wissenschaft ist die Reflexion darüber, was warum als gültiges Wissen gelten soll (Epistemologie), die Theorie und Analyse darüber, wie mit Forschung Erkenntnisse gewonnen werden sollen (Methodologie) und schließlich mit welchen konkreten Forschungswerkzeugen die Fragestellungen bearbeitet werden können (Methoden). Diese Einleitung resümiert, dass Epistemologien und Methodologien ein klares feministisches Profil haben können, jedoch grundsätzlich alle Forschungsmethoden für ein feministisches Erkenntnisinteresse und zur Analyse struktureller Ungleichheitsverhältnisse eingesetzt werden können. Mixed-Methods-Designs können hier hilfreich sein und erfreuen sich zunehmender Popularität. Auch das Aufkommen von Mixed-Method-Designs konnte aber bisher das Spannungsverhältnis zwischen qualitativen und quantitativen Forschungslogiken nicht auflösen, was auch den Logiken des Wissenschaftsbetriebs geschuldet ist. Eine kritische Perspektive auf Wissenschaft, die Politikwissenschaft eingeschlossen, muss auch die Vergabepraxen von Forschungsförderorganisationen, weiter bestehende Geschlechterstereotypen in Forschungsdesigns und bei Karrieren (Berufungen, Denominationen, Publikationsnormen) auf den Prüfstand stellen, welche eine feministische Praxis im Wissenschaftsbetrieb bremsen können. Keywords: Wissenschaft, Feministische Kritik, Geschlechterstereotyp
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die Situationsanalyse und ihr Potenzial für feministisch-kritische Politikfeldanalysen (Anne Cress)
Die Situationsanalyse (SiA) ist eine postmodern-feministische Weiterentwicklung der Grounded Theory, die seit den frühen 2000er-Jahren maßgeblich von der US-Soziologin Adele E. Clarke entworfen, in der Politikwissenschaft aber bislang kaum beachtet wurde. Dabei ist ihr Potenzial für politikwissenschaftliche Forschung im Allgemeinen sowie für feministisch-kritische Politikfeldanalysen im Besonderen nicht zu unterschätzen. Mit der SiA kann der gouvernementale Politikbegriff überwunden und eine umfängliche politikfeldspezifische feministische Machtanalyse realisiert werden. Die SiA steht im Einklang mit intersektionalen, postkolonial-feministischen und anderen konstruktivistischen Repräsentationstheorien und ermöglicht es, die feministische Idee einer Vielzahl von konfliktorisch angelegten Öffentlichkeiten in die Politikfeldanalyse zu integrieren. Hilfreich sind v.a. drei Strategien: (1) die Konzeptionalisierung des Politikfeldes als ‚Arena‘, in der verschiedene ‚soziale Welten‘ existieren und interagieren; (2) die Suche nach ‚implizierten Akteur*innen‘; (3) das Sichtbarmachen von epistemischer Diversität. Konkret bietet die SiA mit ihren Mapping-Strategien methodische Werkzeuge, mit deren Hilfe ein Politikfeld in seiner ganzen Heterogenität sichtbar gemacht werden kann. In diesem Beitrag gehe ich zunächst auf die lückenhafte politikwissenschaftliche Rezeption der SiA ein, um sodann aufzuzeigen, wie die SiA für die Politikwissenschaft und insbesondere für feministisch-kritische Politikfeldanalysen fruchtbar gemacht werden kann. Dies verdeutliche ich immer wieder skizzenhaft am Beispiel der deutschen Prostitutionspolitik. Keywords: Politikfeldanalyse, Feministische Kritik, Epistemologie, Postmoderne
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Wirkung, Einfluss und Folgen im Mehrebenendesign – Steuerungsstrategien zur elterlichen Arbeitsteilung und ihre Übersetzung (Lisa Yashodhara Haller)
Die Persistenz geschlechtlicher Arbeitsteilung im Anschluss an die Familiengründung fordert sowohl familienpolitische Steuerungsstrategien als auch deren Untersuchung heraus. Häufig wird in Wirkungsanalysen deterministisch vorausgesetzt, dass sich die staatliche Steuerungsfunktion unmittelbar auf die Handlungen von Subjekten auswirkt; das greift jedoch zu kurz. Ob ein Steuerungsziel erreicht wird, hat wesentlich mit den Interpretationen des Steuerungsinstrumentes und der entsprechenden Bedeutungszuschreibung auf unterschiedlichen Ebenen der Vermittlung und nicht zuletzt durch die adressierten Eltern zu tun. Letztere erzeugen insofern die Wirkung staatlicher Steuerung, statt sie nur zu beziehen. Der Beitrag fragt, wie Wirkung – begriffen als Übersetzung der Steuerungsabsicht durch interpersonelle Deutungen verschiedener Akteur*innen auf unterschiedlichen Ebenen der Politikvermittlung – konzeptualisiert werden kann. Dazu werden der Stand der Auseinandersetzung um die Analyse und Feststellung von Wirkung, Einfluss und Folgen staatlicher Steuerungsinstrumente dargestellt und der Nutzen der jeweiligen Ansätze anhand der Konzeptualisierung eines feministischen Mehrebenendesigns umrissen. Keywords: Familienpolitik, Multilevel Design, Familienbild
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Geschlecht, Subjekt und Macht empirisch erforschen, methodologisch neu denken: Ansätze für einen dekonstruktivistischen Blick auf vergeschlechtlichte Subjektwerdung (Judith Conrads)
Anhand einer qualitativen Studie zu vergeschlechtlichter Subjektwerdung Jugendlicher zeigt der Beitrag auf, wie eine diskursorientierte und dekonstruktivistische Analyse mit dem Fokus auf Subjekt, Geschlecht und gesellschaftliche Machtverhältnisse methodisch erfolgen kann. Für die empirische Analyse vergeschlechtlichter Subjektivierung werden Gruppendiskussionen mit der Grounded-Theory-Methodologie (GTM) verbunden. Das Spezifikum von Gruppendiskussionen, das aufeinander bezogene Sprechen, steht hierbei in poststrukturalistischer Rahmung im Mittelpunkt und bietet einen fruchtbaren Ansatzpunkt für feministische Fragestellungen. Keywords: Gruppendiskussion, Dekonstruktion, Geschlechterkonstruktion
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Können Männer feministisches Wissen produzieren? Von Hegemonieselbstkritik hin zur profeministischen Politisierung der Universität (Simon Fetz, Johann Korak) Feministische Standpunktepistemologien sind aus der feministischen Wissenschaftskritik am Androzentrismus in der Wissenschaft heraus entstanden. Vertreterinnen der feministischen Standpunktepistemologie diskutieren dabei Fragen nach dem wissenschaftsproduzierenden Subjekt und den Bedingungen der Wissenschaftsproduktion. Insbesondere das Verhältnis zwischen sozialer Positioniertheit – qua Geburt und Sozialisation – und der Einnahme einer epistemisch-politischen Positionierung auf Seiten der Marginalisierten steht im Mittelpunkt dieser Debatten. Wenn neues und differenziertes Wissen auch von privilegierten Positionen aus produziert werden kann, können dann Männer feministisches Wissen produzieren? Unter welchen Bedingungen ist dies möglich und welche Rolle spielt dabei die Institution Universität? Diese Fragen bearbeiten wir mit Blick auf die Figur des feministischen Wissenschaftlers, der zwar feministische Theorie rezipiert, jedoch neben seinem 15-stündigen Arbeitstag keine Zeit mehr für Reproduktionsarbeit hat. Wir schlagen daher eine profeministische Perspektive vor, die über das Individuum hinausgeht und letztlich auf eine profeministische Politisierung der Universität abzielt. Dabei greifen wir auf das Konzept der Hegemonieselbstkritik zurück und schlagen in Anknüpfung daran profeministische Praxen auf vier unterschiedlichen Ebenen vor, die in der Universität erprobt und theoretisch vertieft werden können. Keywords: Männerbild, Wissenschaft, Feministische Kritik
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Producing Knowledge with Care. Building Mutually caring Researcher-research Participants Relationships (Alena Sander)
Today’s development studies are going through a decolonial turn. At the heart of the debates surrounding the turn are discussions about the relationship between the researcher – often from the Global Norths – and her research participants – often from the Global Souths, and how this relationship may be constructed in a more reciprocal and respectful way. This paper uses the example of the author’s dissertation research with Jordanian women’s organizations in 2017 and 2018. It looks into how the feminist mutual-care-approach developed by Joan Fisher and Berenice Tronto may inform a reciprocal and respectful way of doing research and producing knowledge with and in the Souths in practice, and looks into the challenges that may arise from it. Keywords: Care, feminism, research ethics, development studies
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Einverständniserklärungen für eine feministische Forschungspraxis. Überlegungen zur prozesshaften Gestaltung und gesellschaftlichen Einbettung von Einwilligung (Mariam Malik, Terea Wintersteller, Veronika Wöhrer)
In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie ein feministisches und postkoloniales Verständnis von informierten Einverständnisprozessen aussehen kann und welche konkreten Schlussfolgerungen für die Forschungspraxis daraus resultieren können. Dabei wird zunächst der historische Entstehungskontext in der medizinischen Forschung beleuchtet und die daraus hervorgehenden Dimensionen – Kompetenz, Verständnis, Information, Freiwilligkeit und Autorisierung – erläutert. Ausgehend von Perspektiven der feministischen Sozialforschung und der feministischen Ethik wird aufgezeigt, dass informiertes Einverständnis über den rechtlich-formalen Akt hinausgehen und als kollaborative und prozessorientierte Aushandlung zwischen Forscher_innen und Forschungsteilnehmer_innen konzipiert werden sollte. Es ist wichtig, soziale und gesellschaftliche Zusammenhänge in Einverständnisprozesse einzubeziehen, d.h. Subjekte im Sinne der intersektionalen Ethics of Care als relational zu begreifen und den Einfluss von sozialen Strukturen zu reflektieren. Auf Basis einer feministisch-postkolonialen Ethik wird hervorgehoben, dass es notwendig ist, bestehende Ungleichheiten anzuerkennen, um diese nicht zu reproduzieren. Flexible und wiederholbare Formate der Einverständniserklärung oder das Etablieren von gemeinsamen Diskussionen sowohl in den Einverständnisprozessen als auch in der Ergebnisdarstellung sind Beispiele für mögliche Umsetzungen in der Forschungspraxis. Keywords: Wissenschaft, Partizipation, Ethik
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)





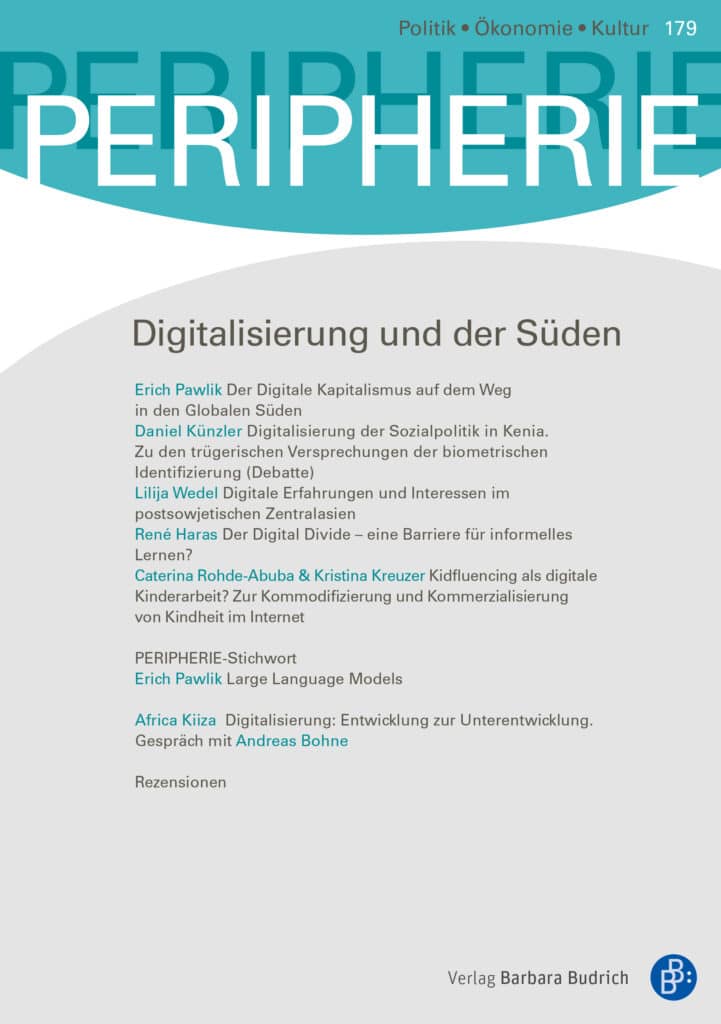
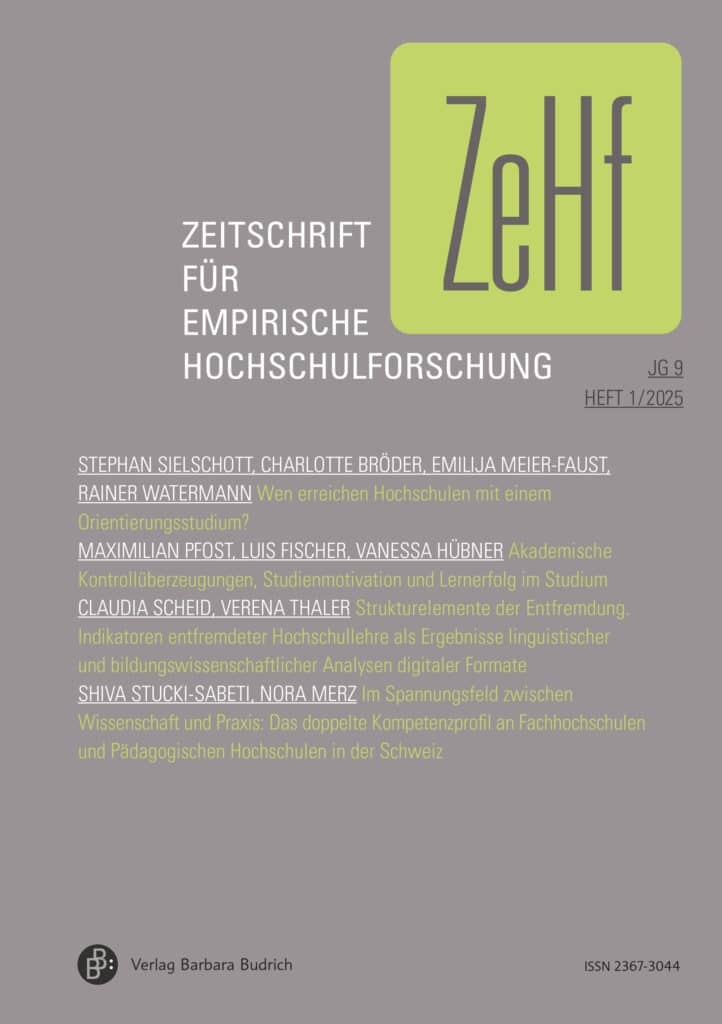
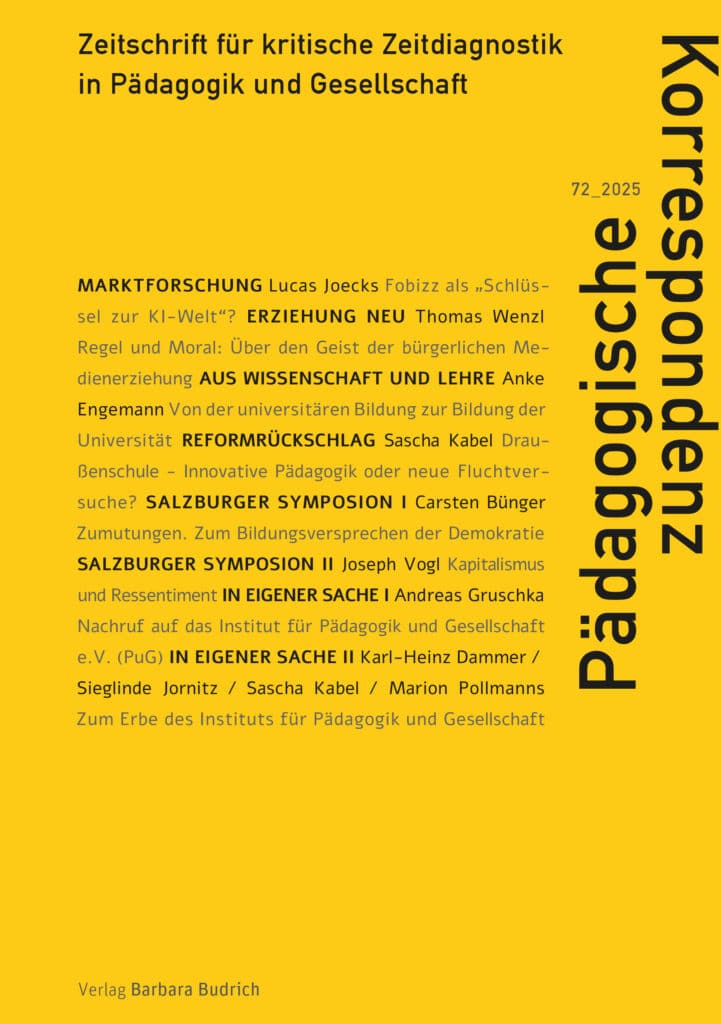
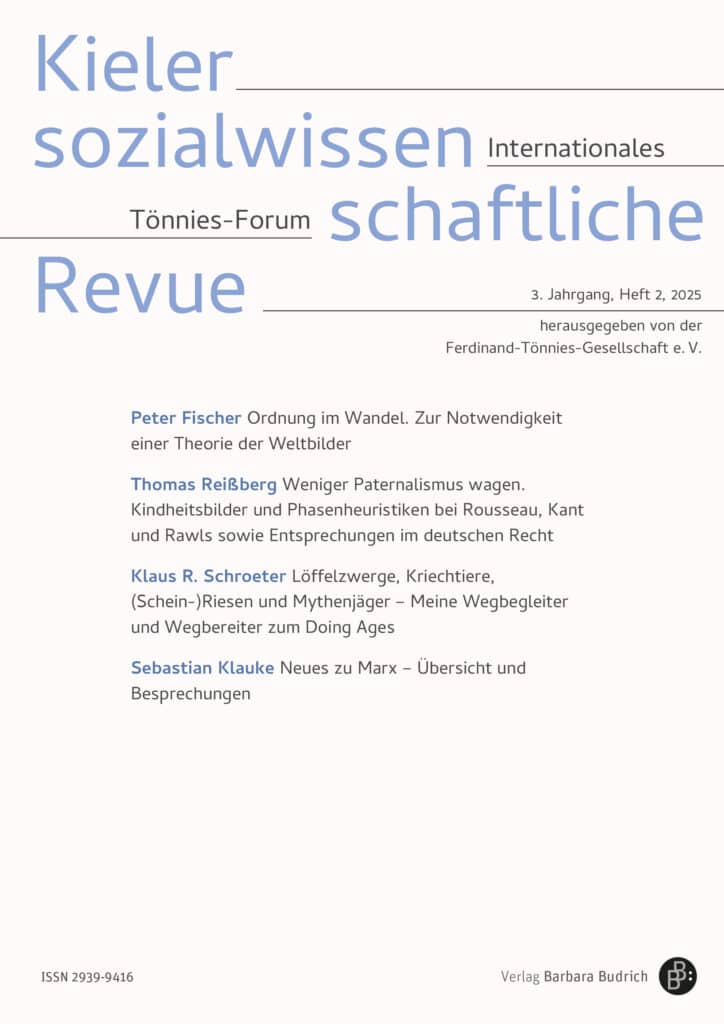
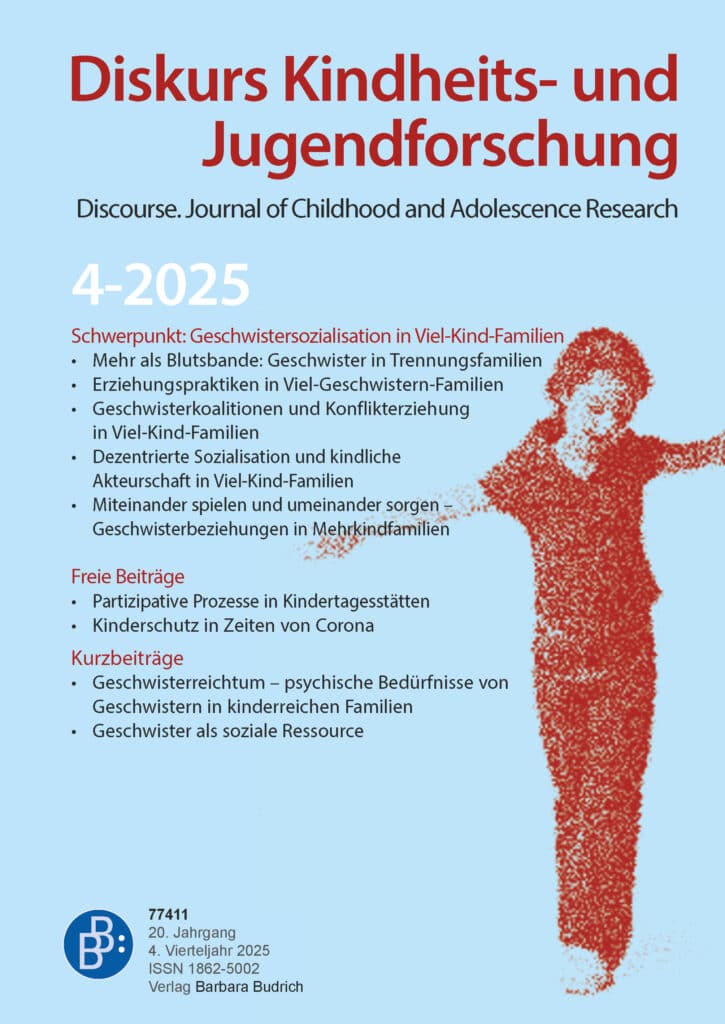

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.