Informationen zum Buch
Startseite » Programm » Konkurrenz aus dem Kloster
Konkurrenz aus dem Kloster
Die Möglichkeiten und Konflikte in der Berufsausübung als Klosterapothekerin der Frühen Neuzeit am Beispiel von Barbara Wild (1747–1815)
Erscheinungsdatum : ca. 08.12.2025
57,99 € - 58,00 €
Beschreibung
Pharmazeutische Berufstätigkeit war für Frauen in der Frühen Neuzeit eng mit vorherrschenden Rollenbildern verknüpft: Während für weltliche Frauen das Ideal der Hausfrau und Mutter einer Berufstätigkeit entgegenstand, erlaubte das Rollenbild geistlich lebender Frauen eine Tätigkeit als Klosterapothekerin. Anhand des Lebens und Wirkens der Ordensfrau und Apothekerin Barbara Wild (1747–1815) geht die Autorin zentralen Fragen nach der Lebensrealität von Klosterapothekerinnen in der Frühen Neuzeit nach. Damit leistet sie einen innovativen Beitrag zur Pharmazie- und Ordensgeschichte sowie zur biographischen Geschlechterforschung.
In ihrem Buch zeichnet Julia Pflug die gesetzlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Berufstätigkeit als Apothekerin, die Ausbildung zur Klosterapothekerin, die Klosterapotheke als Arbeitsplatz, den Konflikt zwischen bürgerlichen Apothekern und klösterlichen Apothekerinnen sowie die Positionierung der Klosterapothekerinnen im Gesundheitswesen der Frühen Neuzeit nach:
Etwa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts war eine weltliche Ausbildung für die pharmazeutische Berufsausübung vorgeschrieben. Während für Frauen nach dieser Lehre der Eintritt ins Kloster erfolgte, absolvierten angehende männliche Apotheker eine Gesellenzeit sowie zunehmend häufiger medizinische und chemische Kurse an den Universitäten. An dieser Entwicklung der Pharmazie vom Handwerk zur akademischen Disziplin hatten Frauen folglich in der Regel keinen Anteil. Mit dem Verkauf von Arzneimitteln an klosterexterne Personen stellten klösterliche Hausapotheken vielfach eine ernstzunehmende wirtschaftliche Konkurrenz für die bürgerlichen Apotheker dar. Beschwerdeschreiben über dieses Vorgehen lassen die gesellschaftlichen Entwicklungen und Konflikte des 18. Jahrhunderts – beispielsweise die Abkehr von religiösen Traditionen, die männlich dominierte Professionalisierung der Berufsausübung sowie die zunehmende Verwissenschaftlichung der Pharmazie – erkennen.
Die Autorin:
Julia Pflug, Institut für Geschichte der Pharmazie und Medizin, Philipps-Universität Marburg
Der Fachbereich:
Gender Studies
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISBN | 978-3-8474-3408-5 |
| eISBN | 978-3-8474-3346-0 |
| Format | 14,8 x 21,0 cm |
| Umfang | 467 |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Erscheinungsdatum | ca. 08.12.2025 |
| Auflage | 1. |
| Sprache | Deutsch |
| Reihe | |
| Band | 15 |
Autor*innen
Beschreibung
Beschreibung
Pharmazeutische Berufstätigkeit war für Frauen in der Frühen Neuzeit eng mit vorherrschenden Rollenbildern verknüpft: Während für weltliche Frauen das Ideal der Hausfrau und Mutter einer Berufstätigkeit entgegenstand, erlaubte das Rollenbild geistlich lebender Frauen eine Tätigkeit als Klosterapothekerin. Anhand des Lebens und Wirkens der Ordensfrau und Apothekerin Barbara Wild (1747–1815) geht die Autorin zentralen Fragen nach der Lebensrealität von Klosterapothekerinnen in der Frühen Neuzeit nach. Damit leistet sie einen innovativen Beitrag zur Pharmazie- und Ordensgeschichte sowie zur biographischen Geschlechterforschung.
In ihrem Buch zeichnet Julia Pflug die gesetzlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen für die Berufstätigkeit als Apothekerin, die Ausbildung zur Klosterapothekerin, die Klosterapotheke als Arbeitsplatz, den Konflikt zwischen bürgerlichen Apothekern und klösterlichen Apothekerinnen sowie die Positionierung der Klosterapothekerinnen im Gesundheitswesen der Frühen Neuzeit nach:
Etwa ab der Mitte des 18. Jahrhunderts war eine weltliche Ausbildung für die pharmazeutische Berufsausübung vorgeschrieben. Während für Frauen nach dieser Lehre der Eintritt ins Kloster erfolgte, absolvierten angehende männliche Apotheker eine Gesellenzeit sowie zunehmend häufiger medizinische und chemische Kurse an den Universitäten. An dieser Entwicklung der Pharmazie vom Handwerk zur akademischen Disziplin hatten Frauen folglich in der Regel keinen Anteil. Mit dem Verkauf von Arzneimitteln an klosterexterne Personen stellten klösterliche Hausapotheken vielfach eine ernstzunehmende wirtschaftliche Konkurrenz für die bürgerlichen Apotheker dar. Beschwerdeschreiben über dieses Vorgehen lassen die gesellschaftlichen Entwicklungen und Konflikte des 18. Jahrhunderts – beispielsweise die Abkehr von religiösen Traditionen, die männlich dominierte Professionalisierung der Berufsausübung sowie die zunehmende Verwissenschaftlichung der Pharmazie – erkennen.
Die Autorin:
Julia Pflug, Institut für Geschichte der Pharmazie und Medizin, Philipps-Universität Marburg
Der Fachbereich:
Gender Studies
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISBN | 978-3-8474-3408-5 |
| eISBN | 978-3-8474-3346-0 |
| Format | 14,8 x 21,0 cm |
| Umfang | 467 |
| Erscheinungsjahr | 2026 |
| Erscheinungsdatum | ca. 08.12.2025 |
| Auflage | 1. |
| Sprache | Deutsch |
| Reihe | |
| Band | 15 |
Produktsicherheit
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.


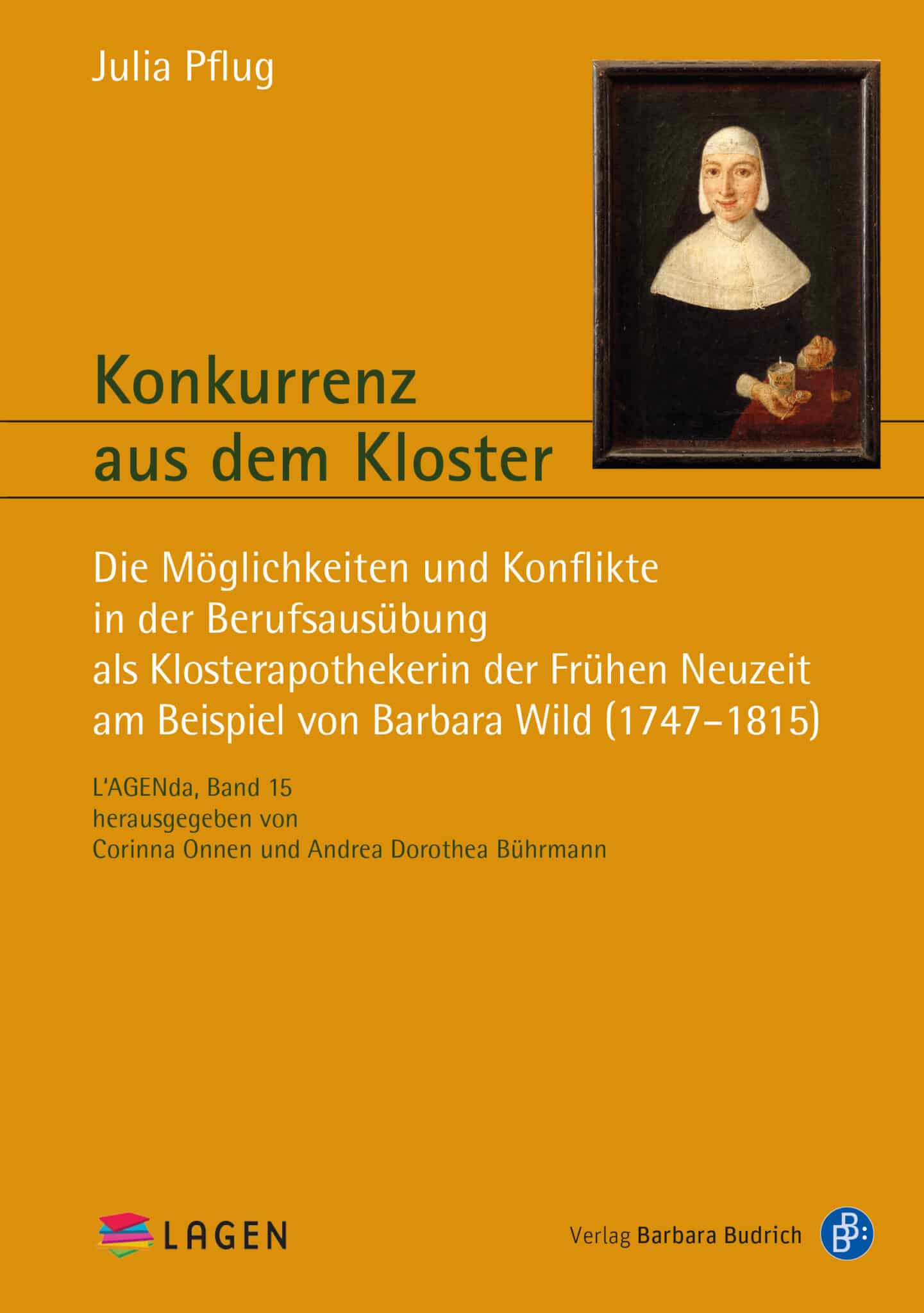

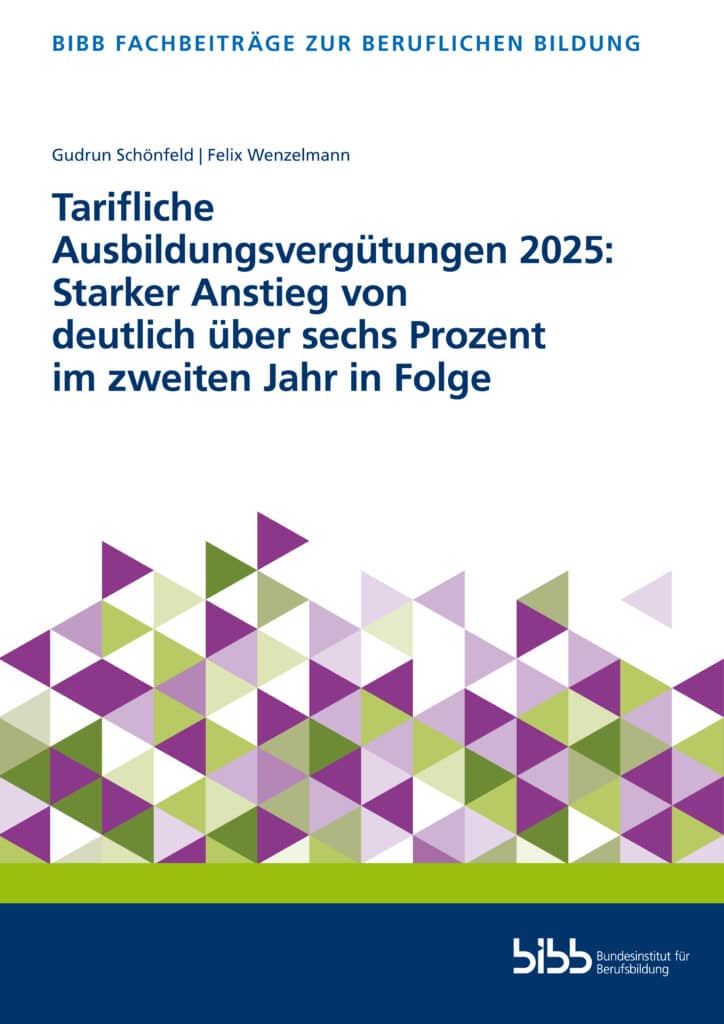
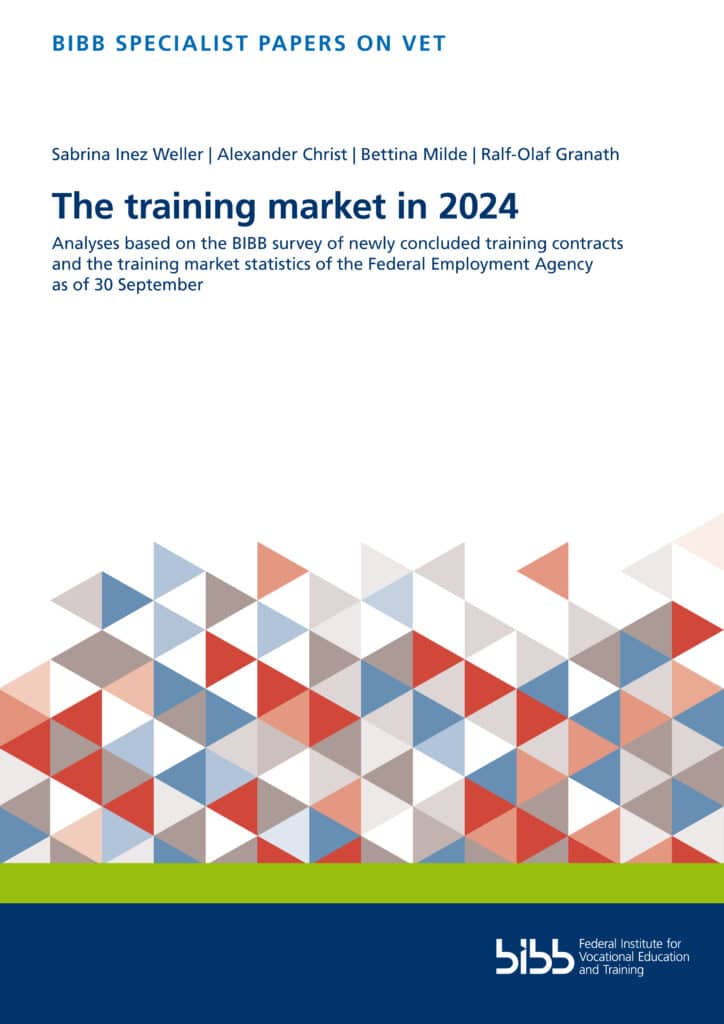
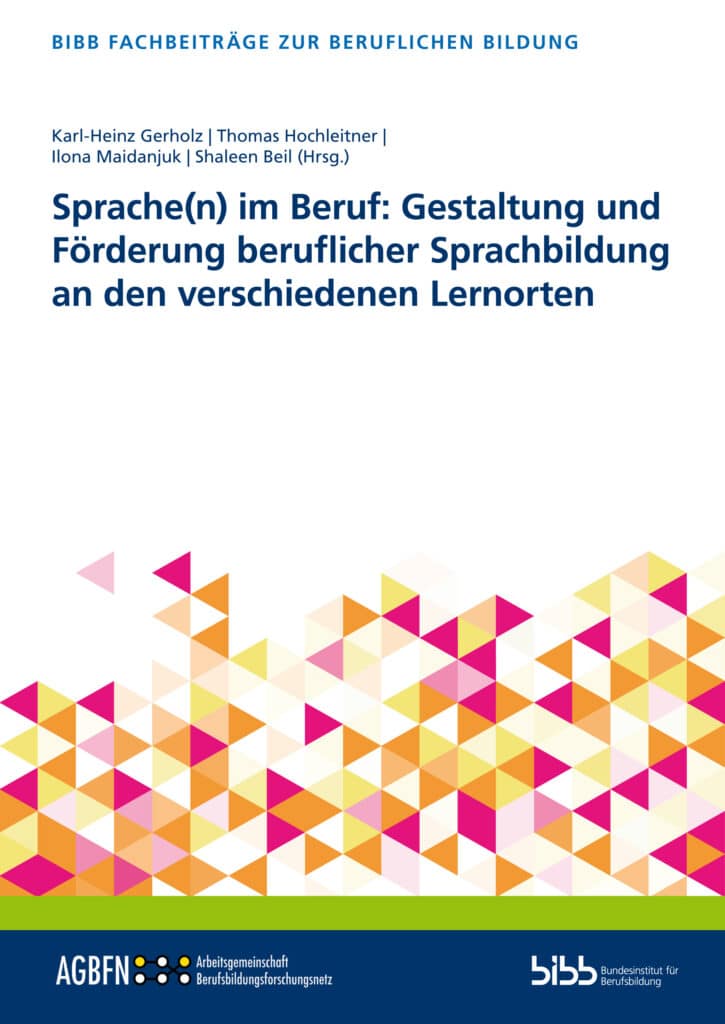
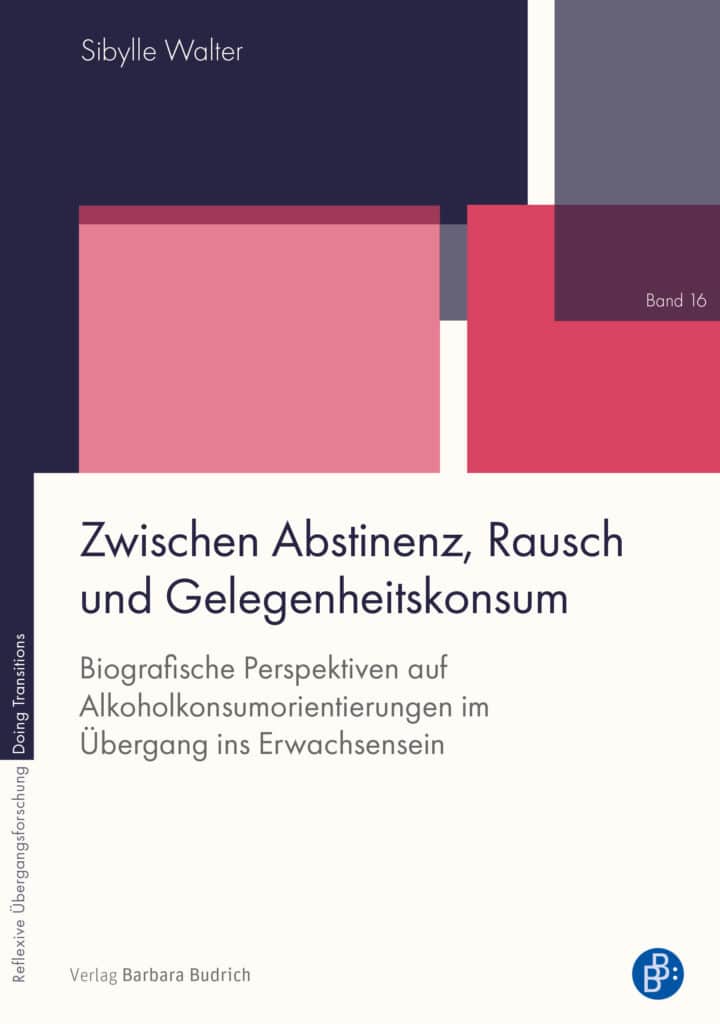
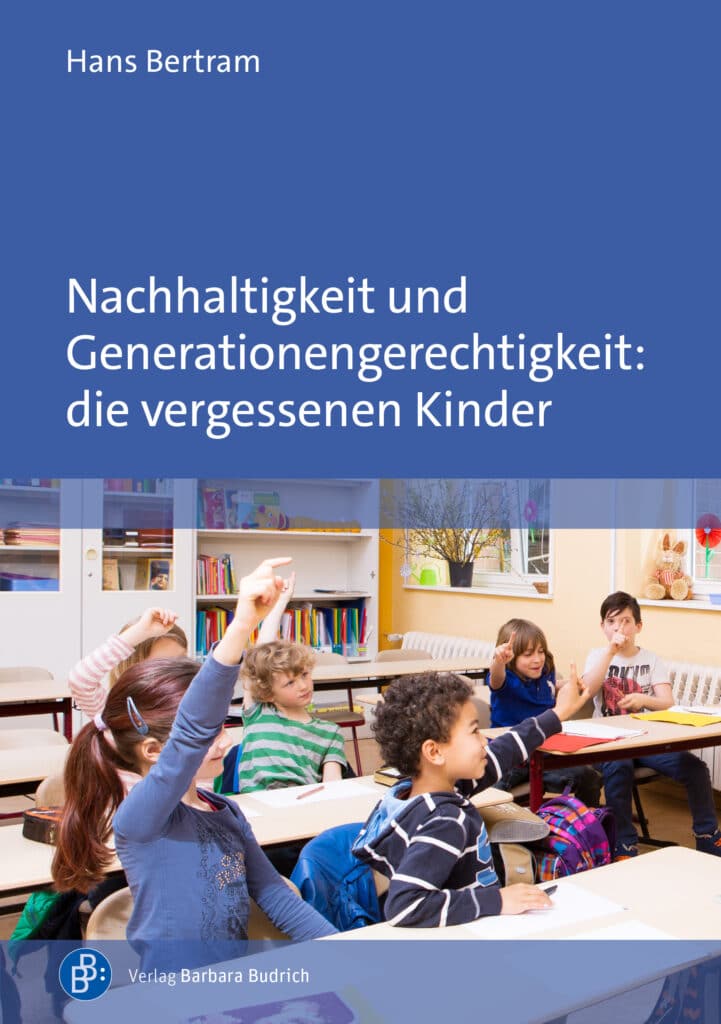
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.