Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » ZRex 2-2025 | Freie Beiträge
ZRex 2-2025 | Freie Beiträge
Erscheinungsdatum : 30.10.2025
0,00 € - 30,00 €
- Inhalt
- Bibliografie
- Produktsicherheit
- Zusatzmaterial
- Bewertungen (0)
- Autor*innen
- Schlagwörter
- Abstracts
Inhalt
ZRex – Zeitschrift für Rechtsextremismusforschung
2-2025: Freie Beiträge
Beiträge
Nikolas Dietze: Lokale Repräsentationsspezifika der AfD im Vergleich: Klassenfragen im Kontext der sachsen-anhaltinischen Kommunalwahl 2024
Schahrzad Farrokhzad / Gudrun Hentges / Birgit Jagusch / Anno Kluß / Lisa Tölle: „Impfungen dienen zur gezielten Dezimierung unliebsamer Bevölkerungsgruppen“ – Radikalisierung durch Verschwörungsideologien und ihre Auswirkungen auf den sozialen Nahraum
Samuel Breidenbach: Die rechtsextreme Gemeinschaft in Telegram. Akteur:innen, Verbindungen, Vergemeinschaftungspraktiken
Linda Sachs: „Für das Leben!“ – Deckmantel extrem rechter Ideologie? Die „Lebensschutz“-Bewegung und ihr Verhältnis zum Rechtsextremismus. Eine Analyse der Reden des Münchner Marsch fürs Leben
Wolfgang Frindte: Sind die Konzeptionen des Autoritarismus noch passfähig? – Ein Diskussionsvorschlag anlässlich des 125. Geburtstags von Erich Fromm
Jörg Schoolmann / Andreas Ziemann: Politische Stimmung und pro-russische Rhetorik auf Telegram. Netzwerk- und diskursanalytische Befunde
Anika Steppacher: Der wesensgleiche Glaube. Eine Einzelfallstudie zur Rekonstruktion der Weltansicht eines „rechts-patriotischen Heiden“
Tina Leber: In guter Gesellschaft: Bedrohungswahrnehmungen als Kompass für die Konstruktion einer erwünschten zivilgesellschaftlichen Demokratiearbeit
Forum
Marlene Hilgenstock / Alexander Jedinger / Pascal Kolkwitz-Anstötz / Pascal Siegers: DP-R|EX: Das Datenportal für die Rassismus- und Rechtsextremismusforschung
Viktoria Rösch / Michaela Köttig / Paula Matthies: Forschung mit Haltung: Tagungsbericht zum Symposium am 12. März 2025 anlässlich des 60. Geburtstags von Renate Bitzan in Nürnberg
Sebastian Barsch: Habbo Knoch: ein Nachruf
Rezensionen
Nikolai Schreiter: Dietl, Stefan (2025). Antisemitismus und die AfD
Yves Müller: Schmerdtmann, Mattes (2024). Das Deutsche Kulturwerk Europäischen Geistes (1950–1996). Porträt eines völkischen Kulturvereins und seiner Schriften
Fabian Virchow: Ramos, Paola (2024): Defectors. The Rise of the Latino Far Right and What it Means for America
Wolfgang Frindte: Quent, Matthias & Virchow, Fabian (Hrsg.). (2024). Rechtsextrem, das neue Normal? Die AfD zwischen Verbot und Machtübernahme
Fabian Virchow: Vaughan, Antonia; Braune, John; Tinsely, Meghan & Mondon, Aurelien (Hrsg.). (2024): The ethics of researching the far right. Critical approaches and reflections
Aysun Doğmuş: Farrokhzad, Schahrzad & Jagusch, Birgit (2024). Extrem rechte und rassistische Gewalt. Auswirkungen – Handlungs- und Bewältigungsmuster – Konsequenzen
Einzelbeitrag-Download (Open Access): zrex.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZRex-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 2701-9624 |
| eISSN | 2701-9632 |
| Jahrgang | 5. Jahrgang 2025 |
| Ausgabe | 2-2025 |
| Erscheinungsdatum | 30.10.2025 |
| Umfang | 176 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Zusatzmaterial
Autor*innen
SchlagwörterAfD, Antifeminismus, Authoritarian Turn, Autoritarismus, Bedrohung, Demokratiearbeit, digitale Netzwerke, digitaler Rechtsextremismus, Diskursanalyse, DP-R|EX, Einzelfallstudie, germanisch-neuheidnische Religiosität, Gruppen-Narzissmus, Ideologie, Klassenanalyse, Kommunalpolitik, kritische Rechtsextremismusforschung, Lebensschutz-Bewegung, Linksextremismus, Markierung, Netzwerkanalyse, Oktober 2025, Plattforminfrastruktur, pro-russische Rhetorik, qualitative Inhaltsanalyse, quantitative Forschung, Radikalisierung, Rechtsextremismus, Repräsentation, social media, soziale Frage, sozialer Nahraum, Telegram, Topic Modeling, Transformation, Trumpismus, Ukraine-Krieg, völkisch-autoritäre Verschwörungsideologien, völkisches Denken, Wissenssoziologie, Zivilgesellschaft
Abstracts
Lokale Repräsentationsspezifika der AfD im Vergleich: Klassenfragen im Kontext der sachsen-anhaltinischen Kommunalwahl 2024 (Nikolas Dietze)
In diesem Artikel werden deskriptive Repräsentationsmuster und -disparitäten der AfD auf kommunaler Ebene am Fallbeispiel der sachsen-anhaltinischen Kommunalwahlen 2024 herausgearbeitet. Ziel der Untersuchung ist, soziostrukturelle Merkmale der AfD-Kandidat:innen zu kontrastieren und mit den Profilen der CDU, SPD und Linken zu vergleichen. Methodisch erfolgt dies mittels einer deskriptiv-quantitativen Datenanalyse von 2.577 Kandidat:innen entlang berufs- und bildungsspezifischer Merkmale, die anschließend klassenspezifisch analysiert werden. Die zentralen Ergebnisse zeigen, dass die AfD überproportional viele Kandidat:innen aus niedrigqualifizierter Produktions- und Dienstleistungsarbeit aufstellt und damit wesentlich repräsentativer für die ostdeutsche Sozialstruktur ist als die drei Vergleichsparteien, die primär hochqualifizierte Berufs- und Statusgruppen vertreten. Die Diskussion stellt mögliche Erklärungsansätze für diese Befunde heraus und unterstreicht, wie die AfD die soziale Frage von Verteilungsfragen weg hin zu nationalistischen und klassistischen Narrativen umdeutet. Schlüsselbegriffe: Repräsentation, Klassenanalyse, AfD, Soziale Frage, Kommunalpolitik, Transformation
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Impfungen dienen zur gezielten Dezimierung unliebsamer Bevölkerungsgruppen“ – Radikalisierung durch Verschwörungsideologien und ihre Auswirkungen auf den sozialen Nahraum (Schahrzad Farrokhzad, Gudrun Hentges, Birgit Jagusch, Anno Kluß & Lisa Tölle)
Verschwörungsideologien sind oftmals mit völkisch-autoritären Weltanschauungen verknüpft und können zu einem gefährlichen gesellschaftlichen Klima führen. Im vorliegenden Artikel werden quantitative Forschungsergebnisse des Projekts „RaisoN“ dargestellt, in dem u. a. Auswirkungen von Verschwörungsideologien auf soziale Nahräume erforscht werden. Hierzu wurden Fachkräfte der Beratungs- und Bildungsarbeit mittels quantitativer Fragebogenerhebung befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass Verschwörungsideologien negative Auswirkungen auf das soziale Miteinander und die psychische Gesundheit von Betroffenen haben und zu Radikalisierungsprozessen in diesen sozialen Räumen führen können. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit spezialisierter Bildungsund Beratungsangebote für Fachkräfte, um kompetent und nachhaltig auf die Herausforderungen im Umgang mit Verschwörungsideologien zu reagieren. Zusätzlich sind Informations- und Austauschplattformen für Betroffene nötig, um die psychischen und sozialen Folgen besser zu bewältigen. Die Analyse zeigt, dass Verschwörungsideologien zur Radikalisierung von Gemeinschaften und zur weiteren gesellschaftlichen Fragmentierung führen können. Schlüsselbegriffe: völkisch-autoritäre Verschwörungsideologien, sozialer Nahraum, quantitative Forschung, Radikalisierung
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die rechtsextreme Gemeinschaft in Telegram. Akteur:innen, Verbindungen, Vergemeinschaftungspraktiken (Samuel Breidenbach)
Der Beitrag kombiniert unterschiedliche Methoden und theoretische Perspektiven, um die rechtsextreme Gemeinschaft in Telegram genauer zu charakterisieren. Hierfür wird zunächst auf Grundlage einer Darstellung von Telegrams technischer Infrastruktur argumentiert, warum die Plattform der rechten Szene besonders geeignete Ausgangsbedingungen zu bieten scheint. Mit einer Kombination aus netzwerkanalytischen, computerlinguistischen und qualitativen Verfahren werden dann eine Struktur aus 265 rechten Telegram-Kanälen sowie die von ihnen verbreiteten Inhalte untersucht, um hierdurch aus unterschiedlichen Perspektiven einen detaillierten Einblick in die Akteur:innen, Verbindungen und Inhalte in diesem Netzwerk zu gewinnen. Diese Ergebnisse werden schließlich im Kontext der aktuellen Forschung zu digitalem Rechtsextremismus diskutiert, um zu zeigen, wie die Betreiber:innen der rechten Kanäle in Telegram gemeinsam mit den dort aktiven Nutzer:innen ein rassistisches und kospirationistisches Weltbild konstruieren und sich durch den wechselseitigen Austausch miteinander als Gemeinschaft festigen. Der Beitrag verdeutlicht, wie Telegram mit einer Kombination aus der Affordanz der Plattforminfrastruktur, dem Fehlen jeglicher zentralen Instanz zur Inhaltsmoderation und den Inhalten der dort aktiven Akteur:innen das Entstehen, Wachsen und Festigen einer rechtsextremen Gemeinschaft unterstützt. Schlüsselbegriffe: Telegram, Social Media, digitaler Rechtsextremismus, Plattforminfrastruktur, Netzwerkanalyse, Topic-Modeling
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Für das Leben!“ – Deckmantel extrem rechter Ideologie? Die „Lebensschutz“-Bewegung und ihr Verhältnis zum Rechtsextremismus. Eine Analyse der Reden des Münchner Marsch fürs Leben (Linda Sachs)
Der Beitrag untersucht die Ideologieelemente der „Lebensschutz“-Bewegung und ihr Verhältnis zu extrem rechter Ideologie. Theoretisch orientiert sich die Analyse am Rechtsextremismusbegriff von Willibald Holzer, der Rechtsextremismus als Syndromphänomen begreift. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse werden die Reden des Münchner Marsches fürs Leben (2021–2023) ausgewertet und die darin enthaltenen Themen, Argumentationslinien und Narrative analysiert. Die Ergebnisse zeigen einen ausgeprägten Dualismus zwischen dem vermeintlich „Natürlichen“ („Kultur des Lebens“) und „Widernatürlichen“ („Kultur des Todes“) als ideologisches Grundmuster. Grundlegende Ideologieelemente sind u. a. ein binäres Geschlechterbild und naturalisierte Geschlechterungleichheit, die Konstruktion eines christlich-europäischen Kulturraums, Antifeminismus, Antipluralismus, Verschwörungsdenken und struktureller Antisemitismus. Die Analyse offenbart deutliche ideologische Schnittstellen mit der extremen Rechten. Auch wenn die Bewegung nicht als eindeutig extrem rechts einzuordnen ist, fungiert sie als Scharnier zwischen der extremen Rechten und der Gesamtgesellschaft und trägt zur Normalisierung rechter Themen und Argumentationsmuster bei. Schlüsselbegriffe: Lebensschutz-Bewegung, Rechtsextremismus, Ideologie, Antifeminismus, qualitative Inhaltsanalyse, kritische Rechtsextremismusforschung
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Sind die Konzeptionen des Autoritarismus noch passfähig? – Ein Diskussionsvorschlag anlässlich des 125. Geburtstags von Erich Fromm (Wolfgang Frindte)
Vor dem Hintergrund eines weltweiten „Authoritarian Turn“ wird gefragt, inwieweit sozialwissenschaftliche Autoritarismus-Konzeptionen den gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen gerecht werden bzw. inwieweit es sich lohnt, nach ergänzenden Erklärungen zu suchen? Nach einem Blick in die bekannte Geschichte der Autoritarismusforschung werden verschiedene Autoritarismus-Konzeptionen diskutiert: Der „Right-Wing Authoritarianism“ von Altemeyer, die Autoritarismus-Konzeption von Decker und Kolleg:innen, die „Theorie der sozialen Dominanz“ von Sidanius und Pratto, das „duale Prozessmodell“ von Duckitt sowie die Konzeption des „libertären Autoritarismus“ von Amlinger und Nachtwey. Schließlich wird das Konzept des „Group Narcissism“ von Erich Fromm mit dem „Social Identity Approach“ von Tajfel und Kolleg:innen verglichen. Für Erich Fromm ist der Gruppen-Narzissmus ein relativ stabiles Moment eines Gesellschaftscharakters. Autoritär eingestellte Gruppen-Narzisst:innen kümmern sich ausschließlich und ohne Skrupel um ihre eigene (und gruppenbezogene) Einzigartigkeit, ihre Macht und ihr Geld und diskriminieren deshalb schamlos schwache und unterlegene Gruppen. Vorgeschlagen wird deshalb, darüber zu diskutieren, ob der Gruppen-Narzissmus nicht ein nützlicher und theoretischer Ansatz sein kann, um in Ergänzung zu den bisherigen Autoritarismus-Konzeptionen auch den Elitarismus der Trumpist:innen und ihrer Unterstützer:innen beobachten und analysieren zu können. Schlüsselbegriffe: Authoritarian Turn, Autoritarismus, Gruppen-Narzissmus, Trumpismus
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Politische Stimmung und pro-russische Rhetorik auf Telegram. Netzwerk- und diskursanalytische Befunde (Jörg Schoolmann & Andreas Ziemann)
Social Media sind der neue zentrale Austragungsort für gesellschaftliche Problemlagen, kollektive Befindlichkeiten und den Kampf um Deutungshoheit. Seit längerer Zeit nutzen viele extremistische politische Akteur:innen diese mediale Infrastruktur – allen voran Telegram –, um ihre Ideologie und ihre Sicht auf (globale) Krisen zu verbreiten und attraktiv zu machen. Ein aktuelles, hoch virulentes Krisenthema bilden der Ukraine-Krieg und seine antagonistischen Diskurspositionen. Vor diesem Hintergrund fragen wir: 1. Wie präsentieren und positionieren sich rechte Akteur:innen auf Telegram zu verschiedenen politischen Themen? 2. Wie wird der Ukraine-Krieg aus pro-russischer Perspektive im Jahr 2022 diskursiv verhandelt? Dazu haben wir ein Gesamtnetzwerk von 7.999 deutschsprachigen Akteur:innen erhoben und für die kritische Analyse aufbereitet. Methodisch bedienen wir uns einerseits der Netzwerkanalyse und des Topic-Modeling und andererseits der wissenssoziologischen Diskursanalyse. Im Ergebnis konnten wir sechs dominante Themencluster und vier dominante pro-russische Kanäle identifizieren. Deren Nachrichteninhalte zeigen u. a. einen ideologischen Konsens, dass Russland keinen Angriffskrieg führe, mit „Friedenstruppen“ gegenüber Bestrebungen einer neuen Weltordnung („Great Reset“) agiere und Putin das größte „Genie der Geo-Politik“ sei. Schlüsselbegriffe: digitale Netzwerke, Diskursanalyse, pro-russische Rhetorik, Telegram, Ukraine-Krieg, Wissenssoziologie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Der wesensgleiche Glaube. Eine Einzelfallstudie zur Rekonstruktion der Weltansicht eines „rechts-patriotischen Heiden“ (Anika Steppacher)
Es ist Ziel dieses Artikels, die Verwobenheit völkischen Denkens mit einer neuheidnischen Religion aufzuzeigen und die Funktion dieser Weltansicht in subjektorientierter Perspektive zu analysieren. Theoretisch an Luckmanns Konzept der Unsichtbaren Religion ausgerichtet, wird untersucht, wie sich dieser Glaube individuell stabilisiert und in Zeiten von Krisen und Verunsicherung bewährt. Geleitet durch den Grounded Theory-Ansatz wird der Fall eines „rechts-patriotischen Heiden“ untersucht. Als zentrales Ergebnis wird die Kontingenzbewältigung durch Unveräußerlichkeit herausgestellt. Dies entfaltet sich in folgender Dynamik: Durch Scheitern gewaltvoller Strategien und Läuterung zu einem authentischen Selbst wird über einen wesensgleichen Glauben, in der mittelbaren Kommunikation mit den Göttern, Trost und Gewissheit erfahren. Diese Analyse bietet Einblicke in interne Stabilisierungsmechanismen einer religiös gewandten völkischen Weltansicht über das Jugendalter hinaus. Keywords: völkisches Denken, germanisch-neuheidnische Religiosität, Einzelfallstudie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
In guter Gesellschaft: Bedrohungswahrnehmungen als Kompass für die Konstruktion einer erwünschten zivilgesellschaftlichen Demokratiearbeit (Tina Leber)
Die Wahrnehmung, Thematisierung und Bewertung von Bedrohungen gegen zivilgesellschaftliche Akteur:innen der Demokratiearbeit stellt einen Kompass für gesellschaftspolitische Entwicklungen und deren diskursive Rahmungen dar. Dabei steht die Frage im Fokus, wie Inklusions- und Exklusionsmechanismen zur Konstruktion einer erwünschten zivilgesellschaftlichen Demokratiearbeit beitragen. Als zentraler Referenzpunkt kann hier die Verortung von Akteur:innen in und außerhalb der gesellschaftlichen Mitte dienen. Die politische Markierung ‚links(‐extrem)‘ spielt dabei eine bedeutsame Rolle. Dieser Beitrag analysiert auf Basis von 20 qualitativen Interviews mit Personen aus dem Feld der Demokratiearbeit gegen Rechts Prozesse der Vermittung, Verrandständigung und Auftrennung des Engagements. Die Ausführung leistet einen Beitrag zur Analyse von Bedrohungen als Marker für gesellschaftliche Ordnungen und erweitert folglich den Fokus über die individuelle Betroffenheit hinaus. Schlüsselbegriffe: Zivilgesellschaft, Bedrohung, Demokratiearbeit, „Linksextremismus“, Markierung
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
ZRex – Zeitschrift für Rechtsextremismusforschung
2-2025: Freie Beiträge
Beiträge
Nikolas Dietze: Lokale Repräsentationsspezifika der AfD im Vergleich: Klassenfragen im Kontext der sachsen-anhaltinischen Kommunalwahl 2024
Schahrzad Farrokhzad / Gudrun Hentges / Birgit Jagusch / Anno Kluß / Lisa Tölle: „Impfungen dienen zur gezielten Dezimierung unliebsamer Bevölkerungsgruppen“ – Radikalisierung durch Verschwörungsideologien und ihre Auswirkungen auf den sozialen Nahraum
Samuel Breidenbach: Die rechtsextreme Gemeinschaft in Telegram. Akteur:innen, Verbindungen, Vergemeinschaftungspraktiken
Linda Sachs: „Für das Leben!“ – Deckmantel extrem rechter Ideologie? Die „Lebensschutz“-Bewegung und ihr Verhältnis zum Rechtsextremismus. Eine Analyse der Reden des Münchner Marsch fürs Leben
Wolfgang Frindte: Sind die Konzeptionen des Autoritarismus noch passfähig? – Ein Diskussionsvorschlag anlässlich des 125. Geburtstags von Erich Fromm
Jörg Schoolmann / Andreas Ziemann: Politische Stimmung und pro-russische Rhetorik auf Telegram. Netzwerk- und diskursanalytische Befunde
Anika Steppacher: Der wesensgleiche Glaube. Eine Einzelfallstudie zur Rekonstruktion der Weltansicht eines „rechts-patriotischen Heiden“
Tina Leber: In guter Gesellschaft: Bedrohungswahrnehmungen als Kompass für die Konstruktion einer erwünschten zivilgesellschaftlichen Demokratiearbeit
Forum
Marlene Hilgenstock / Alexander Jedinger / Pascal Kolkwitz-Anstötz / Pascal Siegers: DP-R|EX: Das Datenportal für die Rassismus- und Rechtsextremismusforschung
Viktoria Rösch / Michaela Köttig / Paula Matthies: Forschung mit Haltung: Tagungsbericht zum Symposium am 12. März 2025 anlässlich des 60. Geburtstags von Renate Bitzan in Nürnberg
Sebastian Barsch: Habbo Knoch: ein Nachruf
Rezensionen
Nikolai Schreiter: Dietl, Stefan (2025). Antisemitismus und die AfD
Yves Müller: Schmerdtmann, Mattes (2024). Das Deutsche Kulturwerk Europäischen Geistes (1950–1996). Porträt eines völkischen Kulturvereins und seiner Schriften
Fabian Virchow: Ramos, Paola (2024): Defectors. The Rise of the Latino Far Right and What it Means for America
Wolfgang Frindte: Quent, Matthias & Virchow, Fabian (Hrsg.). (2024). Rechtsextrem, das neue Normal? Die AfD zwischen Verbot und Machtübernahme
Fabian Virchow: Vaughan, Antonia; Braune, John; Tinsely, Meghan & Mondon, Aurelien (Hrsg.). (2024): The ethics of researching the far right. Critical approaches and reflections
Aysun Doğmuş: Farrokhzad, Schahrzad & Jagusch, Birgit (2024). Extrem rechte und rassistische Gewalt. Auswirkungen – Handlungs- und Bewältigungsmuster – Konsequenzen
Einzelbeitrag-Download (Open Access): zrex.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZRex-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 2701-9624 |
| eISSN | 2701-9632 |
| Jahrgang | 5. Jahrgang 2025 |
| Ausgabe | 2-2025 |
| Erscheinungsdatum | 30.10.2025 |
| Umfang | 176 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Zusatzmaterial
Zusatzmaterial
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterAfD, Antifeminismus, Authoritarian Turn, Autoritarismus, Bedrohung, Demokratiearbeit, digitale Netzwerke, digitaler Rechtsextremismus, Diskursanalyse, DP-R|EX, Einzelfallstudie, germanisch-neuheidnische Religiosität, Gruppen-Narzissmus, Ideologie, Klassenanalyse, Kommunalpolitik, kritische Rechtsextremismusforschung, Lebensschutz-Bewegung, Linksextremismus, Markierung, Netzwerkanalyse, Oktober 2025, Plattforminfrastruktur, pro-russische Rhetorik, qualitative Inhaltsanalyse, quantitative Forschung, Radikalisierung, Rechtsextremismus, Repräsentation, social media, soziale Frage, sozialer Nahraum, Telegram, Topic Modeling, Transformation, Trumpismus, Ukraine-Krieg, völkisch-autoritäre Verschwörungsideologien, völkisches Denken, Wissenssoziologie, Zivilgesellschaft
Abstracts
Abstracts
Lokale Repräsentationsspezifika der AfD im Vergleich: Klassenfragen im Kontext der sachsen-anhaltinischen Kommunalwahl 2024 (Nikolas Dietze)
In diesem Artikel werden deskriptive Repräsentationsmuster und -disparitäten der AfD auf kommunaler Ebene am Fallbeispiel der sachsen-anhaltinischen Kommunalwahlen 2024 herausgearbeitet. Ziel der Untersuchung ist, soziostrukturelle Merkmale der AfD-Kandidat:innen zu kontrastieren und mit den Profilen der CDU, SPD und Linken zu vergleichen. Methodisch erfolgt dies mittels einer deskriptiv-quantitativen Datenanalyse von 2.577 Kandidat:innen entlang berufs- und bildungsspezifischer Merkmale, die anschließend klassenspezifisch analysiert werden. Die zentralen Ergebnisse zeigen, dass die AfD überproportional viele Kandidat:innen aus niedrigqualifizierter Produktions- und Dienstleistungsarbeit aufstellt und damit wesentlich repräsentativer für die ostdeutsche Sozialstruktur ist als die drei Vergleichsparteien, die primär hochqualifizierte Berufs- und Statusgruppen vertreten. Die Diskussion stellt mögliche Erklärungsansätze für diese Befunde heraus und unterstreicht, wie die AfD die soziale Frage von Verteilungsfragen weg hin zu nationalistischen und klassistischen Narrativen umdeutet. Schlüsselbegriffe: Repräsentation, Klassenanalyse, AfD, Soziale Frage, Kommunalpolitik, Transformation
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Impfungen dienen zur gezielten Dezimierung unliebsamer Bevölkerungsgruppen“ – Radikalisierung durch Verschwörungsideologien und ihre Auswirkungen auf den sozialen Nahraum (Schahrzad Farrokhzad, Gudrun Hentges, Birgit Jagusch, Anno Kluß & Lisa Tölle)
Verschwörungsideologien sind oftmals mit völkisch-autoritären Weltanschauungen verknüpft und können zu einem gefährlichen gesellschaftlichen Klima führen. Im vorliegenden Artikel werden quantitative Forschungsergebnisse des Projekts „RaisoN“ dargestellt, in dem u. a. Auswirkungen von Verschwörungsideologien auf soziale Nahräume erforscht werden. Hierzu wurden Fachkräfte der Beratungs- und Bildungsarbeit mittels quantitativer Fragebogenerhebung befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass Verschwörungsideologien negative Auswirkungen auf das soziale Miteinander und die psychische Gesundheit von Betroffenen haben und zu Radikalisierungsprozessen in diesen sozialen Räumen führen können. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit spezialisierter Bildungsund Beratungsangebote für Fachkräfte, um kompetent und nachhaltig auf die Herausforderungen im Umgang mit Verschwörungsideologien zu reagieren. Zusätzlich sind Informations- und Austauschplattformen für Betroffene nötig, um die psychischen und sozialen Folgen besser zu bewältigen. Die Analyse zeigt, dass Verschwörungsideologien zur Radikalisierung von Gemeinschaften und zur weiteren gesellschaftlichen Fragmentierung führen können. Schlüsselbegriffe: völkisch-autoritäre Verschwörungsideologien, sozialer Nahraum, quantitative Forschung, Radikalisierung
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die rechtsextreme Gemeinschaft in Telegram. Akteur:innen, Verbindungen, Vergemeinschaftungspraktiken (Samuel Breidenbach)
Der Beitrag kombiniert unterschiedliche Methoden und theoretische Perspektiven, um die rechtsextreme Gemeinschaft in Telegram genauer zu charakterisieren. Hierfür wird zunächst auf Grundlage einer Darstellung von Telegrams technischer Infrastruktur argumentiert, warum die Plattform der rechten Szene besonders geeignete Ausgangsbedingungen zu bieten scheint. Mit einer Kombination aus netzwerkanalytischen, computerlinguistischen und qualitativen Verfahren werden dann eine Struktur aus 265 rechten Telegram-Kanälen sowie die von ihnen verbreiteten Inhalte untersucht, um hierdurch aus unterschiedlichen Perspektiven einen detaillierten Einblick in die Akteur:innen, Verbindungen und Inhalte in diesem Netzwerk zu gewinnen. Diese Ergebnisse werden schließlich im Kontext der aktuellen Forschung zu digitalem Rechtsextremismus diskutiert, um zu zeigen, wie die Betreiber:innen der rechten Kanäle in Telegram gemeinsam mit den dort aktiven Nutzer:innen ein rassistisches und kospirationistisches Weltbild konstruieren und sich durch den wechselseitigen Austausch miteinander als Gemeinschaft festigen. Der Beitrag verdeutlicht, wie Telegram mit einer Kombination aus der Affordanz der Plattforminfrastruktur, dem Fehlen jeglicher zentralen Instanz zur Inhaltsmoderation und den Inhalten der dort aktiven Akteur:innen das Entstehen, Wachsen und Festigen einer rechtsextremen Gemeinschaft unterstützt. Schlüsselbegriffe: Telegram, Social Media, digitaler Rechtsextremismus, Plattforminfrastruktur, Netzwerkanalyse, Topic-Modeling
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Für das Leben!“ – Deckmantel extrem rechter Ideologie? Die „Lebensschutz“-Bewegung und ihr Verhältnis zum Rechtsextremismus. Eine Analyse der Reden des Münchner Marsch fürs Leben (Linda Sachs)
Der Beitrag untersucht die Ideologieelemente der „Lebensschutz“-Bewegung und ihr Verhältnis zu extrem rechter Ideologie. Theoretisch orientiert sich die Analyse am Rechtsextremismusbegriff von Willibald Holzer, der Rechtsextremismus als Syndromphänomen begreift. Mittels qualitativer Inhaltsanalyse werden die Reden des Münchner Marsches fürs Leben (2021–2023) ausgewertet und die darin enthaltenen Themen, Argumentationslinien und Narrative analysiert. Die Ergebnisse zeigen einen ausgeprägten Dualismus zwischen dem vermeintlich „Natürlichen“ („Kultur des Lebens“) und „Widernatürlichen“ („Kultur des Todes“) als ideologisches Grundmuster. Grundlegende Ideologieelemente sind u. a. ein binäres Geschlechterbild und naturalisierte Geschlechterungleichheit, die Konstruktion eines christlich-europäischen Kulturraums, Antifeminismus, Antipluralismus, Verschwörungsdenken und struktureller Antisemitismus. Die Analyse offenbart deutliche ideologische Schnittstellen mit der extremen Rechten. Auch wenn die Bewegung nicht als eindeutig extrem rechts einzuordnen ist, fungiert sie als Scharnier zwischen der extremen Rechten und der Gesamtgesellschaft und trägt zur Normalisierung rechter Themen und Argumentationsmuster bei. Schlüsselbegriffe: Lebensschutz-Bewegung, Rechtsextremismus, Ideologie, Antifeminismus, qualitative Inhaltsanalyse, kritische Rechtsextremismusforschung
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Sind die Konzeptionen des Autoritarismus noch passfähig? – Ein Diskussionsvorschlag anlässlich des 125. Geburtstags von Erich Fromm (Wolfgang Frindte)
Vor dem Hintergrund eines weltweiten „Authoritarian Turn“ wird gefragt, inwieweit sozialwissenschaftliche Autoritarismus-Konzeptionen den gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen gerecht werden bzw. inwieweit es sich lohnt, nach ergänzenden Erklärungen zu suchen? Nach einem Blick in die bekannte Geschichte der Autoritarismusforschung werden verschiedene Autoritarismus-Konzeptionen diskutiert: Der „Right-Wing Authoritarianism“ von Altemeyer, die Autoritarismus-Konzeption von Decker und Kolleg:innen, die „Theorie der sozialen Dominanz“ von Sidanius und Pratto, das „duale Prozessmodell“ von Duckitt sowie die Konzeption des „libertären Autoritarismus“ von Amlinger und Nachtwey. Schließlich wird das Konzept des „Group Narcissism“ von Erich Fromm mit dem „Social Identity Approach“ von Tajfel und Kolleg:innen verglichen. Für Erich Fromm ist der Gruppen-Narzissmus ein relativ stabiles Moment eines Gesellschaftscharakters. Autoritär eingestellte Gruppen-Narzisst:innen kümmern sich ausschließlich und ohne Skrupel um ihre eigene (und gruppenbezogene) Einzigartigkeit, ihre Macht und ihr Geld und diskriminieren deshalb schamlos schwache und unterlegene Gruppen. Vorgeschlagen wird deshalb, darüber zu diskutieren, ob der Gruppen-Narzissmus nicht ein nützlicher und theoretischer Ansatz sein kann, um in Ergänzung zu den bisherigen Autoritarismus-Konzeptionen auch den Elitarismus der Trumpist:innen und ihrer Unterstützer:innen beobachten und analysieren zu können. Schlüsselbegriffe: Authoritarian Turn, Autoritarismus, Gruppen-Narzissmus, Trumpismus
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Politische Stimmung und pro-russische Rhetorik auf Telegram. Netzwerk- und diskursanalytische Befunde (Jörg Schoolmann & Andreas Ziemann)
Social Media sind der neue zentrale Austragungsort für gesellschaftliche Problemlagen, kollektive Befindlichkeiten und den Kampf um Deutungshoheit. Seit längerer Zeit nutzen viele extremistische politische Akteur:innen diese mediale Infrastruktur – allen voran Telegram –, um ihre Ideologie und ihre Sicht auf (globale) Krisen zu verbreiten und attraktiv zu machen. Ein aktuelles, hoch virulentes Krisenthema bilden der Ukraine-Krieg und seine antagonistischen Diskurspositionen. Vor diesem Hintergrund fragen wir: 1. Wie präsentieren und positionieren sich rechte Akteur:innen auf Telegram zu verschiedenen politischen Themen? 2. Wie wird der Ukraine-Krieg aus pro-russischer Perspektive im Jahr 2022 diskursiv verhandelt? Dazu haben wir ein Gesamtnetzwerk von 7.999 deutschsprachigen Akteur:innen erhoben und für die kritische Analyse aufbereitet. Methodisch bedienen wir uns einerseits der Netzwerkanalyse und des Topic-Modeling und andererseits der wissenssoziologischen Diskursanalyse. Im Ergebnis konnten wir sechs dominante Themencluster und vier dominante pro-russische Kanäle identifizieren. Deren Nachrichteninhalte zeigen u. a. einen ideologischen Konsens, dass Russland keinen Angriffskrieg führe, mit „Friedenstruppen“ gegenüber Bestrebungen einer neuen Weltordnung („Great Reset“) agiere und Putin das größte „Genie der Geo-Politik“ sei. Schlüsselbegriffe: digitale Netzwerke, Diskursanalyse, pro-russische Rhetorik, Telegram, Ukraine-Krieg, Wissenssoziologie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Der wesensgleiche Glaube. Eine Einzelfallstudie zur Rekonstruktion der Weltansicht eines „rechts-patriotischen Heiden“ (Anika Steppacher)
Es ist Ziel dieses Artikels, die Verwobenheit völkischen Denkens mit einer neuheidnischen Religion aufzuzeigen und die Funktion dieser Weltansicht in subjektorientierter Perspektive zu analysieren. Theoretisch an Luckmanns Konzept der Unsichtbaren Religion ausgerichtet, wird untersucht, wie sich dieser Glaube individuell stabilisiert und in Zeiten von Krisen und Verunsicherung bewährt. Geleitet durch den Grounded Theory-Ansatz wird der Fall eines „rechts-patriotischen Heiden“ untersucht. Als zentrales Ergebnis wird die Kontingenzbewältigung durch Unveräußerlichkeit herausgestellt. Dies entfaltet sich in folgender Dynamik: Durch Scheitern gewaltvoller Strategien und Läuterung zu einem authentischen Selbst wird über einen wesensgleichen Glauben, in der mittelbaren Kommunikation mit den Göttern, Trost und Gewissheit erfahren. Diese Analyse bietet Einblicke in interne Stabilisierungsmechanismen einer religiös gewandten völkischen Weltansicht über das Jugendalter hinaus. Keywords: völkisches Denken, germanisch-neuheidnische Religiosität, Einzelfallstudie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
In guter Gesellschaft: Bedrohungswahrnehmungen als Kompass für die Konstruktion einer erwünschten zivilgesellschaftlichen Demokratiearbeit (Tina Leber)
Die Wahrnehmung, Thematisierung und Bewertung von Bedrohungen gegen zivilgesellschaftliche Akteur:innen der Demokratiearbeit stellt einen Kompass für gesellschaftspolitische Entwicklungen und deren diskursive Rahmungen dar. Dabei steht die Frage im Fokus, wie Inklusions- und Exklusionsmechanismen zur Konstruktion einer erwünschten zivilgesellschaftlichen Demokratiearbeit beitragen. Als zentraler Referenzpunkt kann hier die Verortung von Akteur:innen in und außerhalb der gesellschaftlichen Mitte dienen. Die politische Markierung ‚links(‐extrem)‘ spielt dabei eine bedeutsame Rolle. Dieser Beitrag analysiert auf Basis von 20 qualitativen Interviews mit Personen aus dem Feld der Demokratiearbeit gegen Rechts Prozesse der Vermittung, Verrandständigung und Auftrennung des Engagements. Die Ausführung leistet einen Beitrag zur Analyse von Bedrohungen als Marker für gesellschaftliche Ordnungen und erweitert folglich den Fokus über die individuelle Betroffenheit hinaus. Schlüsselbegriffe: Zivilgesellschaft, Bedrohung, Demokratiearbeit, „Linksextremismus“, Markierung
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)






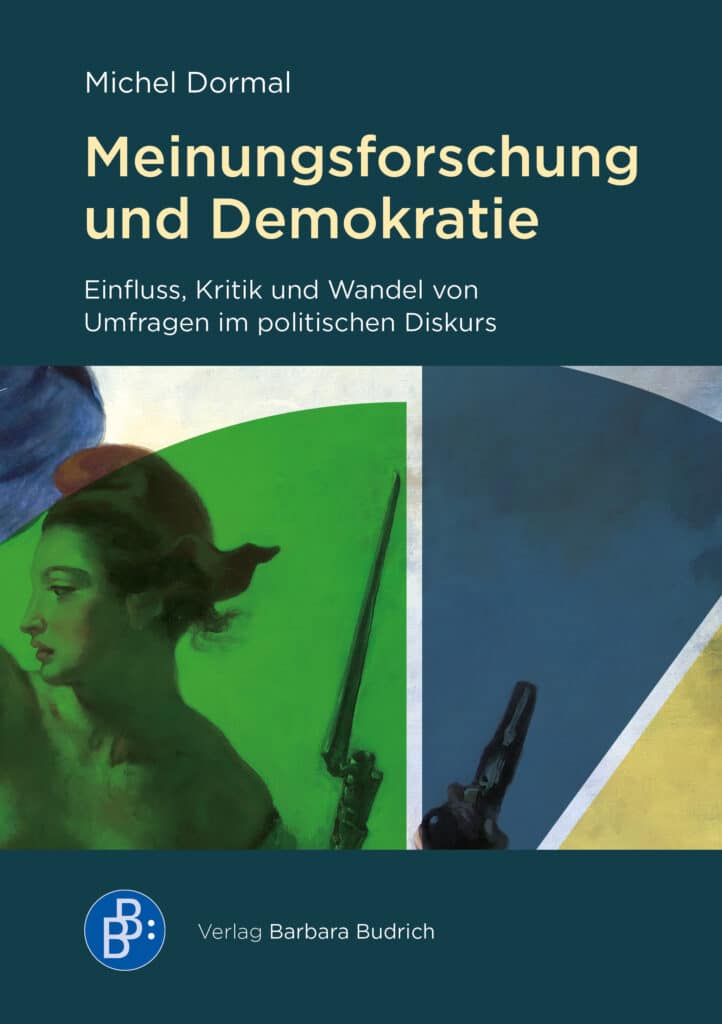



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.