Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » BIOS 1+2-2024 | Qualitative Interviews revisited. Empirische Erkenntnisse zur sozialwissenschaftlichen Datenproduktion
BIOS 1+2-2024 | Qualitative Interviews revisited. Empirische Erkenntnisse zur sozialwissenschaftlichen Datenproduktion
Erscheinungsdatum : 15.07.2025
68,00 €
- Inhalt
- Bibliografie
- Produktsicherheit
- Zusatzmaterial
- Bewertungen (0)
- Autor*innen
- Schlagwörter
- Abstracts
Inhalt
BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen
1+2-2024: Qualitative Interviews revisited. Empirische Erkenntnisse zur sozialwissenschaftlichen Datenproduktion
Hrsg. von: Judith Eckert, Georgios Coussios & Carsten G. Ullrich
Judith Eckert / Georgios Coussios / Carsten G. Ullrich: Einführung in das Themenheft
Beiträge
Fritz Schütze: Nachträgliche Betrachtungen zum autobiographisch-narrativen Interview. Eine historisch ausgerichtete work-study über sozialwissenschaftliche Entdeckungsarbeit an einer Forschungsmethode. In Erinnerung an meinen Freund und Mitforscher Thomas Reim 1952-2024
Shevek K. Selbert: Telling the Same Life Story Twice. Interaktionale Konstitutionsbedingungen von Stegreiferzählungen im narrativen Interview zwischen Adressierungszwang und „passing stranger“-Effekt
Miriam Schäfer: Das (vermeintliche) Scheitern von narrativen Interviews. Zum Erkenntnispotenzial von Interviewdynamiken
Uwe Krähnke: Was verraten nicht-narrative Darstellungen in biographischen Interviews? Zur moralischen Rechtfertigungs- und Entlastungsrhetorik in verbalen Selbstauskünften
Michael Corsten / Laura Maleyka: Die Präsentation der biographischen Visitenkarte. Erzählstimulus und Selbsteinführung am Interviewbeginn
Georgios Coussios / Judith Eckert: Wie kommt es zu (k)einer Erzählung? Zum erzähl- und argumentationsgenerierenden Potenzial von Wie-kommen-Stimuli in qualitativen Interviews
Christine Paul: Zum (Weiter-)Erzählen und Ausarbeiten animieren. Fremdwiederholungen als Praxis der zurückhaltenden Gesprächssteuerung
Interviews zu Interviews
Kathryn Roulston / Judith Eckert / Georgios Coussios: Kathryn Roulston in conversation with Judith Eckert and Georgios Coussios. “Any time I came across something puzzling or problematic, I wrote about it, and that helped me to think about interviews theoretically”
Charles L. Briggs / Judith Eckert / Georgios Coussios: Charles L. Briggs in conversation with Judith Eckert and Georgios Coussios. Decolonizing knowledge production in and through interview research
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): bios.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den BIOS-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 0933-5315 |
| eISSN | 2196-243X |
| Jahrgang | 37. Jahrgang 2024 |
| Ausgabe | 1+2-2024 |
| Erscheinungsdatum | 15.07.2025 |
| Umfang | 280 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Zusatzmaterial
Autor*innen
SchlagwörterAdressierungszwang, autobiographisch-narratives Interview, biographische Interviews, biographische Visitenkarte, Entlastungsrhetorik, Erzählstimulus, Forschungsmethoden, Gesprächssteuerung, interaktionale Konstitutionsbedingungen, Interviewdynamiken, Interviews, Juli 2025, narrative Interviews, qualitative Interviews, Rechtfertigungsrhetorik, Selbstauskunft, sozialwissenschaftliche Datenproduktion, sozialwissenschaftliche Entdeckungsarbeit, Stegreiferzählungen, „passing stranger“-Effekt
Abstracts
Nachträgliche Betrachtungen zum autobiographisch-narrativen Interview. Eine historisch ausgerichtete work-study über sozialwissenschaftliche Entdeckungsarbeit an einer Forschungsmethode. In Erinnerung an meinen Freund und Mitforscher Thomas Reim 1952-2024 (Fritz Schütze)
Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der motivierenden Vorgeschichte und der Entstehung des narrativen Interviews und insbesondere des autobiographisch-narrativen Interviews in den 1970er Jahren und mit der grundlagentheoretischen Weiterentwicklung seiner Analysemöglichkeiten in den späteren Jahren: Es handelt sich entsprechend um keine propagierende Darlegung dieser Interviewform, sondern um eine Arbeitsstudie der Entstehung und Entfaltung einer neuen offenen Interviewform mit all den damit verbundenen Such- und Erkenntnisschwierigkeiten. Der Aufsatz rekonstruiert, wie von jungen Sozialforschern in den neunzehnhundertsiebziger Jahren Wege für die Erfassung der Erlebniswirklichkeit von Gesellschaftsmitgliedern gesucht wurden, die für die Soziologie bis dahin oftmals hinter den Fassadendarstellungen abstrakter Diskurse verborgen lag. Entsprechend kam die Idee des Stegreiferzählens des eigenen Erlebens kollektiver Prozesse auf. Die Analyse kollektiver Prozesse (wie derjenigen von Gemeindezusammenlegungen) stieß dabei jedoch auf die Frage, wie Darstellungen individuell-lebensgeschichtlicher Prozesse untersucht werden konnten, die in die Darstellungen selbsterlebter kollektiver Prozesse verwoben waren. Für die Analyse biographischer Prozesse wurde entsprechend die soziolinguistische Untersuchung elementarer Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung – derjenigen des Erzählens, des Beschreibens und des Argumentierens – zentral. Zum Schluss wird schließlich die Frage der relationalen Parallelitätsbeziehung zwischen der („vergangenen“) Erlebnisebene und der („jetzigen“) Erzählebene behandelt.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Telling the Same Life Story Twice. Interaktionale Konstitutionsbedingungen von Stegreiferzählungen im narrativen Interview zwischen Adressierungszwang und „passing stranger“-Effekt (Shevek K. Selbert)
In diesem Beitrag wird mit Blick auf längsschnittlich wiederholte biographisch-narrative Interviews reflektiert, welchen interaktionalen Gesetzmäßigkeiten Stegreiferzählungen unterliegen. Wiederholungsbefragungen fördern auch hochstabile Wiederholungserzählungen zu Tage, die die Frage nach der Stabilität und Wandelbarkeit von Selbsterzählungen aufwerfen. Als Bezugspunkte nutze ich dazu unterschiedliche methodologische Erwartungen aus der Forschungsliteratur. Der Biographieforschung Schütze‘scher Prägung liegt die Auffassung zugrunde, dass Erzählprozesse vorrangig durch emergente Selbstläufigkeit charakterisiert sind und erprobte Geschichten unerwünscht das Stegreifprinzip unterlaufen. Dagegen wird nach konversationsanalytischen Positionen der sozial-interaktive Herstellungskontext der Erzählung betont, der das Erzählen kokonstruktiv stark dominiere. Zuletzt zeigt sich in Arbeiten der Wiedererzählforschung, wie hochstabil Formulierungen und ganze Geschichten unabhängig von Erzählemergenzen und Erzählsituationen sein können. Anhand von sechs Schlüsselfällen zeige ich die Breite der Phänomene des autobiographischen Wiedererzählens und argumentiere, dass diese drei Paradigmen (Erzählemergenz, interaktive Hervorbringung und Vorgeformtheit) ineinander verschränkt werden können und müssen, um den empirischen Befunden gerecht zu werden. Dazu schlage ich mit Adressierungszwang einen vierten Zugzwang des Erzählens (Kallmeyer/Schütze 1977) vor. Gleichzeitig erkläre ich mit dem Konzept des „passing strangers“ (Rubin 1974), wieso ein solcher Zugzwang im narrativen Interview in aller Regel stark reduziert ist. Insgesamt weise ich darauf hin, wie die eigene Selbsterzählung im Stegreif im Spannungsverhältnis sowohl zwischen Adressierungszwang und „passing stranger“-Effekt als auch zwischen dynamischer Emergenz und stabilisierender Vorgeformtheit je neu und wieder entsteht.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Das (vermeintliche) Scheitern von narrativen Interviews. Zum Erkenntnispotenzial von Interviewdynamiken (Miriam Schäfer)
In diesem Beitrag plädiere ich aus einer biographietheoretischen Perspektive dafür, Interviewdynamiken als empirisches Phänomen eines konkreten Forschungsfeldes zu betrachten. Empirische Basis bilden meine biographieanalytische und ethnographische Forschung zu biographischen Verläufen und Handlungsstrukturen im Feld der Polizei sowie ein Forschungsprojekt, in dem die intergenerationalen Handlungs- und Erinnerungsstrukturen in Familien stigmatisierter NS-Opfer in Österreich und Deutschland in einer biographietheoretischen Mehrgenerationenstudie untersucht werden; in diesem Artikel fokussiere ich auf Interviews, die in diesem Rahmen mit Mitgliedern der Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen geführt wurden. Anhand der Beispiele wird gezeigt, dass (vermeintlich) problematische Interviewdynamiken in einem Forschungsfeld für den Erkenntnisgewinn genutzt werden können und, dass es sich bei der Art wie narrative Interviews verlaufen nicht (nur) um individuelle Verläufe handelt, sondern (auch) um gruppen- bzw. feldspezifische Forschungsergebnisse. Ob und inwiefern narrative Interviews „gelingen“ oder „scheitern“, kann mit der Strukturierung des Forschungsfeldes erklärt werden und steht in Wechselwirkung mit dem Forschungsdesign.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Was verraten nicht-narrative Darstellungen in biographischen Interviews? Zur moralischen Rechtfertigungs- und Entlastungsrhetorik in verbalen Selbstauskünften (Uwe Krähnke)
Das Augenmerk des vorliegenden Beitrages liegt auf den nicht-narrativen Darstellungsformaten in qualitativen Interviews, den Beschreibungen von Routineabläufen bzw. allgemeinen Sachverhalten sowie den mit Stilmitteln der Argumentation vorgetragenen Einschätzungen und Bewertungen. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass Personen, denen der Makel devianter oder gesellschaftlich nicht geduldeter Verhaltensweisen anhaftet, in narrativ-biographischen Interviews zu beschreiben und komplex zu argumentieren anfangen, ohne dass sie dazu von den Interviewenden explizit aufgefordert werden. Zudem zeigt sich, dass sich die Interviewten in ihre nicht-narrativen Äußerungen „verstricken“. Entsprechende Interviewsequenzen entfalten eine Eigendynamik, die sich ihrer Kontrolle weitestgehend entzieht. Gezeigt wird, dass solche in den Selbstauskünften verwendeten Textsorten der Beschreibung und Argumentation eine performative Funktion haben. Die nicht-narrativen Äußerungen ermöglichen den Interviewten, die „eigene Geschichte“ zu verbalisieren, ohne in kognitive Dissonanzen zu geraten und sich moralisch schuldig zu fühlen. Die bei dieser performativen Selbstpositionierung genutzten Entlastungs- und Rechtfertigungsrhetoriken werden anhand von geführten Interviews mit Angehörigen einer in der Bundesrepublik diskreditierten und stigmatisierten Personengruppe aufgezeigt – den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des DDR-Geheimdienstes. Plädiert wird in dem Beitrag dafür, Beschreibungen und Argumentationen in qualitativen Interviews parallel zu den narrativen Interviewpassagen methodisch kontrolliert zu dechiffrieren und theoretisch-analytisch zu durchdringen. Solche nicht-narrativen Interviewpassagen sind als authentische Selbstauskünfte und integrale Bestandteile einer kohärenten autobiographischen Lebensgeschichte der Interviewten zu bewerten. Grundlagentheoretisch mit Rekurs auf Bourdieu lässt sich behaupten: Im qualitativen Interview manifestiert sich der Habitus einer befragten Person.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Präsentation der biographischen Visitenkarte. Erzählstimulus und Selbsteinführung am Interviewbeginn (Michael Corsten und Laura Maleyka)
Das qualitative Interview wird zur Erhebung häufig verwendet, ist in der Methodenliteratur vielfach beschrieben, allerdings empirisch kaum geprüft. Wir fragen in diesem Artikel danach, wie sich der Interviewstimulus der Interviewperson auf die Selbsteinführung der befragten Person auswirkt. Dazu greifen wir auf ein Sample aus 114 biographischen Interviews zurück und werten dieses sowohl qualitativ als auch quantitativ aus. Wir fassen die soziale Situation des qualitativen Interviews mit Ehlich/Rehbein (1972) als „Hyperpragmem“ und gehen mit Schütze (1984) davon aus, dass sich Personen beim Übergang in den besonderen Aktivitätsrahmen des Interviews durch eine „biographische Präambel“ charakterisieren. Den Einfluss der Ausgestaltung des Stimulus auf die Präambel analysieren wir dabei in quantitativer Hinsicht. Darauf aufbauend untersuchen wir narrations- und positionierungsanalytisch, welchen Stellenwert die Präambel für das gesamte Interview hat.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Wie kommt es zu (k)einer Erzählung? Zum erzähl- und argumentationsgenerierenden Potenzial von Wie-kommen-Stimuli in qualitativen Interviews (Georgios Coussios und Judith Eckert)
Erzählungen stellen in verschiedenen Verfahren der qualitativen Interviewforschung die methodologisch primäre Textsorte dar. In der Methodenliteratur finden sich entsprechend zahlreiche Hinweise darauf, mit welchen Stimuli Erzählungen elizitiert werden können. Die systematische, empirische Untersuchung der tatsächlichen Fragewirkungen steht allerdings größtenteils noch aus. Im vorliegenden Aufsatz tragen wir dazu bei, diese Forschungslücke zu füllen. Dabei fokussieren wir auf verschiedene Varianten von vergangenheitsorientierten „wie kommen“-Konstruktionen, nachdem Formulierungen wie „wie kam es, dass …?“ oder „wie kam das?“ in Lehr- und Einführungswerken zu diversen Interviewformaten als Erzählstimulus empfohlen werden. Grundlage unserer empirischen Untersuchung sind 72 Wie-kommen-Stimuli, die wir im Zuge zweier sekundäranalytisch ausgerichteter Methodenforschungsprojekte zur qualitativen Interviewforschung in acht thematisch und methodisch unterschiedlich ausgerichteten Studien identifiziert haben. Unsere Analyse zeigt, dass Wie-kommen-Formulierungen von den Interviewten üblicherweise nicht als reiner Erzählstimulus behandelt werden. Vielmehr folgen auf solche Stimuli auch und in den meisten Fällen sogar dominant argumentative Sachverhaltsdarstellungen. Im vorliegenden Beitrag weisen wir diese unerwartet polyseme, d.h. mehrdeutige Interpretation von Wie-kommen-Stimuli detailliert nach, zeigen, wie Interviewende dieser Polysemie entgegenwirken können und bieten eine Erklärung an, warum es bei Wie-kommen-Konstruktionen oft zu keiner Erzählung kommt.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Zum (Weiter-)Erzählen und Ausarbeiten animieren. Fremdwiederholungen als Praxis der zurückhaltenden Gesprächssteuerung (Christine Paul)
Interviewer:innen sollen ihre Gesprächspartern:innen zum Reden und Erzählen anregen, sich dabei aber möglichst zurückhaltend verhalten, um die Interviewten nicht zu beeinflussen. Fremdwiederholungen sind eine Möglichkeit, einen Gesprächsimpuls zu geben und nah an den Themen und Formulierungen der Interviewten zu bleiben. Während in der Forschung Fremdwiederholungen als Rezeptionssignale, Fremdreparaturen und in der Familientherapie als Mittel der Gesprächssteuerung analysiert werden, zeigen die Daten des Berliner Wendekorpus, dass Interviewer:innen mit Fremdwiederholungen Erzählungen unterstützen können, da sie mit ihnen Bezugselemente als relevant markieren, sodass Erzählwürdigkeit hergestellt wird und Interviewte Redebeiträge und Erzählungen ausarbeiten.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen
1+2-2024: Qualitative Interviews revisited. Empirische Erkenntnisse zur sozialwissenschaftlichen Datenproduktion
Hrsg. von: Judith Eckert, Georgios Coussios & Carsten G. Ullrich
Judith Eckert / Georgios Coussios / Carsten G. Ullrich: Einführung in das Themenheft
Beiträge
Fritz Schütze: Nachträgliche Betrachtungen zum autobiographisch-narrativen Interview. Eine historisch ausgerichtete work-study über sozialwissenschaftliche Entdeckungsarbeit an einer Forschungsmethode. In Erinnerung an meinen Freund und Mitforscher Thomas Reim 1952-2024
Shevek K. Selbert: Telling the Same Life Story Twice. Interaktionale Konstitutionsbedingungen von Stegreiferzählungen im narrativen Interview zwischen Adressierungszwang und „passing stranger“-Effekt
Miriam Schäfer: Das (vermeintliche) Scheitern von narrativen Interviews. Zum Erkenntnispotenzial von Interviewdynamiken
Uwe Krähnke: Was verraten nicht-narrative Darstellungen in biographischen Interviews? Zur moralischen Rechtfertigungs- und Entlastungsrhetorik in verbalen Selbstauskünften
Michael Corsten / Laura Maleyka: Die Präsentation der biographischen Visitenkarte. Erzählstimulus und Selbsteinführung am Interviewbeginn
Georgios Coussios / Judith Eckert: Wie kommt es zu (k)einer Erzählung? Zum erzähl- und argumentationsgenerierenden Potenzial von Wie-kommen-Stimuli in qualitativen Interviews
Christine Paul: Zum (Weiter-)Erzählen und Ausarbeiten animieren. Fremdwiederholungen als Praxis der zurückhaltenden Gesprächssteuerung
Interviews zu Interviews
Kathryn Roulston / Judith Eckert / Georgios Coussios: Kathryn Roulston in conversation with Judith Eckert and Georgios Coussios. “Any time I came across something puzzling or problematic, I wrote about it, and that helped me to think about interviews theoretically”
Charles L. Briggs / Judith Eckert / Georgios Coussios: Charles L. Briggs in conversation with Judith Eckert and Georgios Coussios. Decolonizing knowledge production in and through interview research
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): bios.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den BIOS-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 0933-5315 |
| eISSN | 2196-243X |
| Jahrgang | 37. Jahrgang 2024 |
| Ausgabe | 1+2-2024 |
| Erscheinungsdatum | 15.07.2025 |
| Umfang | 280 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Zusatzmaterial
Zusatzmaterial
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterAdressierungszwang, autobiographisch-narratives Interview, biographische Interviews, biographische Visitenkarte, Entlastungsrhetorik, Erzählstimulus, Forschungsmethoden, Gesprächssteuerung, interaktionale Konstitutionsbedingungen, Interviewdynamiken, Interviews, Juli 2025, narrative Interviews, qualitative Interviews, Rechtfertigungsrhetorik, Selbstauskunft, sozialwissenschaftliche Datenproduktion, sozialwissenschaftliche Entdeckungsarbeit, Stegreiferzählungen, „passing stranger“-Effekt
Abstracts
Abstracts
Nachträgliche Betrachtungen zum autobiographisch-narrativen Interview. Eine historisch ausgerichtete work-study über sozialwissenschaftliche Entdeckungsarbeit an einer Forschungsmethode. In Erinnerung an meinen Freund und Mitforscher Thomas Reim 1952-2024 (Fritz Schütze)
Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der motivierenden Vorgeschichte und der Entstehung des narrativen Interviews und insbesondere des autobiographisch-narrativen Interviews in den 1970er Jahren und mit der grundlagentheoretischen Weiterentwicklung seiner Analysemöglichkeiten in den späteren Jahren: Es handelt sich entsprechend um keine propagierende Darlegung dieser Interviewform, sondern um eine Arbeitsstudie der Entstehung und Entfaltung einer neuen offenen Interviewform mit all den damit verbundenen Such- und Erkenntnisschwierigkeiten. Der Aufsatz rekonstruiert, wie von jungen Sozialforschern in den neunzehnhundertsiebziger Jahren Wege für die Erfassung der Erlebniswirklichkeit von Gesellschaftsmitgliedern gesucht wurden, die für die Soziologie bis dahin oftmals hinter den Fassadendarstellungen abstrakter Diskurse verborgen lag. Entsprechend kam die Idee des Stegreiferzählens des eigenen Erlebens kollektiver Prozesse auf. Die Analyse kollektiver Prozesse (wie derjenigen von Gemeindezusammenlegungen) stieß dabei jedoch auf die Frage, wie Darstellungen individuell-lebensgeschichtlicher Prozesse untersucht werden konnten, die in die Darstellungen selbsterlebter kollektiver Prozesse verwoben waren. Für die Analyse biographischer Prozesse wurde entsprechend die soziolinguistische Untersuchung elementarer Kommunikationsschemata der Sachverhaltsdarstellung – derjenigen des Erzählens, des Beschreibens und des Argumentierens – zentral. Zum Schluss wird schließlich die Frage der relationalen Parallelitätsbeziehung zwischen der („vergangenen“) Erlebnisebene und der („jetzigen“) Erzählebene behandelt.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Telling the Same Life Story Twice. Interaktionale Konstitutionsbedingungen von Stegreiferzählungen im narrativen Interview zwischen Adressierungszwang und „passing stranger“-Effekt (Shevek K. Selbert)
In diesem Beitrag wird mit Blick auf längsschnittlich wiederholte biographisch-narrative Interviews reflektiert, welchen interaktionalen Gesetzmäßigkeiten Stegreiferzählungen unterliegen. Wiederholungsbefragungen fördern auch hochstabile Wiederholungserzählungen zu Tage, die die Frage nach der Stabilität und Wandelbarkeit von Selbsterzählungen aufwerfen. Als Bezugspunkte nutze ich dazu unterschiedliche methodologische Erwartungen aus der Forschungsliteratur. Der Biographieforschung Schütze‘scher Prägung liegt die Auffassung zugrunde, dass Erzählprozesse vorrangig durch emergente Selbstläufigkeit charakterisiert sind und erprobte Geschichten unerwünscht das Stegreifprinzip unterlaufen. Dagegen wird nach konversationsanalytischen Positionen der sozial-interaktive Herstellungskontext der Erzählung betont, der das Erzählen kokonstruktiv stark dominiere. Zuletzt zeigt sich in Arbeiten der Wiedererzählforschung, wie hochstabil Formulierungen und ganze Geschichten unabhängig von Erzählemergenzen und Erzählsituationen sein können. Anhand von sechs Schlüsselfällen zeige ich die Breite der Phänomene des autobiographischen Wiedererzählens und argumentiere, dass diese drei Paradigmen (Erzählemergenz, interaktive Hervorbringung und Vorgeformtheit) ineinander verschränkt werden können und müssen, um den empirischen Befunden gerecht zu werden. Dazu schlage ich mit Adressierungszwang einen vierten Zugzwang des Erzählens (Kallmeyer/Schütze 1977) vor. Gleichzeitig erkläre ich mit dem Konzept des „passing strangers“ (Rubin 1974), wieso ein solcher Zugzwang im narrativen Interview in aller Regel stark reduziert ist. Insgesamt weise ich darauf hin, wie die eigene Selbsterzählung im Stegreif im Spannungsverhältnis sowohl zwischen Adressierungszwang und „passing stranger“-Effekt als auch zwischen dynamischer Emergenz und stabilisierender Vorgeformtheit je neu und wieder entsteht.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Das (vermeintliche) Scheitern von narrativen Interviews. Zum Erkenntnispotenzial von Interviewdynamiken (Miriam Schäfer)
In diesem Beitrag plädiere ich aus einer biographietheoretischen Perspektive dafür, Interviewdynamiken als empirisches Phänomen eines konkreten Forschungsfeldes zu betrachten. Empirische Basis bilden meine biographieanalytische und ethnographische Forschung zu biographischen Verläufen und Handlungsstrukturen im Feld der Polizei sowie ein Forschungsprojekt, in dem die intergenerationalen Handlungs- und Erinnerungsstrukturen in Familien stigmatisierter NS-Opfer in Österreich und Deutschland in einer biographietheoretischen Mehrgenerationenstudie untersucht werden; in diesem Artikel fokussiere ich auf Interviews, die in diesem Rahmen mit Mitgliedern der Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen geführt wurden. Anhand der Beispiele wird gezeigt, dass (vermeintlich) problematische Interviewdynamiken in einem Forschungsfeld für den Erkenntnisgewinn genutzt werden können und, dass es sich bei der Art wie narrative Interviews verlaufen nicht (nur) um individuelle Verläufe handelt, sondern (auch) um gruppen- bzw. feldspezifische Forschungsergebnisse. Ob und inwiefern narrative Interviews „gelingen“ oder „scheitern“, kann mit der Strukturierung des Forschungsfeldes erklärt werden und steht in Wechselwirkung mit dem Forschungsdesign.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Was verraten nicht-narrative Darstellungen in biographischen Interviews? Zur moralischen Rechtfertigungs- und Entlastungsrhetorik in verbalen Selbstauskünften (Uwe Krähnke)
Das Augenmerk des vorliegenden Beitrages liegt auf den nicht-narrativen Darstellungsformaten in qualitativen Interviews, den Beschreibungen von Routineabläufen bzw. allgemeinen Sachverhalten sowie den mit Stilmitteln der Argumentation vorgetragenen Einschätzungen und Bewertungen. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass Personen, denen der Makel devianter oder gesellschaftlich nicht geduldeter Verhaltensweisen anhaftet, in narrativ-biographischen Interviews zu beschreiben und komplex zu argumentieren anfangen, ohne dass sie dazu von den Interviewenden explizit aufgefordert werden. Zudem zeigt sich, dass sich die Interviewten in ihre nicht-narrativen Äußerungen „verstricken“. Entsprechende Interviewsequenzen entfalten eine Eigendynamik, die sich ihrer Kontrolle weitestgehend entzieht. Gezeigt wird, dass solche in den Selbstauskünften verwendeten Textsorten der Beschreibung und Argumentation eine performative Funktion haben. Die nicht-narrativen Äußerungen ermöglichen den Interviewten, die „eigene Geschichte“ zu verbalisieren, ohne in kognitive Dissonanzen zu geraten und sich moralisch schuldig zu fühlen. Die bei dieser performativen Selbstpositionierung genutzten Entlastungs- und Rechtfertigungsrhetoriken werden anhand von geführten Interviews mit Angehörigen einer in der Bundesrepublik diskreditierten und stigmatisierten Personengruppe aufgezeigt – den hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des DDR-Geheimdienstes. Plädiert wird in dem Beitrag dafür, Beschreibungen und Argumentationen in qualitativen Interviews parallel zu den narrativen Interviewpassagen methodisch kontrolliert zu dechiffrieren und theoretisch-analytisch zu durchdringen. Solche nicht-narrativen Interviewpassagen sind als authentische Selbstauskünfte und integrale Bestandteile einer kohärenten autobiographischen Lebensgeschichte der Interviewten zu bewerten. Grundlagentheoretisch mit Rekurs auf Bourdieu lässt sich behaupten: Im qualitativen Interview manifestiert sich der Habitus einer befragten Person.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Präsentation der biographischen Visitenkarte. Erzählstimulus und Selbsteinführung am Interviewbeginn (Michael Corsten und Laura Maleyka)
Das qualitative Interview wird zur Erhebung häufig verwendet, ist in der Methodenliteratur vielfach beschrieben, allerdings empirisch kaum geprüft. Wir fragen in diesem Artikel danach, wie sich der Interviewstimulus der Interviewperson auf die Selbsteinführung der befragten Person auswirkt. Dazu greifen wir auf ein Sample aus 114 biographischen Interviews zurück und werten dieses sowohl qualitativ als auch quantitativ aus. Wir fassen die soziale Situation des qualitativen Interviews mit Ehlich/Rehbein (1972) als „Hyperpragmem“ und gehen mit Schütze (1984) davon aus, dass sich Personen beim Übergang in den besonderen Aktivitätsrahmen des Interviews durch eine „biographische Präambel“ charakterisieren. Den Einfluss der Ausgestaltung des Stimulus auf die Präambel analysieren wir dabei in quantitativer Hinsicht. Darauf aufbauend untersuchen wir narrations- und positionierungsanalytisch, welchen Stellenwert die Präambel für das gesamte Interview hat.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Wie kommt es zu (k)einer Erzählung? Zum erzähl- und argumentationsgenerierenden Potenzial von Wie-kommen-Stimuli in qualitativen Interviews (Georgios Coussios und Judith Eckert)
Erzählungen stellen in verschiedenen Verfahren der qualitativen Interviewforschung die methodologisch primäre Textsorte dar. In der Methodenliteratur finden sich entsprechend zahlreiche Hinweise darauf, mit welchen Stimuli Erzählungen elizitiert werden können. Die systematische, empirische Untersuchung der tatsächlichen Fragewirkungen steht allerdings größtenteils noch aus. Im vorliegenden Aufsatz tragen wir dazu bei, diese Forschungslücke zu füllen. Dabei fokussieren wir auf verschiedene Varianten von vergangenheitsorientierten „wie kommen“-Konstruktionen, nachdem Formulierungen wie „wie kam es, dass …?“ oder „wie kam das?“ in Lehr- und Einführungswerken zu diversen Interviewformaten als Erzählstimulus empfohlen werden. Grundlage unserer empirischen Untersuchung sind 72 Wie-kommen-Stimuli, die wir im Zuge zweier sekundäranalytisch ausgerichteter Methodenforschungsprojekte zur qualitativen Interviewforschung in acht thematisch und methodisch unterschiedlich ausgerichteten Studien identifiziert haben. Unsere Analyse zeigt, dass Wie-kommen-Formulierungen von den Interviewten üblicherweise nicht als reiner Erzählstimulus behandelt werden. Vielmehr folgen auf solche Stimuli auch und in den meisten Fällen sogar dominant argumentative Sachverhaltsdarstellungen. Im vorliegenden Beitrag weisen wir diese unerwartet polyseme, d.h. mehrdeutige Interpretation von Wie-kommen-Stimuli detailliert nach, zeigen, wie Interviewende dieser Polysemie entgegenwirken können und bieten eine Erklärung an, warum es bei Wie-kommen-Konstruktionen oft zu keiner Erzählung kommt.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Zum (Weiter-)Erzählen und Ausarbeiten animieren. Fremdwiederholungen als Praxis der zurückhaltenden Gesprächssteuerung (Christine Paul)
Interviewer:innen sollen ihre Gesprächspartern:innen zum Reden und Erzählen anregen, sich dabei aber möglichst zurückhaltend verhalten, um die Interviewten nicht zu beeinflussen. Fremdwiederholungen sind eine Möglichkeit, einen Gesprächsimpuls zu geben und nah an den Themen und Formulierungen der Interviewten zu bleiben. Während in der Forschung Fremdwiederholungen als Rezeptionssignale, Fremdreparaturen und in der Familientherapie als Mittel der Gesprächssteuerung analysiert werden, zeigen die Daten des Berliner Wendekorpus, dass Interviewer:innen mit Fremdwiederholungen Erzählungen unterstützen können, da sie mit ihnen Bezugselemente als relevant markieren, sodass Erzählwürdigkeit hergestellt wird und Interviewte Redebeiträge und Erzählungen ausarbeiten.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)


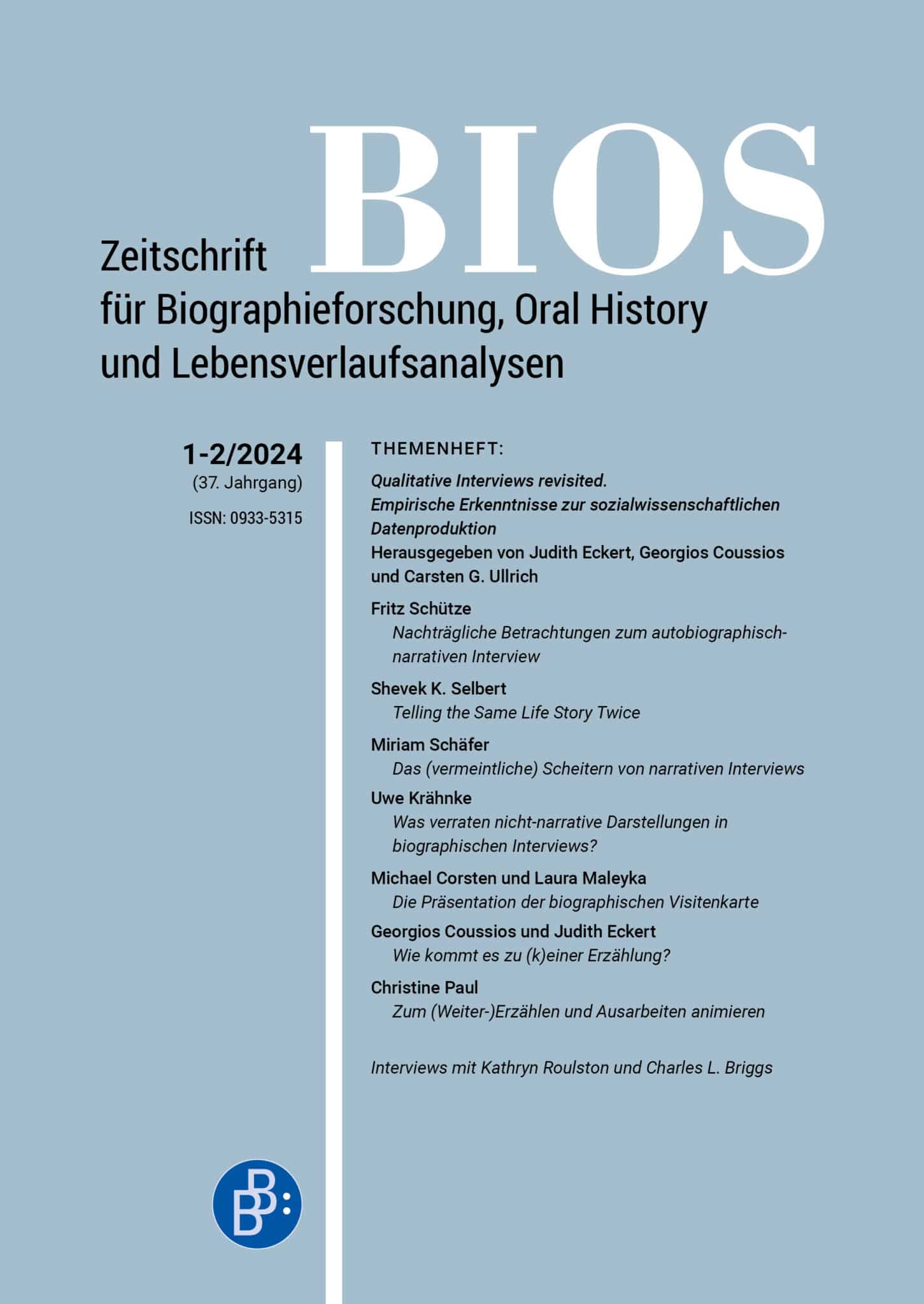

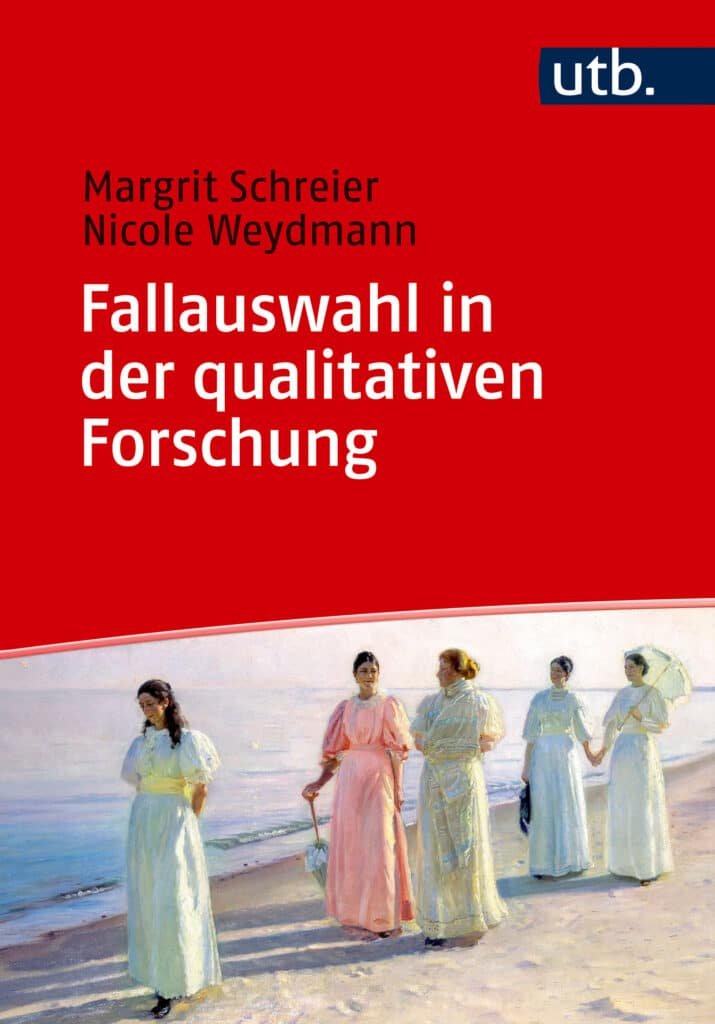
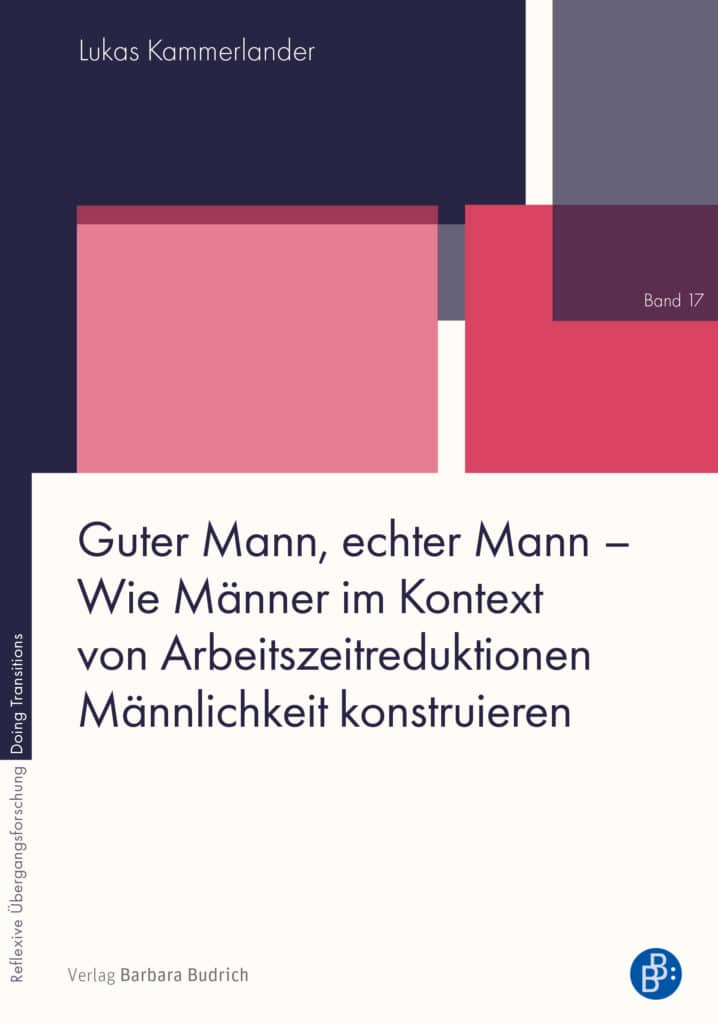
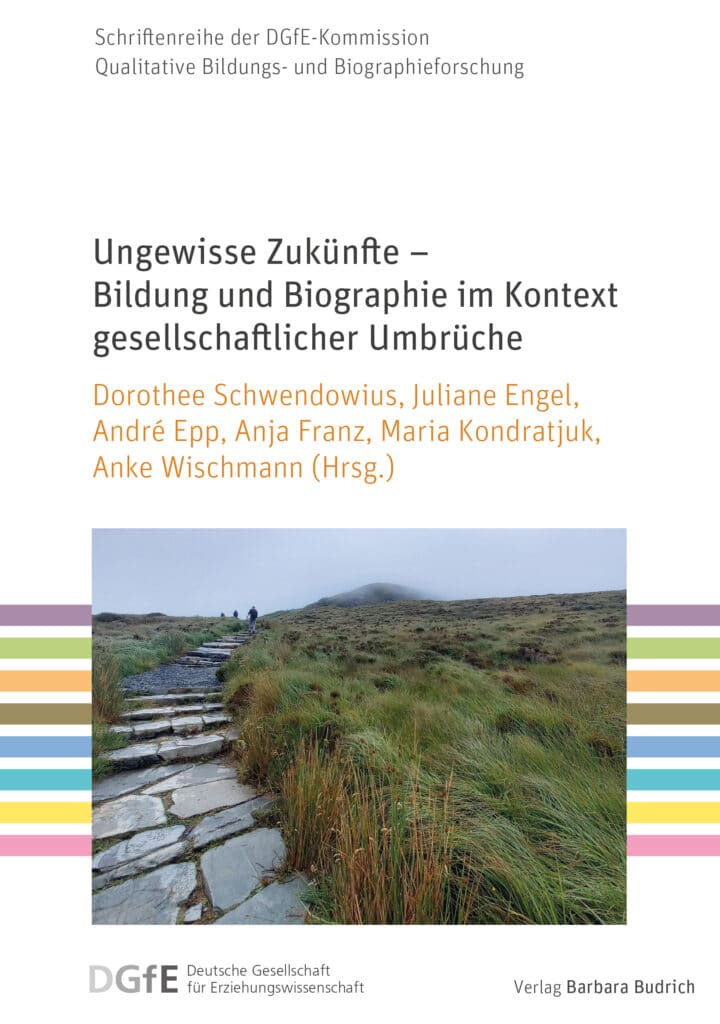
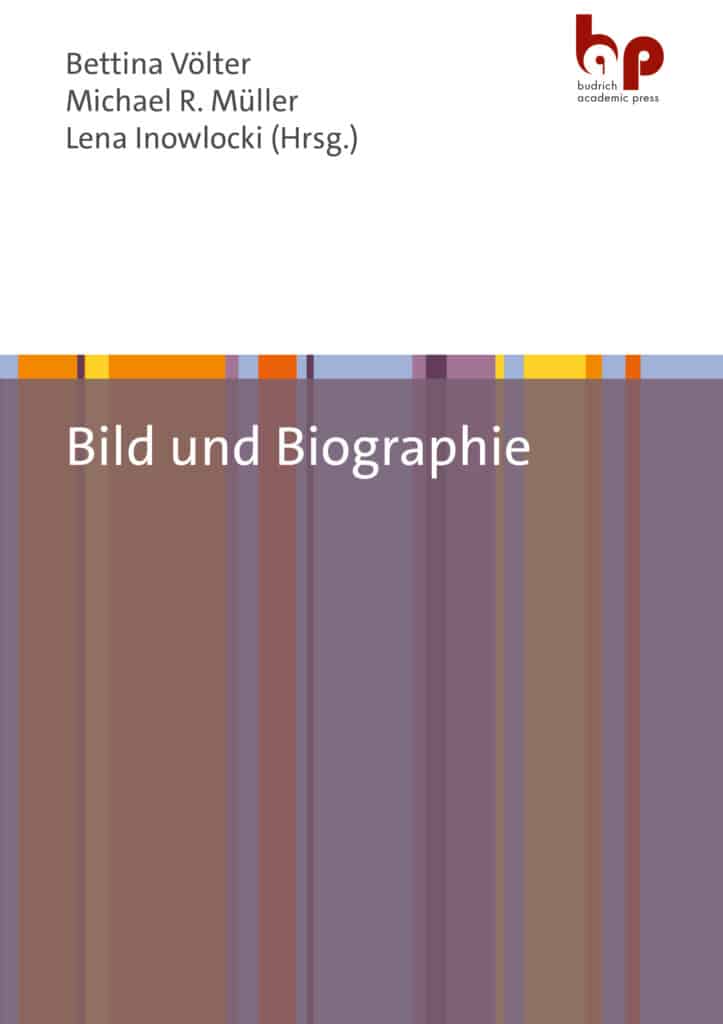

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.