Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » dms 2-2020 | Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht
dms 2-2020 | Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht
Erscheinungsdatum : 23.11.2020
0,00 € - 75,00 €
Inhalt
dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management
2-2020: Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht
hrsg. von Katharina van Elten, Tanja Klenk & Britta Rehder
Themenschwerpunkt
Katharina van Elten / Tanja Klenk / Britta Rehder: Einleitung: Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht
Annette Elisabeth Töller: Das Verbandsklagerecht der Umweltverbände in Deutschland: Effekte auf Rechtsanwendung, Umweltqualität und Machtverhältnisse
Roland Czada: Governance-Transformation durch Richterrecht? Juristische Diskurse zur Selbstverwaltung im Gesundheitswesen
Sandra Eckert: Wirtschaftliche Akteure im Recht? Die strategische Nutzung von Selbstregulierung und Prozessführung durch Europäische Wirtschaftsverbände
Daniel Rasch: Lobbying-Regulierung in den deutschen Bundesländern – ein Vergleich
Jan Fährmann / Hartmut Aden / Alexander Bosch: Polizeigewerkschaften und innenpolitische Gesetzgebung – politische Einflussnahme zwischen Symbolpolitik und Interessenvertretung
Britta Rehder / Katharina van Elten: Klagende Verbände. Drei Logiken des justiziellen kollektiven Handelns in Deutschland
Abhandlungen
Simon Fink: Behördenleiter im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit
Michael W. Bauer / Stefan Becker: Populistische Verwaltungspolitik. Eine verwaltungswissenschaftliche Perspektive auf populistische Strategien der Staatstransformation
Lucas von Blumröder / Andreas Breiter: Die Nutzung maschineller Lernsysteme für den Erlass verwaltungsrechtlicher Ermessensentscheidungen
Benjamin Friedländer: Kommunale Gesamtsteuerung öffentlicher Aufgaben: Konzeptionelle Idee und Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung
Sonja Blum / Jens Jungblut: Besondere Freiheit, besondere Verantwortung? Eine empirische Studie zur deutschen Politikwissenschaft in der Politikberatung
Rezensionen
Edward C. Page: Peter Hupe (Ed.) (2019). Research Handbook on Street-Level Bureaucracy. The Ground Floor of Government in Context. Edward Elgar. ISBN: 978 1 78643 762 4, pp. 544 xx.
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): dms.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den dms-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1865-7192 |
| eISSN | 2196-1395 |
| Jahrgang | 13. Jahrgang 2020 |
| Ausgabe | 2-2020 |
| Erscheinungsdatum | 23.11.2020 |
| Umfang | 254 |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Autor*innen
SchlagwörterBeratungsrollen, Bundesländer, Bundesoberbehörden, Bundesrepublik Deutschland, Bürokratie, demokratische Regression, Digitalisierung, Europäische Union, Expertise, Gesundheitskorporatismus, governance, Interdisziplinarität, Interessengruppen, Interessenvermittlung, internationale politische Ökonomie, Kennzeichnung von Polizeibediensteten, Klage, Klagerecht, Koordination, Kriminalpolitik, Künstliche Intelligenz, Legitimationstheorie, Literaturreview, lobbying, Luftreinhaltung, machine learning, Macht, Medien, Organisation öffentlicher Aufgaben, Personalisierung, Politik innerer Sicherheit, Politikberatung, Politikwissenschaft, Polizeigewerkschaften, Populismus, Recht, Rechtsberatung, Rechtsmobilisierung, Regulierung, repeat player, Richterrecht, Selbstverwaltung, Steuerung, Strafrecht, Subsidiarität, Survey, Umweltqualität, Umweltverbaende, Verbände, Verwaltungsmodernisierung, Verwaltungsrecht, Wirtschaftsverbände, öffentliche Verwaltung
Abstracts
Einleitung: Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht (Katharina van Elten, Tanja Klenk, Britta Rehder)
Wie nutzen Interessengruppen das Recht, um Interessen zu realisieren? Wie werden umkehrt ihre Aktivitäten in den verschiedenen Phasen des Policy Cycles durch Recht strukturiert? Und welche Verbände vertreten innerhalb des Rechtssystems welche Interessen? Für eine politik- und verwaltungswissenschaftlich orientierte Interessengruppenforschung sind diese Fragen zentral, hat sich doch aufgrund der zunehmenden Verrechtlichung aller Lebensbereiche in modernen Demokratien Recht zu einer zentralen Ressource für Interessengruppen entwickelt. Der Beitrag zeichnet die Konturen des Forschungsfelds Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht nach und setzt sich auf der Basis eines systematischen Literaturreviews kritisch mit dem aktuellen Stand und den Perspektiven der deutschsprachigen Forschung in diesem Feld auseinander. Es wird gezeigt, dass zwar die These vom Recht als zentraler Ressource für Interessengruppen uneingeschränkt geteilt wird, ein tiefergehendes Verständnis des Zusammenspiels von Recht, Politik und Interessen dennoch ein Forschungsdesiderat bleibt. Schlagworte: Rechtsberatung, Rechtsmobilisierung, Interessenvermittlung, Literaturreview
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Das Verbandsklagerecht der Umweltverbände in Deutschland: Effekte auf Rechtsanwendung, Umweltqualität und Machtverhältnisse (Annette Elisabeth Töller)
In der deutschen Umweltpolitik hat sich die Machtkonstellation von Wirtschafts- und Umweltinteressen in den letzten 20-25 Jahren grundsätzlich zu Gunsten der Umweltverbände gewandelt. Vor diesem Hintergrund befasst sich der Beitrag mit dem 2006 eingeführten und seit 2013 verstärkt genutzten Klagerecht für anerkannte Umweltverbände. Er geht – insbesondere anhand der 47 Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Luftreinhaltepläne – den Fragen nach, ob und wie dieses Klagerecht genutzt wird, welche Effekte seine Nutzung auf die Anwendung des Umweltrechts und die Umweltqualität hat und ob sich Auswirkungen dieser Nutzung auf die Machtverhältnisse in der Umweltpolitik zeigen lassen. Schlagworte: Umweltverbände, Klagerecht, Luftreinhaltung, Umweltqualität, Macht
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Governance-Transformation durch Richterrecht? Juristische Diskurse zur Selbstverwaltung im Gesundheitswesen (Roland Czada)
Wesentliche Teile des Sozialversicherungsrechts wurden in Deutschland durch juristische Fachdiskurse und Gerichtsurteile bestimmt. Deren Folgen und Fernwirkungen blieben in der Regel unberücksichtigt. Dies betrifft neuerdings verstärkt die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Von deren Spitzengremium „Gemeinsamer Bundesausschuss“ festgelegte medizinische Behandlungsnormen werten Juristen als Eingriff in das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 II 1 GG), der dem von Verbandsvertretern bestellten Gremium nicht zustehe. Die der „Legitimationskettentheorie“ des Bundesverfassungsgerichtes folgende Wertung offenbart ein monistisches, von überkommenen Souveränitätslehren geprägtes Staatsverständnis, von dem sich die meisten westlichen Demokratien gelöst haben. Die daran anknüpfende Rechtsprechung tangiert das ordnungspolitische Gefüge von Staat, Mark und Organisationsgesellschaft. Der Beitrag erörtert einschlägige Gerichtsurteile und diskutiert kritische Einwände sowie demokratietheoretische Alternativkonzepte. Schlagworte: Richterrecht, Selbstverwaltung, Gesundheitskorporatismus, Subsidiarität, Legitimationstheorie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Wirtschaftliche Akteure im Recht? Die strategische Nutzung von Selbstregulierung und Prozessführung durch Europäische Wirtschaftsverbände (Sandra Eckert)
Dieser Beitrag widmet sich der Frage, wie Wirtschaftsakteure den Zyklus der Rechtsetzung auf europäischer Ebene zu beeinflussen suchen. Untersucht wird insbesondere, warum europäische Wirtschaftsverbände in drei Sektoren (Kunststoffindustrie, Haushaltsgerätehersteller, Elektronikbranche) Selbstregulierung und Prozessführung in unterschiedlicher Weise nutzen. Konzeptuell schlägt die vergleichende Fallstudie eine Brücke zur Governanceforschung sowie der Literatur zur Internationalen Politischen Ökonomie (IPÖ). So ergänzt die Perspektive auf sowohl konflikthafte wie auch kooperative Strukturen die Diskussion um den sogenannten Schatten der Hierarchie in der Governanceforschung. Mit Bezug auf die in der IPÖ etablierten Kategorien zur Analyse wirtschaftlicher Macht weist der Befund darauf hin, dass der Blick auf instrumentelle Macht, also die direkte Einflussnahme auf Gesetzgebung, zwingend ergänzt werden muss um eine systematische Erfassung struktureller Macht. Diesbezüglich zeigt die Untersuchung, dass Wirtschaftsverbände gerade außerhalb der legislativen Arena vielfältige regulative Strategien mobilisieren, die darauf abzielen, Regelsetzung mitzugestalten, zu substituieren, zu verhindern, zu blockieren oder rückgängig zu machen. Schlagworte: Europäische Union, Governance, Internationale Politische Ökonomie, Recht, Wirtschaftsverbände
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Lobbying-Regulierung in den deutschen Bundesländern – ein Vergleich (Daniel Rasch)
Der Beitrag zeigt, dass die Regulierung von Interessenvertretung und Lobbying, als spezielle Form, im Allgemeinen in den Bundesländern zwar existiert, jedoch in Teilen erheblich variiert. Erstens erfassen nicht alle Regulierungen sowohl die Legislative als auch die Exekutive, das heißt, vor allem bei der Regulierung von Interessenvertretung gegenüber den Ministerien besteht Nachholbedarf. Zweitens sind die Entscheidungsträger*innen per se zu selten Gegenstand der Regulierung, insbesondere was die Karenzzeiten, also den Wechsel zwischen den Berufen, angeht. Wenn Interessenvertretung reguliert wird, finden sich drittens noch relativ viele Verweise auf Akteurstypen wie Verbände, Gewerkschaften, kommunale Spitzenverbände oder Berufsverbände. Inhouse-Lobbying, also die Interessenvertretung von Firmen und neuere Formen des Lobbyings, beispielsweise durch Agenturen oder Think Tanks, sind hier kaum von den Regulierungen erfasst. Viertens zeigt ein kurzer Blick in die Transparenz- und Informationsportale, dass in den seltensten Fällen Informationen über die konsultierten Akteure und deren Positionen zu erkennen sind und es somit an Transparenz über die Entscheidungsfindung mangelt. Schlagworte: Lobbying; Bundesländer; Regulierung
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Polizeigewerkschaften und innenpolitische Gesetzgebung – politische Einflussnahme zwischen Symbolpolitik und Interessenvertretung (Jan Fährmann, Hartmut Aden, Alexander Bosch)
Vertreter*innen der drei bundesdeutschen Polizeigewerkschaften kommentieren in der Medienöffentlichkeit nicht nur sie betreffende politische Entscheidungen, sondern positionieren sich auch in allgemeineren innenpolitischen Gesetzgebungsfragen. Dieser Beitrag geht auf der Basis ausgewählter Beispiele der Frage nach, inwieweit es den Polizeigewerkschaften dabei gelingt, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Dabei wird zwischen der Durchsetzung eigener Positionen und der Verhinderung missliebiger Gesetzgebungsvorhaben unterschieden. Der Beitrag zeigt, dass die Polizeigewerkschaften in innenpolitischen Debatten eine aktive Rolle spielen und auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden. Dabei wird die These entwickelt, dass die Gewerkschaften in einigen Konstellationen symbolpolitisch agieren. Schlüsselwörter: Polizeigewerkschaften, Strafrecht, Kriminalpolitik, Politik innerer Sicherheit, Kennzeichnung von Polizeibediensteten
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Klagende Verbände. Drei Logiken des justiziellen kollektiven Handelns in Deutschland (Britta Rehder, Katharina van Elten)
Der Aufsatz untersucht, in welchem Umfang sich 100 deutsche Großverbände auf ihren Homepages dazu bekennen, Interessenvermittlung über das Rechtssystem zu praktizieren. Im Zentrum stehen die Politikfelder Wirtschaft, Soziales, Umwelt und Integration. Politikfeldübergreifend lässt sich festhalten, dass die Verbände justizielle Praktiken nur sehr defensiv zu ihrem organisationalen Markenkern zählen. In Anlehnung an die Literatur kann davon gesprochen werden, dass es viele „oneshotter“ gibt und nur sehr wenige „repeat player“, wobei die Unterschiede innerhalb der Politikfelder größer sind als diejenigen zwischen den Politikfeldern. Es werden drei Logiken des justiziellen kollektiven Handelns unterschieden, die in einem Zusammenhang zur politischen Konfliktfähigkeit der Verbände diskutiert werden können und müssen. Schlagworte: Verbände, Klage, Rechtsmobilisierung, Repeat Player, Deutschland
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Behördenleiter im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit (Simon Fink)
Wie ist das Verhältnis zwischen Spitzenbeamten und den Medien? Lange Jahre galt die Vermutung, dass deutsche Verwaltungseliten nur wenig in den Medien präsent sind; Repräsentation nach außen war Sache der politischen Spitze. Dieser Beitrag argumentiert, dass im Zuge der Politisierung der Verwaltung auch deutsche Spitzenbeamte häufiger in den Medien auftauchen. Anhand einer Analyse der Berichterstattung über sieben Bundesoberbehörden in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigt der Beitrag, dass über die Zeit hinweg tatsächlich immer personalisierter berichtet wird. Dabei gibt es aber große Unterschiede zwischen den Behörden. Die Präsidenten des Kraftfahrt-Bundesamtes und des Bundeskriminalamtes erscheinen eher selten in den Medien, die der Bundesnetzagentur und des Verfassungsschutzes relativ häufig. Außerdem bleibt noch ein Rest an zu erklärender Variation, der möglicherweise auf Karriereverläufe der Spitzenbeamten zurückgeführt werden kann. Schlagworte: Medien, Personalisierung, Bundesoberbehörden
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Populistische Verwaltungspolitik. Eine verwaltungswissenschaftliche Perspektive auf populistische Strategien der Staatstransformation (Michael W. Bauer, Stefan Becker)
Mit Blick auf die Bürokratie als zentrales Instrument staatlicher Herrschaftsausübung entwickelt dieser Beitrag einen Analyserahmen, der populistische Verwaltungspolitik als Transformation der öffentlichen Verwaltung erfassbar macht. Die analytische Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes sowie dessen empirische Relevanz werden an vier Beispielen populistischer Verwaltungspolitik illustriert: Viktor Orbán in Ungarn, Alberto Fujimori in Peru, Christoph Blocher in der Schweiz und Donald Trump in den USA. Der Beitrag verdeutlicht, welche Gefahren für liberaldemokratische Systeme von populistischen Regierungen ausgehen. Denn der Grad der Verwirklichung populistischer Verwaltungspolitik bestimmt letztendlich die Durchsetzungschancen einer auf radikale Veränderung abzielenden politischen Ideologie. Schlagworte: Populismus, Bürokratie, öffentliche Verwaltung, demokratische Regression
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die Nutzung maschineller Lernsysteme für den Erlass verwaltungsrechtlicher Ermessensentscheidungen (Lucas von Blumröder, Andreas Breiter)
Der vorliegende Artikel greift die aktuelle Thematik der „Künstlichen Intelligenz“ in der öffentlichen Verwaltung auf und geht der Frage nach, ob maschinelle Lernsysteme (ML-Systeme) genutzt werden können, um beim Erlass verwaltungsrechtlicher Ermessensentscheidungen zu unterstützen. Ausgehend von einer synergetischen Betrachtung beider Gebiete sowie der theoretischen Herleitung der grundsätzlichen Modellierbarkeit von Ermessensentscheidungen durch ML-Systeme schließt sich die Frage an, in welcher Form eine Unterstützung vorliegend möglich ist. Im Anschluss wird eine Modellierung anhand zweier sozialrechtlicher Ermessensentscheidungen konstruiert und in einem Wizard-of-Oz-ähnlichen Praxisversuch geprüft, wie derartige Ausgaben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung wahrgenommen werden und deren Entscheidungsprozess beeinflussen können. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass eine theoretische Modellierung entsprechender Ermessensentscheidungen in der Praxis mit einer Vielzahl an Herausforderungen verbunden ist. Kann diesen jedoch begegnet werden, können die Anwenderinnen und Anwender von einem intelligenten System profitieren. Schlagworte: Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Verwaltungsrecht
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Kommunale Gesamtsteuerung öffentlicher Aufgaben: Konzeptionelle Idee und Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung (Benjamin Friedländer)
Mit Blick auf die institutionelle Ausdifferenzierung der öffentlichen Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene stellt sich in Kommunalwissenschaft und -praxis die Frage nach den derzeitigen Steuerungs- und Koordinationsstrukturen sowie deren Weiterentwicklung und Neubestimmung. Mit diesem Beitrag ist das Ziel verbunden, die interdisziplinäre Idee einer kommunalen Gesamtsteuerung öffentlicher Aufgaben zu erörtern sowie auf Grundlage einer qualitativen empirischen Untersuchung Bedarf, Verständnis, Umsetzung und Grenzen eines solchen Ansatzes zu analysieren und zu diskutieren. Schlagworte: Interdisziplinarität, Organisation öffentlicher Aufgaben, Steuerung, Koordination, Komplexität
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Besondere Freiheit, besondere Verantwortung? Eine empirische Studie zur deutschen Politikwissenschaft in der Politikberatung (Sonja Blum, Jens Jungblut)
In den letzten Jahren wurde in der deutschen Politikwissenschaft (und darüber hinaus) eine intensive Debatte über die gesellschaftliche und politische Relevanz der Disziplin geführt. Dabei blieb allerdings die faktische politikberatende Rolle mindestens genauso umstritten wie die normative Seite dieser Tätigkeit; und auch innerhalb der vergleichenden Forschung zu Politikberatung wurde der Politikwissenschaft keine gezielte Aufmerksamkeit geschenkt. Dieser Artikel untersucht, wie, für wen und wie häufig Politikwissenschaftler*innen in Deutschland ihre Expertise für die Politik bereitstellen. Die Analyse basiert auf den deutschen Ergebnissen (n=376) einer Umfrage, die 2018 in mehr als 30 europäischen Ländern durchgeführt wurde. Neben ersten empirischen Einblicken in ein bislang wenig untersuchtes Phänomen ist es Ziel des Beitrags, deutsche Politikwissenschaftler*innen in einer Typologie von Beratungsrollen zu verorten. Die Analyse zeigt durchaus umfangreiche und diverse, im Ländervergleich allerdings unterdurchschnittliche politikberatende Tätigkeiten. Der zentrale Unterschied für Art und Ausmaß der Politikberatung scheint zwischen Politikwissenschaftler*innen auf befristeten und unbefristeten Stellen zu bestehen. Schlagworte: Politikwissenschaft, Politikberatung, Expertise, Survey, Beratungsrollen
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management
2-2020: Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht
hrsg. von Katharina van Elten, Tanja Klenk & Britta Rehder
Themenschwerpunkt
Katharina van Elten / Tanja Klenk / Britta Rehder: Einleitung: Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht
Annette Elisabeth Töller: Das Verbandsklagerecht der Umweltverbände in Deutschland: Effekte auf Rechtsanwendung, Umweltqualität und Machtverhältnisse
Roland Czada: Governance-Transformation durch Richterrecht? Juristische Diskurse zur Selbstverwaltung im Gesundheitswesen
Sandra Eckert: Wirtschaftliche Akteure im Recht? Die strategische Nutzung von Selbstregulierung und Prozessführung durch Europäische Wirtschaftsverbände
Daniel Rasch: Lobbying-Regulierung in den deutschen Bundesländern – ein Vergleich
Jan Fährmann / Hartmut Aden / Alexander Bosch: Polizeigewerkschaften und innenpolitische Gesetzgebung – politische Einflussnahme zwischen Symbolpolitik und Interessenvertretung
Britta Rehder / Katharina van Elten: Klagende Verbände. Drei Logiken des justiziellen kollektiven Handelns in Deutschland
Abhandlungen
Simon Fink: Behördenleiter im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit
Michael W. Bauer / Stefan Becker: Populistische Verwaltungspolitik. Eine verwaltungswissenschaftliche Perspektive auf populistische Strategien der Staatstransformation
Lucas von Blumröder / Andreas Breiter: Die Nutzung maschineller Lernsysteme für den Erlass verwaltungsrechtlicher Ermessensentscheidungen
Benjamin Friedländer: Kommunale Gesamtsteuerung öffentlicher Aufgaben: Konzeptionelle Idee und Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung
Sonja Blum / Jens Jungblut: Besondere Freiheit, besondere Verantwortung? Eine empirische Studie zur deutschen Politikwissenschaft in der Politikberatung
Rezensionen
Edward C. Page: Peter Hupe (Ed.) (2019). Research Handbook on Street-Level Bureaucracy. The Ground Floor of Government in Context. Edward Elgar. ISBN: 978 1 78643 762 4, pp. 544 xx.
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): dms.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den dms-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1865-7192 |
| eISSN | 2196-1395 |
| Jahrgang | 13. Jahrgang 2020 |
| Ausgabe | 2-2020 |
| Erscheinungsdatum | 23.11.2020 |
| Umfang | 254 |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterBeratungsrollen, Bundesländer, Bundesoberbehörden, Bundesrepublik Deutschland, Bürokratie, demokratische Regression, Digitalisierung, Europäische Union, Expertise, Gesundheitskorporatismus, governance, Interdisziplinarität, Interessengruppen, Interessenvermittlung, internationale politische Ökonomie, Kennzeichnung von Polizeibediensteten, Klage, Klagerecht, Koordination, Kriminalpolitik, Künstliche Intelligenz, Legitimationstheorie, Literaturreview, lobbying, Luftreinhaltung, machine learning, Macht, Medien, Organisation öffentlicher Aufgaben, Personalisierung, Politik innerer Sicherheit, Politikberatung, Politikwissenschaft, Polizeigewerkschaften, Populismus, Recht, Rechtsberatung, Rechtsmobilisierung, Regulierung, repeat player, Richterrecht, Selbstverwaltung, Steuerung, Strafrecht, Subsidiarität, Survey, Umweltqualität, Umweltverbaende, Verbände, Verwaltungsmodernisierung, Verwaltungsrecht, Wirtschaftsverbände, öffentliche Verwaltung
Abstracts
Abstracts
Einleitung: Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht (Katharina van Elten, Tanja Klenk, Britta Rehder)
Wie nutzen Interessengruppen das Recht, um Interessen zu realisieren? Wie werden umkehrt ihre Aktivitäten in den verschiedenen Phasen des Policy Cycles durch Recht strukturiert? Und welche Verbände vertreten innerhalb des Rechtssystems welche Interessen? Für eine politik- und verwaltungswissenschaftlich orientierte Interessengruppenforschung sind diese Fragen zentral, hat sich doch aufgrund der zunehmenden Verrechtlichung aller Lebensbereiche in modernen Demokratien Recht zu einer zentralen Ressource für Interessengruppen entwickelt. Der Beitrag zeichnet die Konturen des Forschungsfelds Interessengruppen und Recht, Interessengruppen im Recht nach und setzt sich auf der Basis eines systematischen Literaturreviews kritisch mit dem aktuellen Stand und den Perspektiven der deutschsprachigen Forschung in diesem Feld auseinander. Es wird gezeigt, dass zwar die These vom Recht als zentraler Ressource für Interessengruppen uneingeschränkt geteilt wird, ein tiefergehendes Verständnis des Zusammenspiels von Recht, Politik und Interessen dennoch ein Forschungsdesiderat bleibt. Schlagworte: Rechtsberatung, Rechtsmobilisierung, Interessenvermittlung, Literaturreview
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Das Verbandsklagerecht der Umweltverbände in Deutschland: Effekte auf Rechtsanwendung, Umweltqualität und Machtverhältnisse (Annette Elisabeth Töller)
In der deutschen Umweltpolitik hat sich die Machtkonstellation von Wirtschafts- und Umweltinteressen in den letzten 20-25 Jahren grundsätzlich zu Gunsten der Umweltverbände gewandelt. Vor diesem Hintergrund befasst sich der Beitrag mit dem 2006 eingeführten und seit 2013 verstärkt genutzten Klagerecht für anerkannte Umweltverbände. Er geht – insbesondere anhand der 47 Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Luftreinhaltepläne – den Fragen nach, ob und wie dieses Klagerecht genutzt wird, welche Effekte seine Nutzung auf die Anwendung des Umweltrechts und die Umweltqualität hat und ob sich Auswirkungen dieser Nutzung auf die Machtverhältnisse in der Umweltpolitik zeigen lassen. Schlagworte: Umweltverbände, Klagerecht, Luftreinhaltung, Umweltqualität, Macht
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Governance-Transformation durch Richterrecht? Juristische Diskurse zur Selbstverwaltung im Gesundheitswesen (Roland Czada)
Wesentliche Teile des Sozialversicherungsrechts wurden in Deutschland durch juristische Fachdiskurse und Gerichtsurteile bestimmt. Deren Folgen und Fernwirkungen blieben in der Regel unberücksichtigt. Dies betrifft neuerdings verstärkt die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Von deren Spitzengremium „Gemeinsamer Bundesausschuss“ festgelegte medizinische Behandlungsnormen werten Juristen als Eingriff in das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 II 1 GG), der dem von Verbandsvertretern bestellten Gremium nicht zustehe. Die der „Legitimationskettentheorie“ des Bundesverfassungsgerichtes folgende Wertung offenbart ein monistisches, von überkommenen Souveränitätslehren geprägtes Staatsverständnis, von dem sich die meisten westlichen Demokratien gelöst haben. Die daran anknüpfende Rechtsprechung tangiert das ordnungspolitische Gefüge von Staat, Mark und Organisationsgesellschaft. Der Beitrag erörtert einschlägige Gerichtsurteile und diskutiert kritische Einwände sowie demokratietheoretische Alternativkonzepte. Schlagworte: Richterrecht, Selbstverwaltung, Gesundheitskorporatismus, Subsidiarität, Legitimationstheorie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Wirtschaftliche Akteure im Recht? Die strategische Nutzung von Selbstregulierung und Prozessführung durch Europäische Wirtschaftsverbände (Sandra Eckert)
Dieser Beitrag widmet sich der Frage, wie Wirtschaftsakteure den Zyklus der Rechtsetzung auf europäischer Ebene zu beeinflussen suchen. Untersucht wird insbesondere, warum europäische Wirtschaftsverbände in drei Sektoren (Kunststoffindustrie, Haushaltsgerätehersteller, Elektronikbranche) Selbstregulierung und Prozessführung in unterschiedlicher Weise nutzen. Konzeptuell schlägt die vergleichende Fallstudie eine Brücke zur Governanceforschung sowie der Literatur zur Internationalen Politischen Ökonomie (IPÖ). So ergänzt die Perspektive auf sowohl konflikthafte wie auch kooperative Strukturen die Diskussion um den sogenannten Schatten der Hierarchie in der Governanceforschung. Mit Bezug auf die in der IPÖ etablierten Kategorien zur Analyse wirtschaftlicher Macht weist der Befund darauf hin, dass der Blick auf instrumentelle Macht, also die direkte Einflussnahme auf Gesetzgebung, zwingend ergänzt werden muss um eine systematische Erfassung struktureller Macht. Diesbezüglich zeigt die Untersuchung, dass Wirtschaftsverbände gerade außerhalb der legislativen Arena vielfältige regulative Strategien mobilisieren, die darauf abzielen, Regelsetzung mitzugestalten, zu substituieren, zu verhindern, zu blockieren oder rückgängig zu machen. Schlagworte: Europäische Union, Governance, Internationale Politische Ökonomie, Recht, Wirtschaftsverbände
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Lobbying-Regulierung in den deutschen Bundesländern – ein Vergleich (Daniel Rasch)
Der Beitrag zeigt, dass die Regulierung von Interessenvertretung und Lobbying, als spezielle Form, im Allgemeinen in den Bundesländern zwar existiert, jedoch in Teilen erheblich variiert. Erstens erfassen nicht alle Regulierungen sowohl die Legislative als auch die Exekutive, das heißt, vor allem bei der Regulierung von Interessenvertretung gegenüber den Ministerien besteht Nachholbedarf. Zweitens sind die Entscheidungsträger*innen per se zu selten Gegenstand der Regulierung, insbesondere was die Karenzzeiten, also den Wechsel zwischen den Berufen, angeht. Wenn Interessenvertretung reguliert wird, finden sich drittens noch relativ viele Verweise auf Akteurstypen wie Verbände, Gewerkschaften, kommunale Spitzenverbände oder Berufsverbände. Inhouse-Lobbying, also die Interessenvertretung von Firmen und neuere Formen des Lobbyings, beispielsweise durch Agenturen oder Think Tanks, sind hier kaum von den Regulierungen erfasst. Viertens zeigt ein kurzer Blick in die Transparenz- und Informationsportale, dass in den seltensten Fällen Informationen über die konsultierten Akteure und deren Positionen zu erkennen sind und es somit an Transparenz über die Entscheidungsfindung mangelt. Schlagworte: Lobbying; Bundesländer; Regulierung
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Polizeigewerkschaften und innenpolitische Gesetzgebung – politische Einflussnahme zwischen Symbolpolitik und Interessenvertretung (Jan Fährmann, Hartmut Aden, Alexander Bosch)
Vertreter*innen der drei bundesdeutschen Polizeigewerkschaften kommentieren in der Medienöffentlichkeit nicht nur sie betreffende politische Entscheidungen, sondern positionieren sich auch in allgemeineren innenpolitischen Gesetzgebungsfragen. Dieser Beitrag geht auf der Basis ausgewählter Beispiele der Frage nach, inwieweit es den Polizeigewerkschaften dabei gelingt, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Dabei wird zwischen der Durchsetzung eigener Positionen und der Verhinderung missliebiger Gesetzgebungsvorhaben unterschieden. Der Beitrag zeigt, dass die Polizeigewerkschaften in innenpolitischen Debatten eine aktive Rolle spielen und auch in der Öffentlichkeit so wahrgenommen werden. Dabei wird die These entwickelt, dass die Gewerkschaften in einigen Konstellationen symbolpolitisch agieren. Schlüsselwörter: Polizeigewerkschaften, Strafrecht, Kriminalpolitik, Politik innerer Sicherheit, Kennzeichnung von Polizeibediensteten
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Klagende Verbände. Drei Logiken des justiziellen kollektiven Handelns in Deutschland (Britta Rehder, Katharina van Elten)
Der Aufsatz untersucht, in welchem Umfang sich 100 deutsche Großverbände auf ihren Homepages dazu bekennen, Interessenvermittlung über das Rechtssystem zu praktizieren. Im Zentrum stehen die Politikfelder Wirtschaft, Soziales, Umwelt und Integration. Politikfeldübergreifend lässt sich festhalten, dass die Verbände justizielle Praktiken nur sehr defensiv zu ihrem organisationalen Markenkern zählen. In Anlehnung an die Literatur kann davon gesprochen werden, dass es viele „oneshotter“ gibt und nur sehr wenige „repeat player“, wobei die Unterschiede innerhalb der Politikfelder größer sind als diejenigen zwischen den Politikfeldern. Es werden drei Logiken des justiziellen kollektiven Handelns unterschieden, die in einem Zusammenhang zur politischen Konfliktfähigkeit der Verbände diskutiert werden können und müssen. Schlagworte: Verbände, Klage, Rechtsmobilisierung, Repeat Player, Deutschland
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Behördenleiter im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit (Simon Fink)
Wie ist das Verhältnis zwischen Spitzenbeamten und den Medien? Lange Jahre galt die Vermutung, dass deutsche Verwaltungseliten nur wenig in den Medien präsent sind; Repräsentation nach außen war Sache der politischen Spitze. Dieser Beitrag argumentiert, dass im Zuge der Politisierung der Verwaltung auch deutsche Spitzenbeamte häufiger in den Medien auftauchen. Anhand einer Analyse der Berichterstattung über sieben Bundesoberbehörden in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigt der Beitrag, dass über die Zeit hinweg tatsächlich immer personalisierter berichtet wird. Dabei gibt es aber große Unterschiede zwischen den Behörden. Die Präsidenten des Kraftfahrt-Bundesamtes und des Bundeskriminalamtes erscheinen eher selten in den Medien, die der Bundesnetzagentur und des Verfassungsschutzes relativ häufig. Außerdem bleibt noch ein Rest an zu erklärender Variation, der möglicherweise auf Karriereverläufe der Spitzenbeamten zurückgeführt werden kann. Schlagworte: Medien, Personalisierung, Bundesoberbehörden
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Populistische Verwaltungspolitik. Eine verwaltungswissenschaftliche Perspektive auf populistische Strategien der Staatstransformation (Michael W. Bauer, Stefan Becker)
Mit Blick auf die Bürokratie als zentrales Instrument staatlicher Herrschaftsausübung entwickelt dieser Beitrag einen Analyserahmen, der populistische Verwaltungspolitik als Transformation der öffentlichen Verwaltung erfassbar macht. Die analytische Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes sowie dessen empirische Relevanz werden an vier Beispielen populistischer Verwaltungspolitik illustriert: Viktor Orbán in Ungarn, Alberto Fujimori in Peru, Christoph Blocher in der Schweiz und Donald Trump in den USA. Der Beitrag verdeutlicht, welche Gefahren für liberaldemokratische Systeme von populistischen Regierungen ausgehen. Denn der Grad der Verwirklichung populistischer Verwaltungspolitik bestimmt letztendlich die Durchsetzungschancen einer auf radikale Veränderung abzielenden politischen Ideologie. Schlagworte: Populismus, Bürokratie, öffentliche Verwaltung, demokratische Regression
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die Nutzung maschineller Lernsysteme für den Erlass verwaltungsrechtlicher Ermessensentscheidungen (Lucas von Blumröder, Andreas Breiter)
Der vorliegende Artikel greift die aktuelle Thematik der „Künstlichen Intelligenz“ in der öffentlichen Verwaltung auf und geht der Frage nach, ob maschinelle Lernsysteme (ML-Systeme) genutzt werden können, um beim Erlass verwaltungsrechtlicher Ermessensentscheidungen zu unterstützen. Ausgehend von einer synergetischen Betrachtung beider Gebiete sowie der theoretischen Herleitung der grundsätzlichen Modellierbarkeit von Ermessensentscheidungen durch ML-Systeme schließt sich die Frage an, in welcher Form eine Unterstützung vorliegend möglich ist. Im Anschluss wird eine Modellierung anhand zweier sozialrechtlicher Ermessensentscheidungen konstruiert und in einem Wizard-of-Oz-ähnlichen Praxisversuch geprüft, wie derartige Ausgaben von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung wahrgenommen werden und deren Entscheidungsprozess beeinflussen können. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass eine theoretische Modellierung entsprechender Ermessensentscheidungen in der Praxis mit einer Vielzahl an Herausforderungen verbunden ist. Kann diesen jedoch begegnet werden, können die Anwenderinnen und Anwender von einem intelligenten System profitieren. Schlagworte: Digitalisierung, Verwaltungsmodernisierung, Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Verwaltungsrecht
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Kommunale Gesamtsteuerung öffentlicher Aufgaben: Konzeptionelle Idee und Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung (Benjamin Friedländer)
Mit Blick auf die institutionelle Ausdifferenzierung der öffentlichen Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene stellt sich in Kommunalwissenschaft und -praxis die Frage nach den derzeitigen Steuerungs- und Koordinationsstrukturen sowie deren Weiterentwicklung und Neubestimmung. Mit diesem Beitrag ist das Ziel verbunden, die interdisziplinäre Idee einer kommunalen Gesamtsteuerung öffentlicher Aufgaben zu erörtern sowie auf Grundlage einer qualitativen empirischen Untersuchung Bedarf, Verständnis, Umsetzung und Grenzen eines solchen Ansatzes zu analysieren und zu diskutieren. Schlagworte: Interdisziplinarität, Organisation öffentlicher Aufgaben, Steuerung, Koordination, Komplexität
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Besondere Freiheit, besondere Verantwortung? Eine empirische Studie zur deutschen Politikwissenschaft in der Politikberatung (Sonja Blum, Jens Jungblut)
In den letzten Jahren wurde in der deutschen Politikwissenschaft (und darüber hinaus) eine intensive Debatte über die gesellschaftliche und politische Relevanz der Disziplin geführt. Dabei blieb allerdings die faktische politikberatende Rolle mindestens genauso umstritten wie die normative Seite dieser Tätigkeit; und auch innerhalb der vergleichenden Forschung zu Politikberatung wurde der Politikwissenschaft keine gezielte Aufmerksamkeit geschenkt. Dieser Artikel untersucht, wie, für wen und wie häufig Politikwissenschaftler*innen in Deutschland ihre Expertise für die Politik bereitstellen. Die Analyse basiert auf den deutschen Ergebnissen (n=376) einer Umfrage, die 2018 in mehr als 30 europäischen Ländern durchgeführt wurde. Neben ersten empirischen Einblicken in ein bislang wenig untersuchtes Phänomen ist es Ziel des Beitrags, deutsche Politikwissenschaftler*innen in einer Typologie von Beratungsrollen zu verorten. Die Analyse zeigt durchaus umfangreiche und diverse, im Ländervergleich allerdings unterdurchschnittliche politikberatende Tätigkeiten. Der zentrale Unterschied für Art und Ausmaß der Politikberatung scheint zwischen Politikwissenschaftler*innen auf befristeten und unbefristeten Stellen zu bestehen. Schlagworte: Politikwissenschaft, Politikberatung, Expertise, Survey, Beratungsrollen
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)




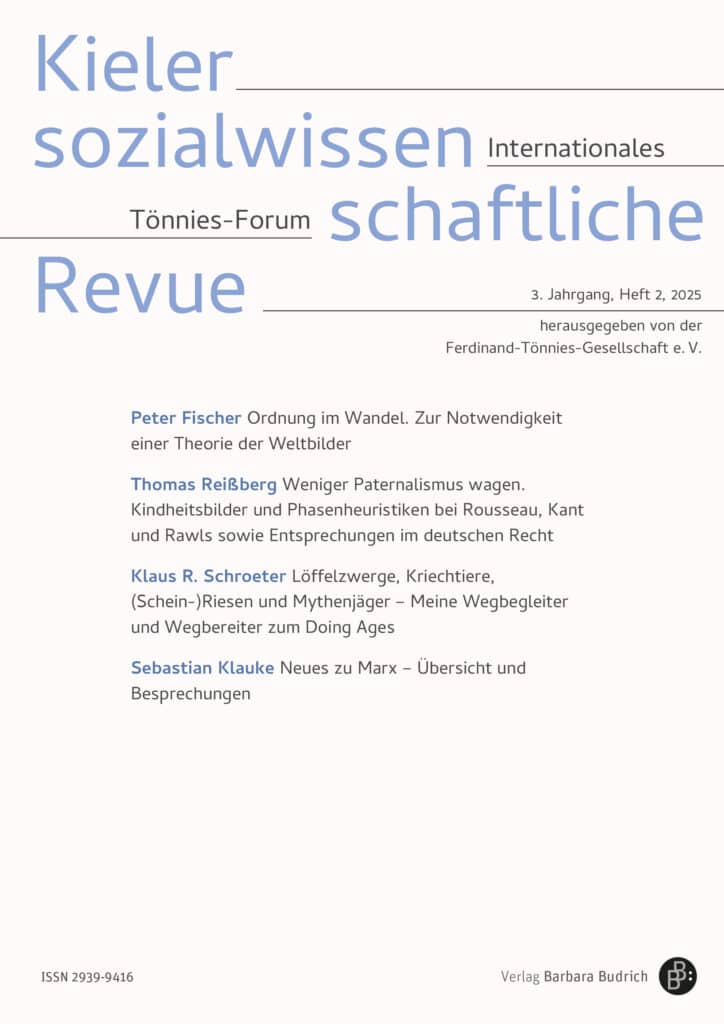
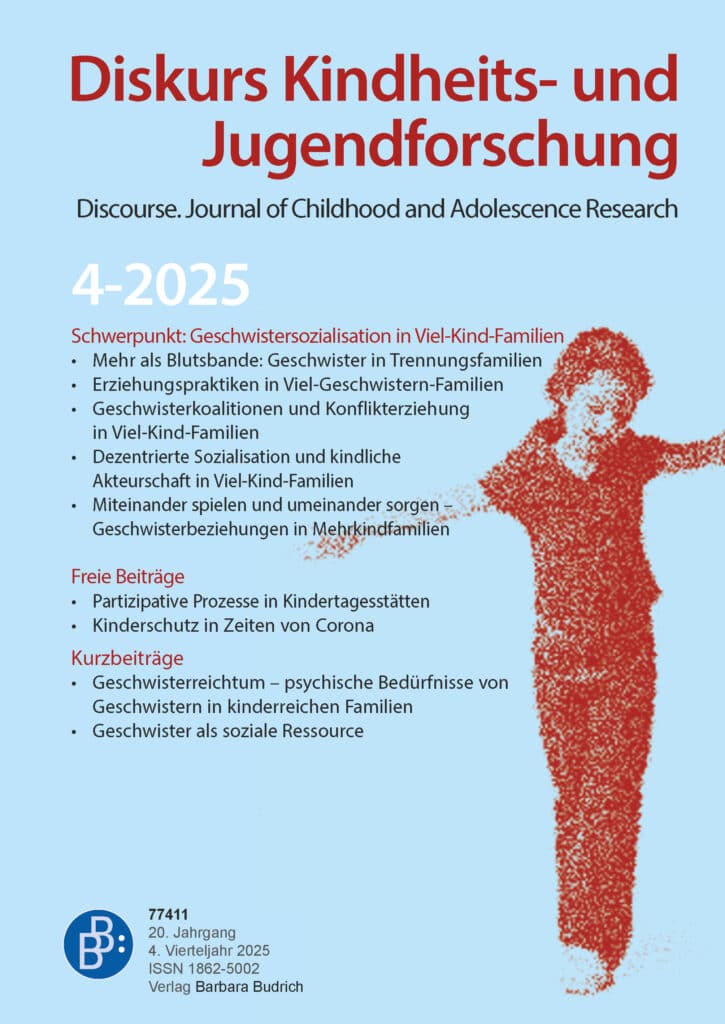
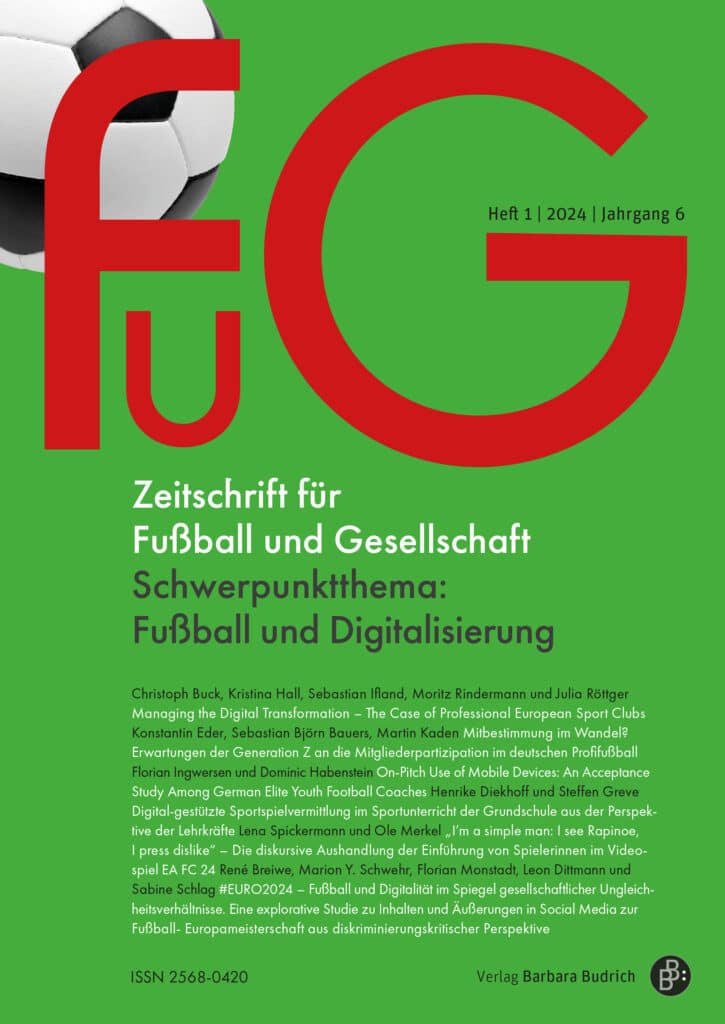



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.