Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » ZeM 1-2025 | Vorbereitungsklassen für neu zugewanderte Schüler:innen in europäischen Migrationsgesellschaften: Dimensionen der Verhandlung von schulischer Inklusion und Exklusion
ZeM 1-2025 | Vorbereitungsklassen für neu zugewanderte Schüler:innen in europäischen Migrationsgesellschaften: Dimensionen der Verhandlung von schulischer Inklusion und Exklusion
Erscheinungsdatum : 22.10.2025
29,90 €
- Inhalt
- Bibliografie
- Produktsicherheit
- Zusatzmaterial
- Bewertungen (0)
- Autor*innen
- Schlagwörter
- Abstracts
Inhalt
Zeitschrift für erziehungswissenschaftliche Migrationsforschung (ZeM)
1-2025: Vorbereitungsklassen für neu zugewanderte Schüler:innen in europäischen Migrationsgesellschaften: Dimensionen der Verhandlung von schulischer Inklusion und Exklusion
M Knappik / Julie A. Panagiotopoulou: Editorial: Vorbereitungsklassen für neu zugewanderte Schüler:innen in europäischen Migrationsgesellschaften: Dimensionen der Verhandlung von schulischer Inklusion und Exklusion
Gastbeitrag
Emmanuelle Le Pichon: Navigating the Complexities of the Education of Students with a Refugee Background: A Continuum of Adaptation
Beiträge im Themenschwerpunkt
Andrea Renee Leone-Pizzighella / Nadja Thoma: Transitional Educational Policies and Practices in Italy and Austria
Natascha Khakpour: Übersetzungen migrationsgesellschaftlicher Ordnungen in schulische Räume. Perspektiven und Positionierungen von Lehrer:innen
Julie A. Panagiotopoulou / Matthias Wagner: „[…] in den Fächern gab es eigentlich keine Fortschritte, ich glaube, es nennt sich ‚Vorbereitungsklasse‘“ – Erfahrungen neu zugewanderter Schüler:innen mit institutioneller Diskriminierung beim Übergang in das deutsche Bildungssystem
M Knappik / Julie A. Panagiotopoulou / Maren Gudat: „… ’ne richtig gute Schülerin [werden], wie ein deutsches Kind“: Deutsch(sprachig)-Sein als erwartete Fähigkeit von Grundschulkindern beim Übergang von der Vorbereitungsklasse in die Regelklasse in NRW
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zem.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZeM-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 2701-2476 |
| eISSN | 2701-2484 |
| Jahrgang | 4. Jahrgang 2025 |
| Ausgabe | 1-2025 |
| Erscheinungsdatum | 22.10.2025 |
| Umfang | 88 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Zusatzmaterial
Autor*innen
SchlagwörterBildungsentscheidungen, comparative education study, Deutscherwerb, ethnography, Familienmigration, Human Rights to Education, inclusion, inclusive education, institutionelle Diskriminierung, Lehrer*innenbildung, newly arrived students, Oktober 2025, Raum, reception classes versus mainstream classes, refugee education, segregative Beschulung, Sprachideologien, sprachliche Ordnungen, transitional policies, transitional practices, transnationale Bildungsbiographien, Vorbereitungsklassen, Übersetzungstheorie, ‚Seiteneinsteiger: innen‘ in Vorbereitungsklassen
Abstracts
Navigating the Complexities of the Education of Students with a Refugee Background: A Continuum of Adaptation (Emmanuelle Le Pichon)
Recent conflicts have contributed to a large influx of refugees to Europe and North America. These displacements, combined with global tensions, have led to restrictive migration policies. Despite these challenges, several countries pledged in 2016 to integrate students of refugee background into national education systems, guaranteeing them access to quality education soon after arrival. This article examines refugee education in Western countries in terms of availability, accessibility, acceptability and adaptability, focusing on Canada, in particular Ontario, and comparing it with practices in some European countries. The study highlights the significant variability of refugee education within countries and questions the legitimacy of reception classes in relation to mainstream classes. The article highlights the need for nuanced approaches that take into account individual migration trajectories, diverse educational needs, and systemic challenges inherent to each educational system. It advocates for a shift from deficit-based to strength-based pedagogical practices, while emphasizing the importance of adaptability in education, supported by strong leadership within school teams. The Canadian example illustrates both the potential for inclusion and the societal challenges. Keywords: Refugee Education, Human Rights to Education, Inclusive Education, Reception Classes versus Mainstream Classes
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Transitional Educational Policies and Practices in Italy and Austria (Andrea Renee Leone-Pizzighella, Nadja Thoma)
This article explores the transitional policies and practices for newly arrived students in the Austrian, Italian, and South Tyrolean school systems which represent a spectrum of approaches for the accommodation of newly arrived students. While in Austria, children with a low perceived proficiency in the German language must undergo remediation prior to entering mainstream classes with their German-proficient peers, newly arrived students in Italy are inserted directly into mainstream classes and are involved in linguistic remediation both in and out of the main classroom. In South Tyrol (an autonomous trilingual province of Italy), the accommodation of newly arrived students is constrained by Italian education policies, fortified by the autonomous province’s extra language support, and partly inspired by Austrian policies. This paper provides a historical overview of transitional and/or accommodation policies in these three contexts, as well as an ethnographic perspective on the practices of different actors therein, thus illustrating how these three school systems’ accommodations of newly arrived students differ from one another. Keywords: Transitional Policies, Transitional Practices, Newly Arrived Students, Ethnography, Comparative Education Study, Inclusion
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Übersetzungen migrationsgesellschaftlicher Ordnungen in schulische Räume. Perspektiven und Positionierungen von Lehrer:innen (Natascha Khakpour)
In diesem Beitrag wird argumentiert, dass die verbesondernde Beschulungsform Deutschförderklasse in ihrem raum-zeitlichen Arrangement nicht nur für Schüler:innen bedeutsam ist, sondern für alle schulischen Akteur:innen und im Besonderen für Lehrer:innen. Der Beitrag stellt die Auseinandersetzung mit professionellen Selbstverständnissen und -positionierungen von Lehrer:innen im Hinblick auf die räumliche Übersetzung sprachlicher AnOrdnungen, wie sie sich in Deutschförderklassen zeigen, ins Zentrum. Anhand der Analyse eines berufsbiographischen Interviews mit einer Lehrerin wird das damit artikulierte (Selbst‐)Positionierungsgeschehen herausgearbeitet. Die theoretisch-methodologische Rahmung orientiert sich an übersetzungstheoretischen Zugängen. Diese erlauben das Aufgreifen von gesellschaftlichen Ordnungen in biographische(n) Inszenierungen als Übersetzungsprozess zu verstehen, ebenso wie sie als erkenntnispolitisches Moment der eigenen Interpretationsleistung zu verstehen sind. Schlüsselwörter: Segregative Beschulung, Übersetzungstheorie, Lehrer:innenbildung, sprachliche Ordnungen, Raum
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„[…] in den Fächern gab es eigentlich keine Fortschritte, ich glaube, es nennt sich ‚Vorbereitungsklasse‘“ – Erfahrungen neu zugewanderter Schüler:innen mit institutioneller Diskriminierung beim Übergang in das deutsche Bildungssystem (Julie A. Panagiotopoulou, Matthias Wagner)
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Frage, wie neu zugewanderte Schüler:innen ihre Erfahrungen als ‚Seiteneinsteiger:innen‘ in das deutsche Bildungssystem und insbesondere während der ausschließlichen Deutschförderung in einer Vorbereitungsklasse und des Übergangs in die Regelklasse retrospektiv deuten. Die empirische Grundlage bilden zwei biographische Interviews, die im Rahmen eines laufenden Forschungsprojektes zu transnationalen Bildungsbiographien zwischen Griechenland und Deutschland/NRW durchgeführt wurden. Im Mittelpunkt stehen somit die Perspektiven zweier Biograph:innen, die institutionellen Diskriminierungen entgehen konnten, indem sie gemeinsam mit ihren Eltern die Bildungsentscheidung trafen, das deutsche Bildungssystem ‚freiwillig‘ zu verlassen, um an einer öffentlichen Auslands- bzw. Ergänzungsschule in NRW das griechische Abitur zu erwerben. Anders als dies bei neu zugewanderten Schüler:innen der Fall ist, konnten sie somit ihre mitgebrachten bildungsbiographischen Ressourcen nutzen und – trotz des Ausschlusses vom deutschen Gymnasium – ihre Bildungsbiographie nach eigenen und/oder familialen Vorstellungen fortsetzen. Schlüsselwörter: Familienmigration, transnationale Bildungsbiographien, ‚Seiteneinsteiger:innen‘ in Vorbereitungsklassen, Bildungsentscheidungen, institutionelle Diskriminierung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„… ’ne richtig gute Schülerin [werden], wie ein deutsches Kind“: Deutsch(sprachig)-Sein als erwartete Fähigkeit von Grundschulkindern beim Übergang von der Vorbereitungsklasse in die Regelklasse in NRW (M Knappik, Julie A. Panagiotopoulou, Maren Gudat)
Die normative Erwartung, dass neu zugewanderte Kinder und Jugendliche zunächst „Deutsch können“ (Khakpour 2023) müssen, bevor sie Zugang zum deutschen Bildungssystem erhalten, legitimiert Formen der separierenden Beschulung mit dem primären Ziel des Deutscherwerbs, zusammenfassend als Vorbereitungsklassen bezeichnet. Denn diese Sonderklassen sollen die als (noch) nicht deutschsprachig adressierten potenziellen Regelschüler:innen auf ihre Integration in den einsprachig organisierten Regelunterricht der Regelklasse vorbereiten. Im vorliegenden Beitrag wird anhand einer Ethnographie in einer großstädtischen Grundschule rekonstruiert, wie mit diesem Integrationsversprechen nicht nur eine Leistungserwartung in Bezug auf den Erwerb des Deutschen, sondern auch eine sprachnationale Assimilationserwartung verbunden ist, die auf einer fiktiven Einteilung in zwei vermeintlich trennbare Gruppen von Grundschulkindern, in richtig vs. nicht richtig deutsch(sprachig)e Schüler:innen, basiert. Schlüsselwörter: Vorbereitungsklassen, Deutscherwerb, Sprachideologien
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
Zeitschrift für erziehungswissenschaftliche Migrationsforschung (ZeM)
1-2025: Vorbereitungsklassen für neu zugewanderte Schüler:innen in europäischen Migrationsgesellschaften: Dimensionen der Verhandlung von schulischer Inklusion und Exklusion
M Knappik / Julie A. Panagiotopoulou: Editorial: Vorbereitungsklassen für neu zugewanderte Schüler:innen in europäischen Migrationsgesellschaften: Dimensionen der Verhandlung von schulischer Inklusion und Exklusion
Gastbeitrag
Emmanuelle Le Pichon: Navigating the Complexities of the Education of Students with a Refugee Background: A Continuum of Adaptation
Beiträge im Themenschwerpunkt
Andrea Renee Leone-Pizzighella / Nadja Thoma: Transitional Educational Policies and Practices in Italy and Austria
Natascha Khakpour: Übersetzungen migrationsgesellschaftlicher Ordnungen in schulische Räume. Perspektiven und Positionierungen von Lehrer:innen
Julie A. Panagiotopoulou / Matthias Wagner: „[…] in den Fächern gab es eigentlich keine Fortschritte, ich glaube, es nennt sich ‚Vorbereitungsklasse‘“ – Erfahrungen neu zugewanderter Schüler:innen mit institutioneller Diskriminierung beim Übergang in das deutsche Bildungssystem
M Knappik / Julie A. Panagiotopoulou / Maren Gudat: „… ’ne richtig gute Schülerin [werden], wie ein deutsches Kind“: Deutsch(sprachig)-Sein als erwartete Fähigkeit von Grundschulkindern beim Übergang von der Vorbereitungsklasse in die Regelklasse in NRW
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zem.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZeM-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 2701-2476 |
| eISSN | 2701-2484 |
| Jahrgang | 4. Jahrgang 2025 |
| Ausgabe | 1-2025 |
| Erscheinungsdatum | 22.10.2025 |
| Umfang | 88 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Zusatzmaterial
Zusatzmaterial
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterBildungsentscheidungen, comparative education study, Deutscherwerb, ethnography, Familienmigration, Human Rights to Education, inclusion, inclusive education, institutionelle Diskriminierung, Lehrer*innenbildung, newly arrived students, Oktober 2025, Raum, reception classes versus mainstream classes, refugee education, segregative Beschulung, Sprachideologien, sprachliche Ordnungen, transitional policies, transitional practices, transnationale Bildungsbiographien, Vorbereitungsklassen, Übersetzungstheorie, ‚Seiteneinsteiger: innen‘ in Vorbereitungsklassen
Abstracts
Abstracts
Navigating the Complexities of the Education of Students with a Refugee Background: A Continuum of Adaptation (Emmanuelle Le Pichon)
Recent conflicts have contributed to a large influx of refugees to Europe and North America. These displacements, combined with global tensions, have led to restrictive migration policies. Despite these challenges, several countries pledged in 2016 to integrate students of refugee background into national education systems, guaranteeing them access to quality education soon after arrival. This article examines refugee education in Western countries in terms of availability, accessibility, acceptability and adaptability, focusing on Canada, in particular Ontario, and comparing it with practices in some European countries. The study highlights the significant variability of refugee education within countries and questions the legitimacy of reception classes in relation to mainstream classes. The article highlights the need for nuanced approaches that take into account individual migration trajectories, diverse educational needs, and systemic challenges inherent to each educational system. It advocates for a shift from deficit-based to strength-based pedagogical practices, while emphasizing the importance of adaptability in education, supported by strong leadership within school teams. The Canadian example illustrates both the potential for inclusion and the societal challenges. Keywords: Refugee Education, Human Rights to Education, Inclusive Education, Reception Classes versus Mainstream Classes
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Transitional Educational Policies and Practices in Italy and Austria (Andrea Renee Leone-Pizzighella, Nadja Thoma)
This article explores the transitional policies and practices for newly arrived students in the Austrian, Italian, and South Tyrolean school systems which represent a spectrum of approaches for the accommodation of newly arrived students. While in Austria, children with a low perceived proficiency in the German language must undergo remediation prior to entering mainstream classes with their German-proficient peers, newly arrived students in Italy are inserted directly into mainstream classes and are involved in linguistic remediation both in and out of the main classroom. In South Tyrol (an autonomous trilingual province of Italy), the accommodation of newly arrived students is constrained by Italian education policies, fortified by the autonomous province’s extra language support, and partly inspired by Austrian policies. This paper provides a historical overview of transitional and/or accommodation policies in these three contexts, as well as an ethnographic perspective on the practices of different actors therein, thus illustrating how these three school systems’ accommodations of newly arrived students differ from one another. Keywords: Transitional Policies, Transitional Practices, Newly Arrived Students, Ethnography, Comparative Education Study, Inclusion
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Übersetzungen migrationsgesellschaftlicher Ordnungen in schulische Räume. Perspektiven und Positionierungen von Lehrer:innen (Natascha Khakpour)
In diesem Beitrag wird argumentiert, dass die verbesondernde Beschulungsform Deutschförderklasse in ihrem raum-zeitlichen Arrangement nicht nur für Schüler:innen bedeutsam ist, sondern für alle schulischen Akteur:innen und im Besonderen für Lehrer:innen. Der Beitrag stellt die Auseinandersetzung mit professionellen Selbstverständnissen und -positionierungen von Lehrer:innen im Hinblick auf die räumliche Übersetzung sprachlicher AnOrdnungen, wie sie sich in Deutschförderklassen zeigen, ins Zentrum. Anhand der Analyse eines berufsbiographischen Interviews mit einer Lehrerin wird das damit artikulierte (Selbst‐)Positionierungsgeschehen herausgearbeitet. Die theoretisch-methodologische Rahmung orientiert sich an übersetzungstheoretischen Zugängen. Diese erlauben das Aufgreifen von gesellschaftlichen Ordnungen in biographische(n) Inszenierungen als Übersetzungsprozess zu verstehen, ebenso wie sie als erkenntnispolitisches Moment der eigenen Interpretationsleistung zu verstehen sind. Schlüsselwörter: Segregative Beschulung, Übersetzungstheorie, Lehrer:innenbildung, sprachliche Ordnungen, Raum
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„[…] in den Fächern gab es eigentlich keine Fortschritte, ich glaube, es nennt sich ‚Vorbereitungsklasse‘“ – Erfahrungen neu zugewanderter Schüler:innen mit institutioneller Diskriminierung beim Übergang in das deutsche Bildungssystem (Julie A. Panagiotopoulou, Matthias Wagner)
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Frage, wie neu zugewanderte Schüler:innen ihre Erfahrungen als ‚Seiteneinsteiger:innen‘ in das deutsche Bildungssystem und insbesondere während der ausschließlichen Deutschförderung in einer Vorbereitungsklasse und des Übergangs in die Regelklasse retrospektiv deuten. Die empirische Grundlage bilden zwei biographische Interviews, die im Rahmen eines laufenden Forschungsprojektes zu transnationalen Bildungsbiographien zwischen Griechenland und Deutschland/NRW durchgeführt wurden. Im Mittelpunkt stehen somit die Perspektiven zweier Biograph:innen, die institutionellen Diskriminierungen entgehen konnten, indem sie gemeinsam mit ihren Eltern die Bildungsentscheidung trafen, das deutsche Bildungssystem ‚freiwillig‘ zu verlassen, um an einer öffentlichen Auslands- bzw. Ergänzungsschule in NRW das griechische Abitur zu erwerben. Anders als dies bei neu zugewanderten Schüler:innen der Fall ist, konnten sie somit ihre mitgebrachten bildungsbiographischen Ressourcen nutzen und – trotz des Ausschlusses vom deutschen Gymnasium – ihre Bildungsbiographie nach eigenen und/oder familialen Vorstellungen fortsetzen. Schlüsselwörter: Familienmigration, transnationale Bildungsbiographien, ‚Seiteneinsteiger:innen‘ in Vorbereitungsklassen, Bildungsentscheidungen, institutionelle Diskriminierung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„… ’ne richtig gute Schülerin [werden], wie ein deutsches Kind“: Deutsch(sprachig)-Sein als erwartete Fähigkeit von Grundschulkindern beim Übergang von der Vorbereitungsklasse in die Regelklasse in NRW (M Knappik, Julie A. Panagiotopoulou, Maren Gudat)
Die normative Erwartung, dass neu zugewanderte Kinder und Jugendliche zunächst „Deutsch können“ (Khakpour 2023) müssen, bevor sie Zugang zum deutschen Bildungssystem erhalten, legitimiert Formen der separierenden Beschulung mit dem primären Ziel des Deutscherwerbs, zusammenfassend als Vorbereitungsklassen bezeichnet. Denn diese Sonderklassen sollen die als (noch) nicht deutschsprachig adressierten potenziellen Regelschüler:innen auf ihre Integration in den einsprachig organisierten Regelunterricht der Regelklasse vorbereiten. Im vorliegenden Beitrag wird anhand einer Ethnographie in einer großstädtischen Grundschule rekonstruiert, wie mit diesem Integrationsversprechen nicht nur eine Leistungserwartung in Bezug auf den Erwerb des Deutschen, sondern auch eine sprachnationale Assimilationserwartung verbunden ist, die auf einer fiktiven Einteilung in zwei vermeintlich trennbare Gruppen von Grundschulkindern, in richtig vs. nicht richtig deutsch(sprachig)e Schüler:innen, basiert. Schlüsselwörter: Vorbereitungsklassen, Deutscherwerb, Sprachideologien
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)


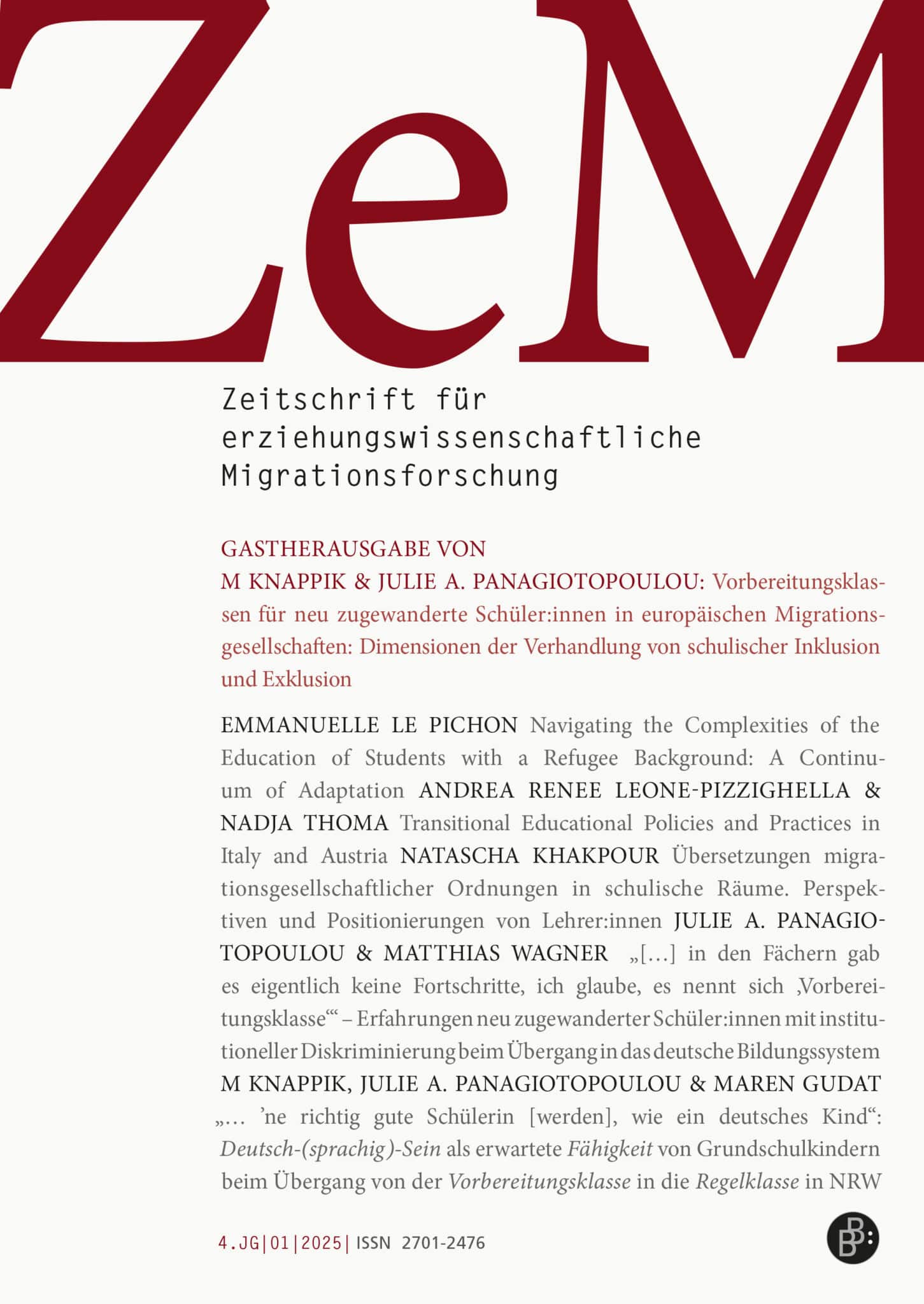

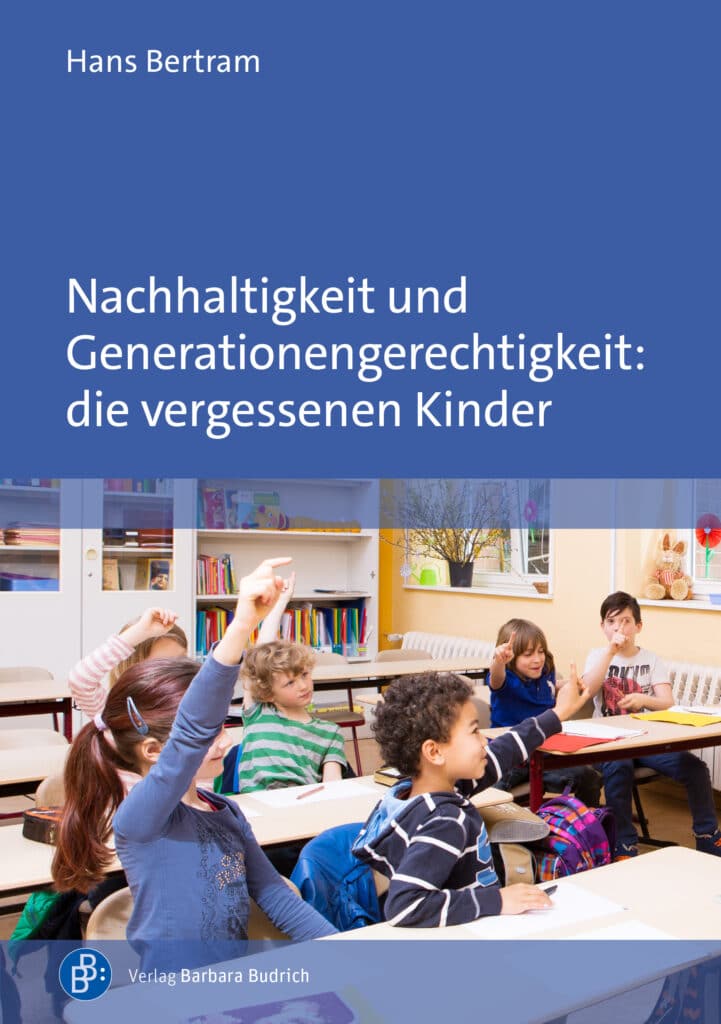
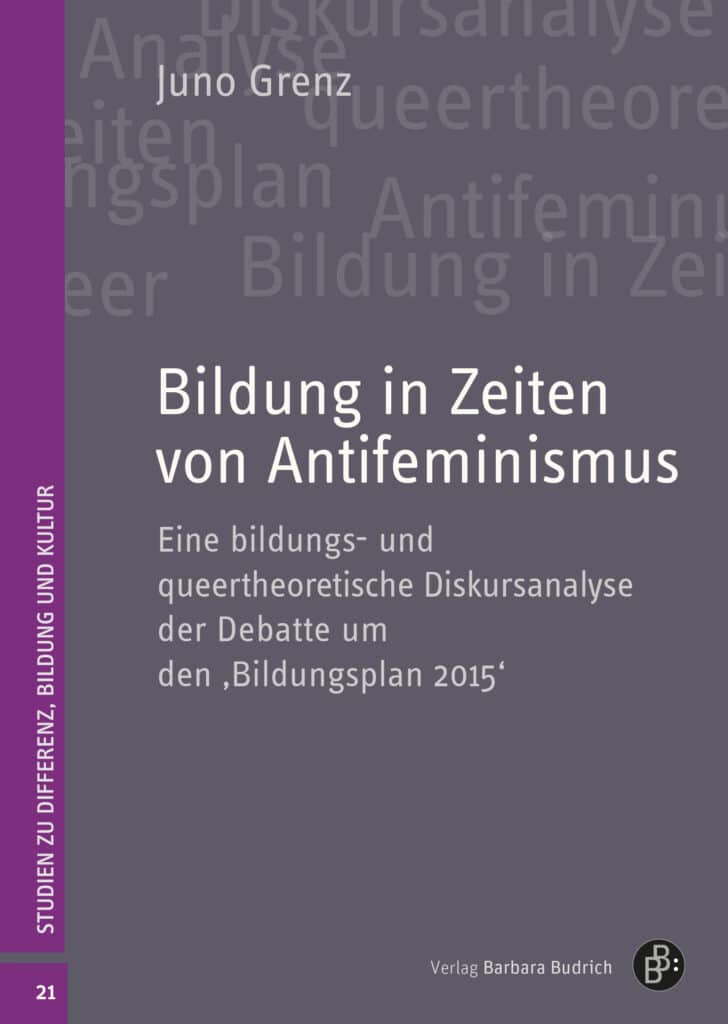
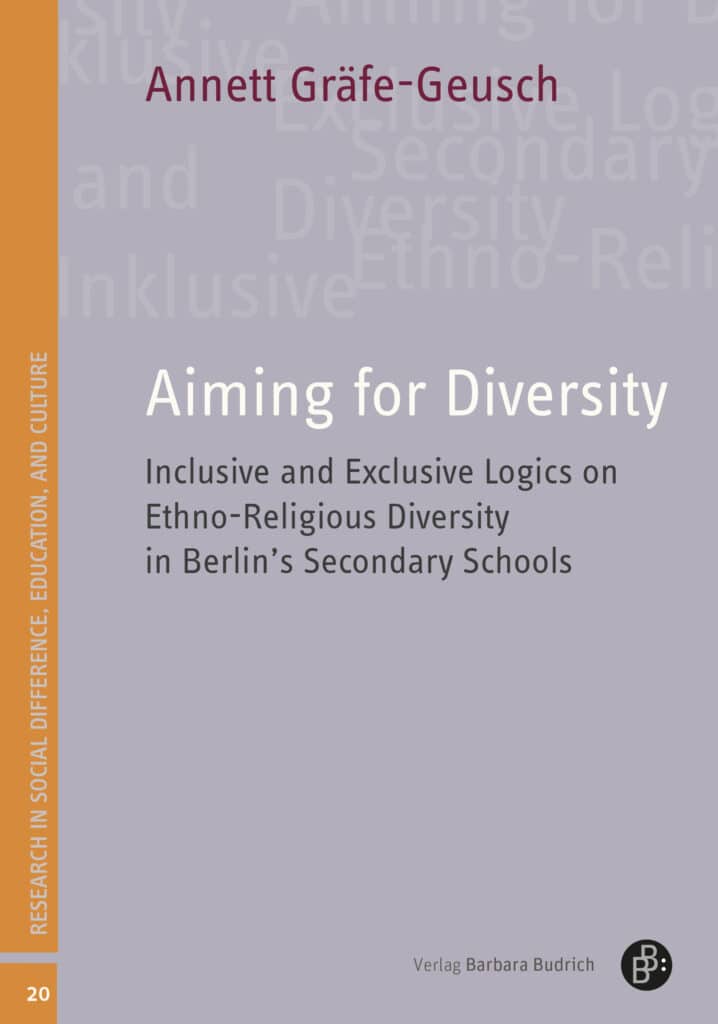


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.