Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » ZPTh 2-2024 | Themenheft: Der oikos des demos: Auf dem Weg zu einer demokratischen Ökonomie
ZPTh 2-2024 | Themenheft: Der oikos des demos: Auf dem Weg zu einer demokratischen Ökonomie
Erscheinungsdatum : 11.03.2025
30,00 €
- Inhalt
- Bibliografie
- Produktsicherheit
- Zusatzmaterial
- Bewertungen (0)
- Autor*innen
- Schlagwörter
- Abstracts
Inhalt
ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie
2-2024: Themenheft: Der oikos des demos: Auf dem Weg zu einer demokratischen Ökonomie
Gast-Hrsg.: Martin Oppelt & Paul Sörensen
Martin Oppelt / Paul Sörensen: Der oikos des demos: Auf dem Weg zu einer demokratischen Ökonomie. Editorial der Gastherausgeber
Beiträge:
Dirk Jörke / David Salomon: Erziehung zum Bourgeois. Zur Funktion der Genossenschaftsidee bei John Stuart Mill
Falko Blumenthal: Selbstverwirklichung der Arbeitnehmer durch Demokratisierung der Wirtschaft. Otto Brenner als gewerkschaftlicher Ideenpolitiker
Hannes Kuch: Wirtschaftsdemokratie als Einübungspraxis (im Open Access verfügbar)
Katharina Liesenberg: Die Radikalität alltäglicher Erfahrung. Zu John Deweys gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen von Demokratie
Heiner Koch: Vergesellschaftung als Entprivatisierung
Samia Zahra Mohammed: Planung als antwortende Politik? Eine radikaldemokratietheoretische Lesart der sozialistischen Planwirtschaftsdebatte
Sara Gebh: Die Rückkehr der Armen? Plebejanismus und die politische Ökonomie der Radikaldemokratie (im Open Access verfügbar)
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zpth.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZPTh-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1869-3016 |
| eISSN | 2196-2103 |
| Jahrgang | 15. Jahrgang 2024 |
| Ausgabe | 2-2024 |
| Erscheinungsdatum | 11.03.2025 |
| Umfang | 172 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Zusatzmaterial
Autor*innen
SchlagwörterDemokratie, demokratische Wirtschaftsplanung, demokratische Ökonomie, demokratischer Sozialismus, Eigentum, Entprivatisierung, Erfahrung, Ethos, Genossenschaften, Gewerkschaften, Ideenpolitik, John Stuart Mill, Liberalismus, Materialismus, Meritokratie, März 2025, Oligarchie, Planwirtschaft, Plebejanismus, politische Ökonomie, Pragmatismus, Radikaldemokratie, radikale Demokratietheorie, Republikanismus, Socialist Calculation Debate, Sozialdemokratie, Sozialisierung, Sozialismus, Sozialismuskritik, sozialistische Planwirtschaftsdebatte, Tugendethik, unsichtbare Hand, Utopie, Vergesellschaftung, Wirtschaftsdemokratie, Zivilisationstheorie, Ökologie
Abstracts
Erziehung zum Bourgeois. Zur Funktion der Genossenschaftsidee bei John Stuart Mill (Dirk Jörke / David Salomon)
Im Zusammenhang mit Wirtschaftsdemokratie wird oft auf John Stuart Mill verwiesen. Der bekannte Vertreter des Utilitarismus gilt einigen Interpreten gar als ‚liberaler Sozialist‘, der sich den Herausforderungen der sozialen Frage konsequenter als andere Vertreter der ökonomischen Klassik gestellt habe. Ein wichtiger Bezugspunkt dieser Lesart sind vor allem Mills Überlegungen zum Genossenschaftswesen, in denen er eine Möglichkeit sieht, die Klassenspaltung der Gesellschaft zu überwinden. Im vorliegenden Beitrag rekonstruieren wir Mills Konzept von Genossenschaften und zeigen, dass Mill keineswegs die Absicht hat, die kapitalistische Produktionsweise zu überwinden oder auch nur einzuhegen. Mill sieht in Genossenschaften vielmehr ein Mittel der Erziehung der arbeitenden Klassen zum unternehmerischen Denken und Handeln, das ihm zugleich als Vorbedingung politischer Partizipation in der Demokratie erscheint. Mills zivilisationstheoretisch grundierte Pädagogik folgt einem meritokratischen Ideal und dem Ziel einer vollständigen Anpassung an die Bedingungen kapitalistischen Wettbewerbs. Schlüsselwörter: John Stuart Mill, Sozialismus, Sozialismuskritik, Genossenschaften, Zivilisationstheorie, Meritokratie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Selbstverwirklichung der Arbeitnehmer durch Demokratisierung der Wirtschaft. Otto Brenner als gewerkschaftlicher Ideenpolitiker (Falko Blumenthal)
Ausgehend von Otto Brenners (1907–1972) Verknüpfung des reformsozialistischen Gewerkschaftsprogramms der Wirtschaftsdemokratie mit der Idee der Selbstverwirklichung prüft der Beitrag den ideenpolitischen Anspruch des Vorsitzenden der IG Metall (1952–1972). Die These über einen solchen Anspruch geht von einem Projekt der sozialdemokratischen Moderne aus, in dem Otto Brenner das Gewerkschaftsprogramm reflexiv neu formuliert. Die Ideenpolitik des Machtpolitikers Otto Brenner wird durch zwei Lektüren des Programms der Demokratisierung der Wirtschaft (1928), eine Skizze zur Sprechposition Otto Brenners sowie eine synoptische Darstellung der wirtschaftsdemokratischen Positionen Brenners vorbereitet. Brenners Demokratisierung der Wirtschaft wird als demokratiesichernde Fortentwicklung der freiheitlichen Gesellschaftsordnung und gleichzeitig subversive Intervention des realistischen Radikaldemokraten interpretiert. Schlüsselwörter: Wirtschaftsdemokratie, Radikaldemokratie, Gewerkschaften, Ideenpolitik, Sozialdemokratie, Sozialismus
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Wirtschaftsdemokratie als Einübungspraxis (Hannes Kuch)
Im Hinblick auf die Aufgabe, die normativen Grundlagen einer Demokratisierung der Wirtschaft auszuarbeiten, entwickelt der Aufsatz eine materialistische Tugendethik. Dieser Ansatz betrachtet die materiellen Grundbedingungen des Wirtschaftens als prägend für sittliche Dispositionen. Er greift die aristotelische Idee auf, dass Tugenden in der Dauer der Zeit ausgebildet und trainiert werden müssen. Wirtschaftsdemokratische Überlegungen von John Stuart Mill, John Dewey, Carole Pateman und Axel Honneth enthalten Ansätze dieser Ethik, doch sie beleuchten oft nicht ausreichend, worin genau die Prägekraft ökonomischer Strukturen besteht. Der Aufsatz schließt diese Lücke. Die Schlussfolgerung lautet, dass diejenigen sozialen Kontexte, in denen wir zur Kooperation genötigt sind, zu einem Einübungsfeld demokratischer Dispositionen werden sollten – und dieser Kontext ist der ökonomische Bereich. Autoritäre Strukturen in der Wirtschaft gefährden hingegen die politische Demokratie. Dieser Ansatz liefert ein wichtiges Argument gegen die Idee einer grundlegenden Trennung von demokratischer Politik und undemokratischer Wirtschaft, wie sie von John Rawls und Jürgen Habermas nahegelegt wird. Schlüsselwörter: Wirtschaftsdemokratie, Tugendethik, Materialismus, Ethos, unsichtbare Hand
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die Radikalität alltäglicher Erfahrung. Zu John Deweys gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen von Demokratie (Katharina Liesenberg)
John Dewey, US-amerikanischer Pragmatist des 20. Jahrhunderts, war nicht nur Pädagoge und Deliberationstheoretiker, sondern entwickelte mit seinem demokratischen Sozialismus auch eine Demokratietheorie, die die gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen von politischer Demokratie reflektiert. Die Möglichkeit eines jeden Individuums neue Erfahrungen zu machen ist dabei die normative Grundlage von Demokratie. Weil Freiheit nur relational verwirklicht werden kann und damit in Abhängigkeit zu Machtstrukturen steht, plädiert Dewey im Angesicht der Arbeitsbedingungen des industrialisierten Kapitalismus für einen demokratischen Sozialismus, der sich an den alltäglichen Erfahrungen seiner Adressat:innen orientiert. Erziehung, kollektive Organisierung und Vergesellschaftung von Banken, Infrastruktur und großer Industrie sind dabei individuelle wie kollektive Strategien zur Realisierung einer Demokratie als Lebensform. Diese pragmatistische Herangehensweise zeichnet Deweys Ansatz aus und ist ein Appell an die zeitgenössische Demokratietheorie sich auch heute an Alltagserfahrungen zu orientieren und in Anlehnung an Dewey radikale Strategien zur Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts vorzuschlagen. Schlüsselwörter: Demokratie, demokratischer Sozialismus, Pragmatismus, Erfahrung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Vergesellschaftung als Entprivatisierung (Heiner Koch)
Seit einiger Zeit ist die Vergesellschaftungsfrage politisch wieder relevant geworden. Gleichzeitig ist oft jedoch nicht klar, was mit ‚Vergesellschaftung‘ gemeint ist. Hier gibt es auch erhebliche Unterschiede zwischen dem rechtswissenschaftlichen und dem politischen Diskurs. Begriffliche Unklarheiten und entsprechende Klärungsversuche gab es bereits nach dem Ersten Weltkrieg, als umfassende Vergesellschaftungen auf der Tagesordnung standen. Eine Aktualisierung des Vergesellschaftungsbegriffs muss dabei an bestehende Debatten anknüpfen und gleichzeitig den Begriff für aktuelle politische Auseinandersetzungen fruchtbar machen. Daher werde ich zunächst unter Rückgriff auf die Ideen der Explikation und des leeren Signifikanten für eine vermittelnde Variante der politischen Begriffsarbeit argumentieren. Anschließend zeige ich, dass sich ‚Vergesellschaftung‘ als ‚Entprivatisierung‘ verstehen lässt. Hierdurch lassen sich die verschiedenen Aspekte des Vergesellschaftungsbegriffs besser verstehen, systematisieren und konkretisieren. Dies wird auch dadurch gewährleistet, dass sich drei Ebenen der Entprivatisierung unterscheiden lassen: (i) Privateigentum, (ii) private Wirtschaftstätigkeit und (iii) Privatnützigkeit. Abschließend werde ich die Idee der Vergesellschaftung über einen eng verstandenen ökonomischen Bereich hinaus verallgemeinern, um eine breitere Anschlussfähigkeit für politische Diskurse zu gewährleisten. Schlüsselwörter: Vergesellschaftung, Sozialisierung, Eigentum, Planwirtschaft, Entprivatisierung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Planung als antwortende Politik? Eine radikaldemokratietheoretische Lesart der sozialistischen Planwirtschaftsdebatte (Samia Zahra Mohammed)
Dass demokratisches Regieren sowie Ansprüche auf Freiheit und Gleichheit von der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer neoliberalen Gestalt der Gegenwart untergraben werden, ist insbesondere für zeitdiagnostisch ansetzende (radikale) Demokratietheorien nichts Neues. Dennoch bleiben die (Wieder-)Annäherungsversuche zwischen demokratietheoretischen und politökonomischen Diskussionen bisweilen zögerlich – wenn sie überhaupt stattfinden. Interessante Impulse für das wieder verstärkte Diskutieren politökonomischer Fragen unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten kommen aktuell aus einer Richtung, die seit dem Scheitern der sogenannten realsozialistischen Versuche des 20. Jahrhunderts in Verruf geraten ist: Vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher und technologischer Voraussetzungen wird neu über die Möglichkeiten und Implikationen demokratischsozialistischer Planwirtschaft diskutiert. Der Artikel argumentiert nun dafür, dass sich hier wichtige Anregungen für gegenwärtige Überlegungen zu Wirtschaftsdemokratie finden lassen. Konkret können sich durch eine radikaldemokratische Deutung der Planungsdebatte und durch eine planungsinformierte Perspektive auf radikaldemokratische Überlegungen beide Diskussionen in ihrem Nachdenken über eine gleichere, freiere und demokratischere Zukunft für alle und deren Bedingungen wechselseitig befruchten. Schlüsselwörter: Sozialistische Planwirtschaftsdebatte, Socialist Calculation Debate, demokratische Wirtschaftsplanung, radikale Demokratietheorie, Ökologie, Utopie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Rückkehr der Armen? Plebejanismus und die politische Ökonomie der Radikaldemokratie (Sara Gebh)
Ökonomische Fragen spielen in radikalen Demokratietheorien, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle. Was fehlt, ist eine ernsthafte Reflexion über die materiellen Voraussetzungen und Konsequenzen radikaldemokratischer Grundannahmen und Zielbeschreibungen. Die Tradition des Plebejanismus hält Ressourcen bereit, um die ökonomische Leerstelle der Radikaldemokratie zu adressieren. Während die liberalen und republikanischen Varianten Plebejanismus als Addendum zum liberal-demokratischen Status Quo verstehen, ist es der Anspruch eines radikaldemokratischen Plebejanismus, oligarchische Strukturen nicht nur zu reformieren, sondern abzuschaffen. Eine konkrete Vision plebejischer Demokratie bleiben radikaldemokratische Theorien bisher jedoch schuldig. Nur wenn Plebejanismus nicht als rein symbolischer Akt der Selbstemanzipation verstanden und die materielle Dimension der Kategorie der Vielen anerkannt wird, werden erste Umrisse einer politischen Ökonomie der Radikaldemokratie erkennbar. Schlüsselwörter: Plebejanismus, Radikaldemokratie, Oligarchie, Republikanismus, Liberalismus, politische Ökonomie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie
2-2024: Themenheft: Der oikos des demos: Auf dem Weg zu einer demokratischen Ökonomie
Gast-Hrsg.: Martin Oppelt & Paul Sörensen
Martin Oppelt / Paul Sörensen: Der oikos des demos: Auf dem Weg zu einer demokratischen Ökonomie. Editorial der Gastherausgeber
Beiträge:
Dirk Jörke / David Salomon: Erziehung zum Bourgeois. Zur Funktion der Genossenschaftsidee bei John Stuart Mill
Falko Blumenthal: Selbstverwirklichung der Arbeitnehmer durch Demokratisierung der Wirtschaft. Otto Brenner als gewerkschaftlicher Ideenpolitiker
Hannes Kuch: Wirtschaftsdemokratie als Einübungspraxis (im Open Access verfügbar)
Katharina Liesenberg: Die Radikalität alltäglicher Erfahrung. Zu John Deweys gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen von Demokratie
Heiner Koch: Vergesellschaftung als Entprivatisierung
Samia Zahra Mohammed: Planung als antwortende Politik? Eine radikaldemokratietheoretische Lesart der sozialistischen Planwirtschaftsdebatte
Sara Gebh: Die Rückkehr der Armen? Plebejanismus und die politische Ökonomie der Radikaldemokratie (im Open Access verfügbar)
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zpth.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZPTh-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1869-3016 |
| eISSN | 2196-2103 |
| Jahrgang | 15. Jahrgang 2024 |
| Ausgabe | 2-2024 |
| Erscheinungsdatum | 11.03.2025 |
| Umfang | 172 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Zusatzmaterial
Zusatzmaterial
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterDemokratie, demokratische Wirtschaftsplanung, demokratische Ökonomie, demokratischer Sozialismus, Eigentum, Entprivatisierung, Erfahrung, Ethos, Genossenschaften, Gewerkschaften, Ideenpolitik, John Stuart Mill, Liberalismus, Materialismus, Meritokratie, März 2025, Oligarchie, Planwirtschaft, Plebejanismus, politische Ökonomie, Pragmatismus, Radikaldemokratie, radikale Demokratietheorie, Republikanismus, Socialist Calculation Debate, Sozialdemokratie, Sozialisierung, Sozialismus, Sozialismuskritik, sozialistische Planwirtschaftsdebatte, Tugendethik, unsichtbare Hand, Utopie, Vergesellschaftung, Wirtschaftsdemokratie, Zivilisationstheorie, Ökologie
Abstracts
Abstracts
Erziehung zum Bourgeois. Zur Funktion der Genossenschaftsidee bei John Stuart Mill (Dirk Jörke / David Salomon)
Im Zusammenhang mit Wirtschaftsdemokratie wird oft auf John Stuart Mill verwiesen. Der bekannte Vertreter des Utilitarismus gilt einigen Interpreten gar als ‚liberaler Sozialist‘, der sich den Herausforderungen der sozialen Frage konsequenter als andere Vertreter der ökonomischen Klassik gestellt habe. Ein wichtiger Bezugspunkt dieser Lesart sind vor allem Mills Überlegungen zum Genossenschaftswesen, in denen er eine Möglichkeit sieht, die Klassenspaltung der Gesellschaft zu überwinden. Im vorliegenden Beitrag rekonstruieren wir Mills Konzept von Genossenschaften und zeigen, dass Mill keineswegs die Absicht hat, die kapitalistische Produktionsweise zu überwinden oder auch nur einzuhegen. Mill sieht in Genossenschaften vielmehr ein Mittel der Erziehung der arbeitenden Klassen zum unternehmerischen Denken und Handeln, das ihm zugleich als Vorbedingung politischer Partizipation in der Demokratie erscheint. Mills zivilisationstheoretisch grundierte Pädagogik folgt einem meritokratischen Ideal und dem Ziel einer vollständigen Anpassung an die Bedingungen kapitalistischen Wettbewerbs. Schlüsselwörter: John Stuart Mill, Sozialismus, Sozialismuskritik, Genossenschaften, Zivilisationstheorie, Meritokratie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Selbstverwirklichung der Arbeitnehmer durch Demokratisierung der Wirtschaft. Otto Brenner als gewerkschaftlicher Ideenpolitiker (Falko Blumenthal)
Ausgehend von Otto Brenners (1907–1972) Verknüpfung des reformsozialistischen Gewerkschaftsprogramms der Wirtschaftsdemokratie mit der Idee der Selbstverwirklichung prüft der Beitrag den ideenpolitischen Anspruch des Vorsitzenden der IG Metall (1952–1972). Die These über einen solchen Anspruch geht von einem Projekt der sozialdemokratischen Moderne aus, in dem Otto Brenner das Gewerkschaftsprogramm reflexiv neu formuliert. Die Ideenpolitik des Machtpolitikers Otto Brenner wird durch zwei Lektüren des Programms der Demokratisierung der Wirtschaft (1928), eine Skizze zur Sprechposition Otto Brenners sowie eine synoptische Darstellung der wirtschaftsdemokratischen Positionen Brenners vorbereitet. Brenners Demokratisierung der Wirtschaft wird als demokratiesichernde Fortentwicklung der freiheitlichen Gesellschaftsordnung und gleichzeitig subversive Intervention des realistischen Radikaldemokraten interpretiert. Schlüsselwörter: Wirtschaftsdemokratie, Radikaldemokratie, Gewerkschaften, Ideenpolitik, Sozialdemokratie, Sozialismus
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Wirtschaftsdemokratie als Einübungspraxis (Hannes Kuch)
Im Hinblick auf die Aufgabe, die normativen Grundlagen einer Demokratisierung der Wirtschaft auszuarbeiten, entwickelt der Aufsatz eine materialistische Tugendethik. Dieser Ansatz betrachtet die materiellen Grundbedingungen des Wirtschaftens als prägend für sittliche Dispositionen. Er greift die aristotelische Idee auf, dass Tugenden in der Dauer der Zeit ausgebildet und trainiert werden müssen. Wirtschaftsdemokratische Überlegungen von John Stuart Mill, John Dewey, Carole Pateman und Axel Honneth enthalten Ansätze dieser Ethik, doch sie beleuchten oft nicht ausreichend, worin genau die Prägekraft ökonomischer Strukturen besteht. Der Aufsatz schließt diese Lücke. Die Schlussfolgerung lautet, dass diejenigen sozialen Kontexte, in denen wir zur Kooperation genötigt sind, zu einem Einübungsfeld demokratischer Dispositionen werden sollten – und dieser Kontext ist der ökonomische Bereich. Autoritäre Strukturen in der Wirtschaft gefährden hingegen die politische Demokratie. Dieser Ansatz liefert ein wichtiges Argument gegen die Idee einer grundlegenden Trennung von demokratischer Politik und undemokratischer Wirtschaft, wie sie von John Rawls und Jürgen Habermas nahegelegt wird. Schlüsselwörter: Wirtschaftsdemokratie, Tugendethik, Materialismus, Ethos, unsichtbare Hand
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die Radikalität alltäglicher Erfahrung. Zu John Deweys gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen von Demokratie (Katharina Liesenberg)
John Dewey, US-amerikanischer Pragmatist des 20. Jahrhunderts, war nicht nur Pädagoge und Deliberationstheoretiker, sondern entwickelte mit seinem demokratischen Sozialismus auch eine Demokratietheorie, die die gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen von politischer Demokratie reflektiert. Die Möglichkeit eines jeden Individuums neue Erfahrungen zu machen ist dabei die normative Grundlage von Demokratie. Weil Freiheit nur relational verwirklicht werden kann und damit in Abhängigkeit zu Machtstrukturen steht, plädiert Dewey im Angesicht der Arbeitsbedingungen des industrialisierten Kapitalismus für einen demokratischen Sozialismus, der sich an den alltäglichen Erfahrungen seiner Adressat:innen orientiert. Erziehung, kollektive Organisierung und Vergesellschaftung von Banken, Infrastruktur und großer Industrie sind dabei individuelle wie kollektive Strategien zur Realisierung einer Demokratie als Lebensform. Diese pragmatistische Herangehensweise zeichnet Deweys Ansatz aus und ist ein Appell an die zeitgenössische Demokratietheorie sich auch heute an Alltagserfahrungen zu orientieren und in Anlehnung an Dewey radikale Strategien zur Verbesserung von Arbeits- und Lebensbedingungen im Kapitalismus des 21. Jahrhunderts vorzuschlagen. Schlüsselwörter: Demokratie, demokratischer Sozialismus, Pragmatismus, Erfahrung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Vergesellschaftung als Entprivatisierung (Heiner Koch)
Seit einiger Zeit ist die Vergesellschaftungsfrage politisch wieder relevant geworden. Gleichzeitig ist oft jedoch nicht klar, was mit ‚Vergesellschaftung‘ gemeint ist. Hier gibt es auch erhebliche Unterschiede zwischen dem rechtswissenschaftlichen und dem politischen Diskurs. Begriffliche Unklarheiten und entsprechende Klärungsversuche gab es bereits nach dem Ersten Weltkrieg, als umfassende Vergesellschaftungen auf der Tagesordnung standen. Eine Aktualisierung des Vergesellschaftungsbegriffs muss dabei an bestehende Debatten anknüpfen und gleichzeitig den Begriff für aktuelle politische Auseinandersetzungen fruchtbar machen. Daher werde ich zunächst unter Rückgriff auf die Ideen der Explikation und des leeren Signifikanten für eine vermittelnde Variante der politischen Begriffsarbeit argumentieren. Anschließend zeige ich, dass sich ‚Vergesellschaftung‘ als ‚Entprivatisierung‘ verstehen lässt. Hierdurch lassen sich die verschiedenen Aspekte des Vergesellschaftungsbegriffs besser verstehen, systematisieren und konkretisieren. Dies wird auch dadurch gewährleistet, dass sich drei Ebenen der Entprivatisierung unterscheiden lassen: (i) Privateigentum, (ii) private Wirtschaftstätigkeit und (iii) Privatnützigkeit. Abschließend werde ich die Idee der Vergesellschaftung über einen eng verstandenen ökonomischen Bereich hinaus verallgemeinern, um eine breitere Anschlussfähigkeit für politische Diskurse zu gewährleisten. Schlüsselwörter: Vergesellschaftung, Sozialisierung, Eigentum, Planwirtschaft, Entprivatisierung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Planung als antwortende Politik? Eine radikaldemokratietheoretische Lesart der sozialistischen Planwirtschaftsdebatte (Samia Zahra Mohammed)
Dass demokratisches Regieren sowie Ansprüche auf Freiheit und Gleichheit von der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer neoliberalen Gestalt der Gegenwart untergraben werden, ist insbesondere für zeitdiagnostisch ansetzende (radikale) Demokratietheorien nichts Neues. Dennoch bleiben die (Wieder-)Annäherungsversuche zwischen demokratietheoretischen und politökonomischen Diskussionen bisweilen zögerlich – wenn sie überhaupt stattfinden. Interessante Impulse für das wieder verstärkte Diskutieren politökonomischer Fragen unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten kommen aktuell aus einer Richtung, die seit dem Scheitern der sogenannten realsozialistischen Versuche des 20. Jahrhunderts in Verruf geraten ist: Vor dem Hintergrund veränderter gesellschaftlicher und technologischer Voraussetzungen wird neu über die Möglichkeiten und Implikationen demokratischsozialistischer Planwirtschaft diskutiert. Der Artikel argumentiert nun dafür, dass sich hier wichtige Anregungen für gegenwärtige Überlegungen zu Wirtschaftsdemokratie finden lassen. Konkret können sich durch eine radikaldemokratische Deutung der Planungsdebatte und durch eine planungsinformierte Perspektive auf radikaldemokratische Überlegungen beide Diskussionen in ihrem Nachdenken über eine gleichere, freiere und demokratischere Zukunft für alle und deren Bedingungen wechselseitig befruchten. Schlüsselwörter: Sozialistische Planwirtschaftsdebatte, Socialist Calculation Debate, demokratische Wirtschaftsplanung, radikale Demokratietheorie, Ökologie, Utopie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Rückkehr der Armen? Plebejanismus und die politische Ökonomie der Radikaldemokratie (Sara Gebh)
Ökonomische Fragen spielen in radikalen Demokratietheorien, wenn überhaupt, eine untergeordnete Rolle. Was fehlt, ist eine ernsthafte Reflexion über die materiellen Voraussetzungen und Konsequenzen radikaldemokratischer Grundannahmen und Zielbeschreibungen. Die Tradition des Plebejanismus hält Ressourcen bereit, um die ökonomische Leerstelle der Radikaldemokratie zu adressieren. Während die liberalen und republikanischen Varianten Plebejanismus als Addendum zum liberal-demokratischen Status Quo verstehen, ist es der Anspruch eines radikaldemokratischen Plebejanismus, oligarchische Strukturen nicht nur zu reformieren, sondern abzuschaffen. Eine konkrete Vision plebejischer Demokratie bleiben radikaldemokratische Theorien bisher jedoch schuldig. Nur wenn Plebejanismus nicht als rein symbolischer Akt der Selbstemanzipation verstanden und die materielle Dimension der Kategorie der Vielen anerkannt wird, werden erste Umrisse einer politischen Ökonomie der Radikaldemokratie erkennbar. Schlüsselwörter: Plebejanismus, Radikaldemokratie, Oligarchie, Republikanismus, Liberalismus, politische Ökonomie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)





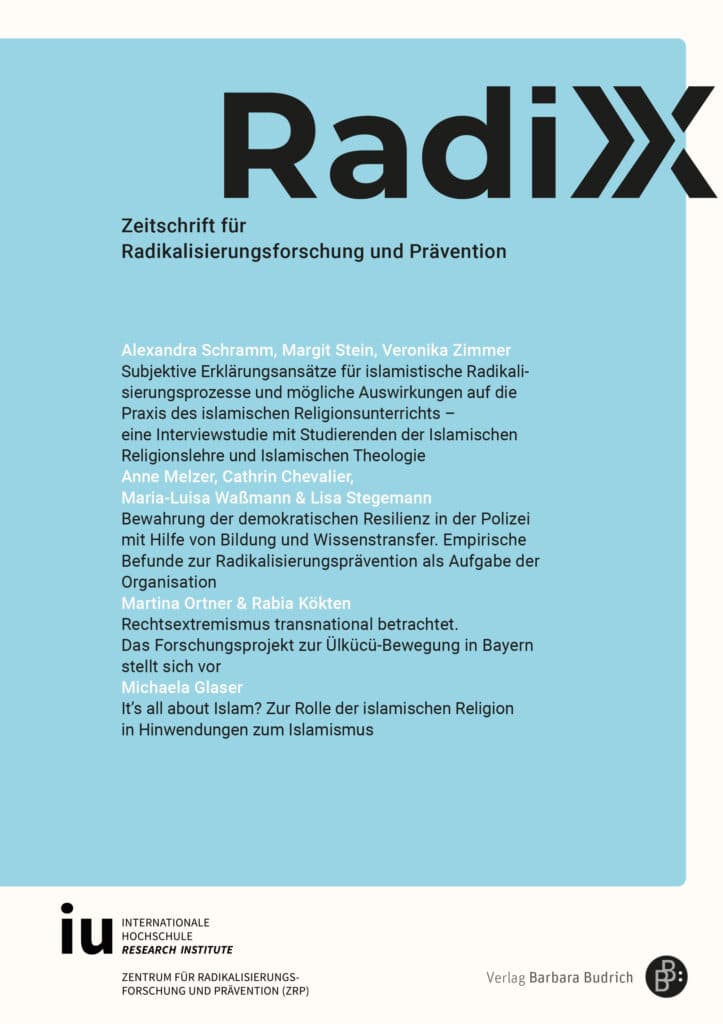



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.