Informationen zum Buch
Startseite » Programm » An den Nationalsozialismus erinnern
An den Nationalsozialismus erinnern
Entwicklung der Erinnerungskultur und zukünftige Perspektiven. Ein Essay
Erscheinungsdatum : 04.09.2023
11,99 € - 13,00 €
Beschreibung
Was war der Holocaust damals und wie wirkt der Holocaust heute noch? Harry Friebel betrachtet den Themenkomplex „Erinnerungskultur“ aus einer interdisziplinären Perspektive und untersucht Motivationen, Bedeutungen und Interessenlagen auf verschiedenen Ebenen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Wechselseitigkeit von Täter- und Opferperspektive innerhalb der NS-Diktatur und im Leben der Nachkommen in einer multikulturellen Moderne gewidmet. Abschließend diskutiert der Autor die Frage, wie eine Erinnerungskultur für die Zukunft aussehen kann.
Das Buch lädt auch ein zu einem Diskurs über intergenerationelle Weitergaben der latenten Wirkungskräfte des Nationalsozialismus. Die Kinder und die Enkelkinder der im 2. Weltkrieg durch den Faschismus geprägten Geburtskohorten treten eine immaterielle Erbschaft in Form von „Gefühlserbschaften“ an: Diese „Erbschaften“ prägen die Lebensläufe der Nachkommen – dafür brauchen wir ein Verständnis, um NS- Erinnerungsarbeit erfolgreich zu gestalten.
Dazu öffnen wir uns sowohl für die Logik der Subjekte (Individuen gestalten ihr eigenes Leben auf der Grundlage ihrer Entscheidungen und Handlungen innerhalb ihrer eigenen Möglichkeiten) als auch für die Logik der Gelegenheitsstrukturen (Der Lebenslauf der Individuen ist sowohl eingebettet als auch berührt durch die historische Zeit und ihre Ereignisse) – von damals und von heute. Die NS- Diktatur und NS-Erinnerung müssen also doppelt gelesen werden: Sowohl in der Subjekt- als auch in der Strukturperspektive.
Inhaltsverzeichnis + Leseprobe
Der Autor:
Prof. em. Dr. Harry Friebel, Fachbereich Erziehungswissenschaft, Universität Hamburg und Evangelische Hochschule „Rauhes Haus“, Hamburg
Hier finden Sie den Waschzettel zum Buch (PDF-Infoblatt).
Die Fachbereiche:
Erziehungswissenschaft, Soziologie, Soziale Arbeit
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISBN | 978-3-8474-2739-1 |
| eISBN | 978-3-8474-1909-9 |
| Format | 12,0 x 18,5 cm |
| Umfang | 99 |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Erscheinungsdatum | 04.09.2023 |
| Auflage | 1. |
| Sprache | Deutsch |
2 Bewertungen für An den Nationalsozialismus erinnern
Autor*innen
Schlagwörter2. Weltkrieg, Eltern, Erinnerung, Gefühlsbotschaften, Generationen, Großeltern, Holocaust, intergenerationelle Wirkprozesse, Nationalsozialismus, Nazis, NS-Erinnerungskultur, Opfer, Schuld, Schwerpunkt Demokratie und Vielfalt, Theoriekonzepte, Trauma, Täter, Täter- und Opferperspektive, Zweiter Weltkrieg
Pressestimmen
Mir gefallen H. Friebels gedankliche Brückenschläge wie z. B. Subjekt-Logik versus Gelegenheitsstrukturen, Vergangenheitsvergegenwärtigung, Doppelstruktur von Wissen und Nicht-Wissen, Beschweigen, intergenerationales Nachbeben. Hilfreich ist seine Unterscheidung des Erinnerns an die NS-Zeit nach gesellschaftlichem, institutionellem und individuellem Erinnern. Dieses Erinnern ist in Deutschland auf allen drei Ebenen zunächst einmal unangenehm und bedarf des mutigen Arbeitens im Unliebsamen, des mutigen Verzichts auf Verleugnung, Verdrängung und Beschweigen.
Ingegerd Schäuble, Kontext, Heft 2/2024
Die Seiten des schmalen Buches drohen vor lauter Bezügen, Belegen und Fußnoten nahezu zu platzen, aber Harry Friebel verliert nie den Bezug zu seinen Leitfragen. Auch der persönliche Ton und die klare Haltung machen das Essay zu einem sehr lesenswerten Werk mit spannenden Herangehensweisen und Verknüpfungen.
Ronja Inhoff, Außerschulische Bildung, 2/2024
Jenseits aller unterschiedlichen Interpretationen, Sicht- und Herangehensweisen in Hinblick auf die Aufarbeitung der von Deutschen begangenen Verbrechen vermittelt Friebel in seinem Buch die zentrale Botschaft: »Wenn die Wirkmächtigkeit des NS-Terrorregimes von 1933 bis 1945 auch heute noch (…) weiter deutlich aufspürbar ist, dann sagt uns das: Gestern ist auch morgen!« (S. 77) Damit meint er eben nicht nur die Aufarbeitung in einem allgemeinen politischen Kontext, sondern die Herausforderung jedes Einzelnen, sich seiner Familiengeschichte zu stellen.
Joachim Geffers, hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2024
Der Essay ist eine dicht geschriebene Vergegenwärtigung der bisherigen Erinnerungskultur und ein nachdrückliches Plädoyer über eine zukünftige nachzudenken. Die NS-Zeit als Bildungsauftrag im Gedächtnis zu behalten – und hier vor allem auch im familienbiografischen – und sie weiterhin öffentlich zu machen, ist die Kernbotschaft seines Essays.
Benno Hafeneger, Journal für Politische Bildung, 1-2024
Das Büchlein thematisiert die in vielerlei Hinsicht misslungene NS-Vergangenheitsbewältigung, die in der Bundesrepublik nach 1945 zur Pflichtveranstaltung wurde, die aber nicht wirklich als breite zivilgesellschaftliche Aktivität oder als allgemeine Änderung des Geschichtsbewusstsein zur Geltung kam. […] Als Sammlung von Denkanstößen und sachdienlichen Hinweisen kann das Buch […] zur Einführung in den Themenkomplex genutzt werden.
Johannes Schillo auf socialnet, 9.11.2023
Beschreibung
Beschreibung
Was war der Holocaust damals und wie wirkt der Holocaust heute noch? Harry Friebel betrachtet den Themenkomplex „Erinnerungskultur“ aus einer interdisziplinären Perspektive und untersucht Motivationen, Bedeutungen und Interessenlagen auf verschiedenen Ebenen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Wechselseitigkeit von Täter- und Opferperspektive innerhalb der NS-Diktatur und im Leben der Nachkommen in einer multikulturellen Moderne gewidmet. Abschließend diskutiert der Autor die Frage, wie eine Erinnerungskultur für die Zukunft aussehen kann.
Das Buch lädt auch ein zu einem Diskurs über intergenerationelle Weitergaben der latenten Wirkungskräfte des Nationalsozialismus. Die Kinder und die Enkelkinder der im 2. Weltkrieg durch den Faschismus geprägten Geburtskohorten treten eine immaterielle Erbschaft in Form von „Gefühlserbschaften“ an: Diese „Erbschaften“ prägen die Lebensläufe der Nachkommen – dafür brauchen wir ein Verständnis, um NS- Erinnerungsarbeit erfolgreich zu gestalten.
Dazu öffnen wir uns sowohl für die Logik der Subjekte (Individuen gestalten ihr eigenes Leben auf der Grundlage ihrer Entscheidungen und Handlungen innerhalb ihrer eigenen Möglichkeiten) als auch für die Logik der Gelegenheitsstrukturen (Der Lebenslauf der Individuen ist sowohl eingebettet als auch berührt durch die historische Zeit und ihre Ereignisse) – von damals und von heute. Die NS- Diktatur und NS-Erinnerung müssen also doppelt gelesen werden: Sowohl in der Subjekt- als auch in der Strukturperspektive.
Inhaltsverzeichnis + Leseprobe
Der Autor:
Prof. em. Dr. Harry Friebel, Fachbereich Erziehungswissenschaft, Universität Hamburg und Evangelische Hochschule „Rauhes Haus“, Hamburg
Hier finden Sie den Waschzettel zum Buch (PDF-Infoblatt).
Die Fachbereiche:
Erziehungswissenschaft, Soziologie, Soziale Arbeit
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISBN | 978-3-8474-2739-1 |
| eISBN | 978-3-8474-1909-9 |
| Format | 12,0 x 18,5 cm |
| Umfang | 99 |
| Erscheinungsjahr | 2023 |
| Erscheinungsdatum | 04.09.2023 |
| Auflage | 1. |
| Sprache | Deutsch |
Produktsicherheit
Bewertungen (2)
2 Bewertungen für An den Nationalsozialismus erinnern
-
Bewertet mit 5 von 5
Ingegerd Schäuble, Dipl.-Soziologin Supervisorin DGSv, München –
Gerade in einer Zeit, in der so viele Menschen die kriegerische Auseinandersetzung dem friedlichen Austausch und Ringen vorziehen, sind die Gedanken Harry Friebels umso wichtiger: Krieg und Gewalt mögen als Ausdruck einer Gefühlslage eine gewisse momentane Entlastung versprechen. Menschen müssen aber danach auch mit den (Langzeit-)Folgen ihres Tuns/ ihres Denkens/ ihres Fühlens irgendwie klar kommen – im eigenen Innern wie auch in der Außenwelt. Wie belastend und langwierig das ist und welche persönlichen, institutionellen und gesamtgesellschaftlichen Implikationen das hat, stellt Harry Friebel in seinem Essay eindrücklich dar. Es lohnt, diesen Essay sehr sorgfältig zu lesen – er bezieht sich explizit auf die deutsche Erinnerungskultur hinsichtlich des Nationalsozialismus, Gültigkeit haben die Gedanken aber auch für jede andere Epoche und jede kollektive Haltung.
-
Bewertet mit 2 von 5
Laila Riedmiller –
Harry Friebel strebt in diesem knappen Essay an, „auf Verschränkungen von individueller und kollektiver Problematik, auf den Zusammenhang von NS-Geschichte und Gegenwart, auf die Perspektiven der Täter und Opfer“ (S. 8) hinzuweisen und sich mit einer möglichen, besseren Erinnerungskultur auseinanderzusetzen. Dass all dies auf unter 100 Seiten in einem kleinformatigen Buch nur unvollständig passieren kann, macht er direkt zu Beginn deutlich. Zweifelsohne behandelt er ein relevantes Thema und die Auseinandersetzung mit diesem ist wichtig. Gleichzeitig sind gerade in den letzten Jahren unzählige qualitativ unterschiedlich überzeugende Publikationen zum Thema erschienen, weshalb sich Veröffentlichungen zu dem Thema auch daran messen lassen sollten, (1) mit welcher Absicht und welchem Zielpublikum vor Augen sie geschrieben sind, (2) welche Impulse durch den Kontext der jeweiligen Autor*innen geliefert werden können und (3) inwiefern der aktuelle Forschungsstand abgedeckt ist und darauf Bezug genommen wird.
Mich persönlich konnte Friebel leider nicht überzeugen und an den genannten drei Punkten möchte ich dies ausführen.1. Das Verhältnis von Text und Zitaten scheint mir unausgewogen. So liest sich der Essay auf vielen Seiten eher wie das Ergebnis einer Literaturrecherche, bei dem auf beinah jeder Doppelseite lange eingerückte Zitate zu finden sind. Wer sich mit dem Thema bereits befasst hat und etwa die Arbeiten der Mitscherlichs kennt, kann hier getrost einige Seiten überspringen. Wer die zugrundeliegende Literatur noch gar nicht kennt, kann ggf. die Auswahl der Texte und die daraus entstehenden Lücken nicht ausreichend bewerten. Gleichzeitig ist der Literaturbezug aufgrund der Kürze des Essays nur sehr knapp, weshalb er notwendig unvollständig bleibt. Hier hätte ich mir dann entsprechend des Essayformats eine stärkere Gewichtung zugunsten eigener Analyseergebnisse gewünscht – oder aber ein anderes Format, in dem genug Platz ist für eine dann auch tatsächlich vollständigere Abbildung des Forschungsstandes ebenso wie für umfassendere Ausführungen Friebels, dessen Forschungsprofil auf spannende Analyseergebnisse im Rahmen einer umfassenderen Arbeit schließen lässt. Aufgrund der vielen Zitate empfand ich den Essay daher insgesamt als wenig abgerundet, vor allem, da im Kontrast dazu in vielen Fußnoten sehr persönliche Kommentare abgegeben und Erlebnisse geschildert werden, die m.E. viel prominenter in den Haupttext hätten verlagert werden können. Der unvollständige Zugriff auf unterschiedliche Literatur kann, so meine Sorge, gerade Einsteiger*innen ins Thema tendenziell verwirren. Dem Fazit zufolge geht es Friebel darum, seine Leser*innen zu erinnerungskultureller Gruppenarbeit zu motivieren und diese Arbeit auf Nachfrage auch persönlich zu begleiten, wobei er aber keine weiteren Informationen über seine damit verbundene (bspw. pädagogische) Kompetenz offenlegt. Ich unterstelle ihm keinesfalls, dass dies seine Absicht war, sondern dass das Angebot ehrlichen moralischen Verpflichtungsgefühlen entspringt. Aber zumindest bei mir bleibt dadurch ein gewisses Gefühl, dass das Buch (auch) der Selbstwerbung dient.
2. Friebel ist Soziologe mit einem Fokus (laut Wikipedia) u.a. auf Bildungs- und Sozialisationstheorie, Biographieforschung und Geschlechterforschung. Aus dieser Perspektive ist es naheliegend und spannend, sich mit der Verbindung individueller Biographien und kollektiven Erinnerns zu befassen. Durch den Rückgriff auf unterschiedliche Autobiographien von Nachkommen der Opfer sowie der Täter des Holocaust gelingt es ihm, die intergenerationalen Verstrickungen herauszustellen und zu betonen, wie wichtig eine Aufarbeitung ist. Allerdings hätte ich mir gerade hier einen stärkeren Bezug auf die politische Ebene erhofft, der beim Thema Nationalsozialismus fundamental ist. Zwar ist es relevant, auf die psychosozialen Folgen der mit dem Schweigen konfrontierten Nachkriegsgeneration hinzuweisen und die moralische Zerreißprobe zu schildern, vor der die Kinder stehen. Allerdings führt ein derart starker Fokus auf Traumatisierung und moralische Kritik schnell zu einer Depolitisierung des Nationalsozialismus. Ich halte es methodisch für schwierig, hier die Täter- und Opferseite relativ gleichberechtigt nebeneinander zu verhandeln. Denn während es für die Nachkommen der Verfolgten und Getöteten essentiell ist, die intergenerationalen Traumata aufzuarbeiten, liegt es in der Verantwortung der Tätergeneration und ihrer Nachkommen, ihre Verantwortung und aktive und ideologisch überzeugte Beteiligung an der Vernichtung aufzuarbeiten. Ein zu starker Fokus auf die psychosozialen und traumatisierenden Folgen des Nationalsozialismus und des Verschweigens auf Täterseite suggeriert eine Opferposition, wenn sie nicht mit dem historischen Kontext und der Betonung der politischen und ideologischen Überzeugung für den Nationalsozialismus verbunden wird. Zwar bezieht sich Friebel an vielen Stellen auf die Arbeiten bspw. von Harald Welzer. Der starke Fokus auf die psychische Belastung auch von Täter*innen-Nachkommen hätte in meinen Augen aber besser kontextualisiert werden müssen, was in diesem schmalen Format kaum gelingt.
3. Wie schon erwähnt, sind zum Thema der Erinnerungskultur in den vergangenen Jahren, insbesondere vor dem Hintergrund des „Historikerstreits 2.0“, viele Bücher herausgekommen. Einige davon werden forschungsintern kontrovers diskutiert. So stehen sich beispielsweise Michael Rothbergs Konzept des „multidirektionalen Erinnerns“ und die Kritik an diesem (bspw. von Dan Diner oder Steffen Klävers) gegenüber. Auch die Autorin Charlotte Wiedemann ist, ebenso wie ihr Buch „Den Schmerz der Anderen begreifen“, umstritten. Das bedeutet nicht, dass man auf die Autor*innen nicht verweisen kann, es fällt allerdings auf, dass Friebel der Heterogenität der gegenwärtigen Holocaustforschung und den erbitterten Auseinandersetzungen um Formen des Erinnerns keinerlei Beachtung schenkt und seine Bezugnahme auf diese kulturwissenschaftlich geprägte Strömung nicht kontextualisiert. Da es der explizite Anspruch des Autors ist, eine „Erinnerungskultur für die Zukunft“ (Klappentext) zu entwerfen, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie eine solche Erinnerungskultur inhaltlich aussehen kann. Und hier ist die nicht transparent begründete Übernahme einer Forschungstradition, die sich dem Vorwurf einer Gleichsetzung von Antisemitismus und Rassismus und einer mindestens unbeabsichtigten Relativierung des Holocaust vor dem Hintergrund andere globaler Verbrechen wie dem Kolonialismus ausgesetzt sieht, mindestens problematisch. Hier wäre eine sorgfältigere und vollständigere Auseinandersetzung mit den aktuellen Debatten gewinnbringend und nötig gewesen, um die spezifische Relevanz der individuellen familiengeschichtlichen Aufarbeitung im Kontext dieses Konflikts zu betonen.
Denn, so mein Fazit: Der Forschungshintergrund von Friebel hat das Potential, die forschungsseitig geäußerte Kritik an einer mangelnden Aufarbeitung individueller Täterschaft und der Auswirkungen ebendieser auf die Nachfolgegenerationen produktiv zu wenden. Soll eine solche biografisch orientierte Aufarbeitung aber auch eine politisch-emanzipatorische Ebene haben, den noch immer bestehenden Rassismus und Antisemitismus überwinden und nicht nur bestehende psychische Konflikte befrieden, so ist für ein solches Projekt die tiefgehende Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Zielsetzungen von Erinnerungskultur und den sich daraus jeweils ergebenden Schwierigkeiten nötig. Dies jedoch gelingt Friebel im vorliegenden Essay nicht, weshalb ich zwar die Intention begrüße, von der Umsetzung aber leider nicht überzeugt bin.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
Schlagwörter2. Weltkrieg, Eltern, Erinnerung, Gefühlsbotschaften, Generationen, Großeltern, Holocaust, intergenerationelle Wirkprozesse, Nationalsozialismus, Nazis, NS-Erinnerungskultur, Opfer, Schuld, Schwerpunkt Demokratie und Vielfalt, Theoriekonzepte, Trauma, Täter, Täter- und Opferperspektive, Zweiter Weltkrieg
Pressestimmen
Pressestimmen
Mir gefallen H. Friebels gedankliche Brückenschläge wie z. B. Subjekt-Logik versus Gelegenheitsstrukturen, Vergangenheitsvergegenwärtigung, Doppelstruktur von Wissen und Nicht-Wissen, Beschweigen, intergenerationales Nachbeben. Hilfreich ist seine Unterscheidung des Erinnerns an die NS-Zeit nach gesellschaftlichem, institutionellem und individuellem Erinnern. Dieses Erinnern ist in Deutschland auf allen drei Ebenen zunächst einmal unangenehm und bedarf des mutigen Arbeitens im Unliebsamen, des mutigen Verzichts auf Verleugnung, Verdrängung und Beschweigen.
Ingegerd Schäuble, Kontext, Heft 2/2024
Die Seiten des schmalen Buches drohen vor lauter Bezügen, Belegen und Fußnoten nahezu zu platzen, aber Harry Friebel verliert nie den Bezug zu seinen Leitfragen. Auch der persönliche Ton und die klare Haltung machen das Essay zu einem sehr lesenswerten Werk mit spannenden Herangehensweisen und Verknüpfungen.
Ronja Inhoff, Außerschulische Bildung, 2/2024
Jenseits aller unterschiedlichen Interpretationen, Sicht- und Herangehensweisen in Hinblick auf die Aufarbeitung der von Deutschen begangenen Verbrechen vermittelt Friebel in seinem Buch die zentrale Botschaft: »Wenn die Wirkmächtigkeit des NS-Terrorregimes von 1933 bis 1945 auch heute noch (…) weiter deutlich aufspürbar ist, dann sagt uns das: Gestern ist auch morgen!« (S. 77) Damit meint er eben nicht nur die Aufarbeitung in einem allgemeinen politischen Kontext, sondern die Herausforderung jedes Einzelnen, sich seiner Familiengeschichte zu stellen.
Joachim Geffers, hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2024
Der Essay ist eine dicht geschriebene Vergegenwärtigung der bisherigen Erinnerungskultur und ein nachdrückliches Plädoyer über eine zukünftige nachzudenken. Die NS-Zeit als Bildungsauftrag im Gedächtnis zu behalten – und hier vor allem auch im familienbiografischen – und sie weiterhin öffentlich zu machen, ist die Kernbotschaft seines Essays.
Benno Hafeneger, Journal für Politische Bildung, 1-2024
Das Büchlein thematisiert die in vielerlei Hinsicht misslungene NS-Vergangenheitsbewältigung, die in der Bundesrepublik nach 1945 zur Pflichtveranstaltung wurde, die aber nicht wirklich als breite zivilgesellschaftliche Aktivität oder als allgemeine Änderung des Geschichtsbewusstsein zur Geltung kam. […] Als Sammlung von Denkanstößen und sachdienlichen Hinweisen kann das Buch […] zur Einführung in den Themenkomplex genutzt werden.
Johannes Schillo auf socialnet, 9.11.2023




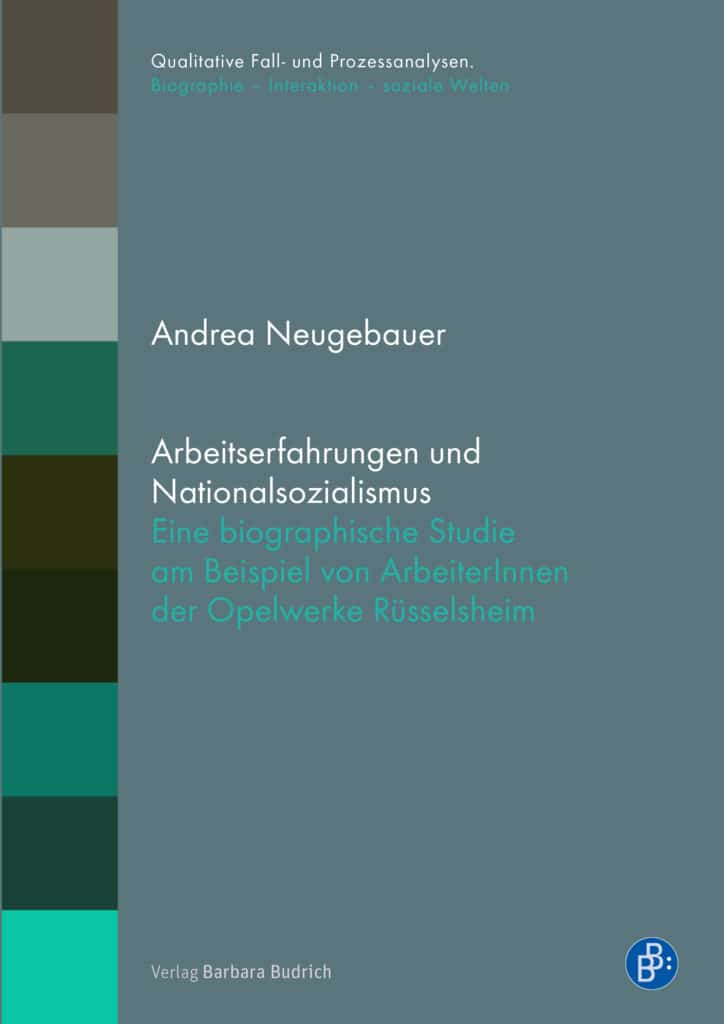

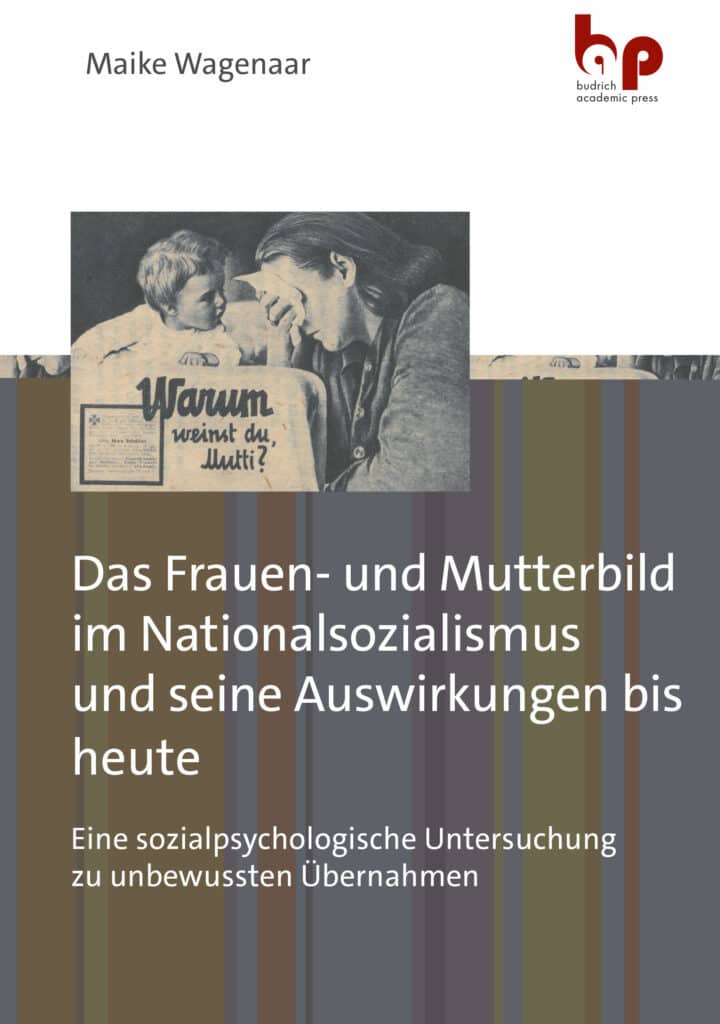


Ingegerd Schäuble, Dipl.-Soziologin Supervisorin DGSv, München –
Gerade in einer Zeit, in der so viele Menschen die kriegerische Auseinandersetzung dem friedlichen Austausch und Ringen vorziehen, sind die Gedanken Harry Friebels umso wichtiger: Krieg und Gewalt mögen als Ausdruck einer Gefühlslage eine gewisse momentane Entlastung versprechen. Menschen müssen aber danach auch mit den (Langzeit-)Folgen ihres Tuns/ ihres Denkens/ ihres Fühlens irgendwie klar kommen – im eigenen Innern wie auch in der Außenwelt. Wie belastend und langwierig das ist und welche persönlichen, institutionellen und gesamtgesellschaftlichen Implikationen das hat, stellt Harry Friebel in seinem Essay eindrücklich dar. Es lohnt, diesen Essay sehr sorgfältig zu lesen – er bezieht sich explizit auf die deutsche Erinnerungskultur hinsichtlich des Nationalsozialismus, Gültigkeit haben die Gedanken aber auch für jede andere Epoche und jede kollektive Haltung.
Laila Riedmiller –
Harry Friebel strebt in diesem knappen Essay an, „auf Verschränkungen von individueller und kollektiver Problematik, auf den Zusammenhang von NS-Geschichte und Gegenwart, auf die Perspektiven der Täter und Opfer“ (S. 8) hinzuweisen und sich mit einer möglichen, besseren Erinnerungskultur auseinanderzusetzen. Dass all dies auf unter 100 Seiten in einem kleinformatigen Buch nur unvollständig passieren kann, macht er direkt zu Beginn deutlich. Zweifelsohne behandelt er ein relevantes Thema und die Auseinandersetzung mit diesem ist wichtig. Gleichzeitig sind gerade in den letzten Jahren unzählige qualitativ unterschiedlich überzeugende Publikationen zum Thema erschienen, weshalb sich Veröffentlichungen zu dem Thema auch daran messen lassen sollten, (1) mit welcher Absicht und welchem Zielpublikum vor Augen sie geschrieben sind, (2) welche Impulse durch den Kontext der jeweiligen Autor*innen geliefert werden können und (3) inwiefern der aktuelle Forschungsstand abgedeckt ist und darauf Bezug genommen wird.
Mich persönlich konnte Friebel leider nicht überzeugen und an den genannten drei Punkten möchte ich dies ausführen.
1. Das Verhältnis von Text und Zitaten scheint mir unausgewogen. So liest sich der Essay auf vielen Seiten eher wie das Ergebnis einer Literaturrecherche, bei dem auf beinah jeder Doppelseite lange eingerückte Zitate zu finden sind. Wer sich mit dem Thema bereits befasst hat und etwa die Arbeiten der Mitscherlichs kennt, kann hier getrost einige Seiten überspringen. Wer die zugrundeliegende Literatur noch gar nicht kennt, kann ggf. die Auswahl der Texte und die daraus entstehenden Lücken nicht ausreichend bewerten. Gleichzeitig ist der Literaturbezug aufgrund der Kürze des Essays nur sehr knapp, weshalb er notwendig unvollständig bleibt. Hier hätte ich mir dann entsprechend des Essayformats eine stärkere Gewichtung zugunsten eigener Analyseergebnisse gewünscht – oder aber ein anderes Format, in dem genug Platz ist für eine dann auch tatsächlich vollständigere Abbildung des Forschungsstandes ebenso wie für umfassendere Ausführungen Friebels, dessen Forschungsprofil auf spannende Analyseergebnisse im Rahmen einer umfassenderen Arbeit schließen lässt. Aufgrund der vielen Zitate empfand ich den Essay daher insgesamt als wenig abgerundet, vor allem, da im Kontrast dazu in vielen Fußnoten sehr persönliche Kommentare abgegeben und Erlebnisse geschildert werden, die m.E. viel prominenter in den Haupttext hätten verlagert werden können. Der unvollständige Zugriff auf unterschiedliche Literatur kann, so meine Sorge, gerade Einsteiger*innen ins Thema tendenziell verwirren. Dem Fazit zufolge geht es Friebel darum, seine Leser*innen zu erinnerungskultureller Gruppenarbeit zu motivieren und diese Arbeit auf Nachfrage auch persönlich zu begleiten, wobei er aber keine weiteren Informationen über seine damit verbundene (bspw. pädagogische) Kompetenz offenlegt. Ich unterstelle ihm keinesfalls, dass dies seine Absicht war, sondern dass das Angebot ehrlichen moralischen Verpflichtungsgefühlen entspringt. Aber zumindest bei mir bleibt dadurch ein gewisses Gefühl, dass das Buch (auch) der Selbstwerbung dient.
2. Friebel ist Soziologe mit einem Fokus (laut Wikipedia) u.a. auf Bildungs- und Sozialisationstheorie, Biographieforschung und Geschlechterforschung. Aus dieser Perspektive ist es naheliegend und spannend, sich mit der Verbindung individueller Biographien und kollektiven Erinnerns zu befassen. Durch den Rückgriff auf unterschiedliche Autobiographien von Nachkommen der Opfer sowie der Täter des Holocaust gelingt es ihm, die intergenerationalen Verstrickungen herauszustellen und zu betonen, wie wichtig eine Aufarbeitung ist. Allerdings hätte ich mir gerade hier einen stärkeren Bezug auf die politische Ebene erhofft, der beim Thema Nationalsozialismus fundamental ist. Zwar ist es relevant, auf die psychosozialen Folgen der mit dem Schweigen konfrontierten Nachkriegsgeneration hinzuweisen und die moralische Zerreißprobe zu schildern, vor der die Kinder stehen. Allerdings führt ein derart starker Fokus auf Traumatisierung und moralische Kritik schnell zu einer Depolitisierung des Nationalsozialismus. Ich halte es methodisch für schwierig, hier die Täter- und Opferseite relativ gleichberechtigt nebeneinander zu verhandeln. Denn während es für die Nachkommen der Verfolgten und Getöteten essentiell ist, die intergenerationalen Traumata aufzuarbeiten, liegt es in der Verantwortung der Tätergeneration und ihrer Nachkommen, ihre Verantwortung und aktive und ideologisch überzeugte Beteiligung an der Vernichtung aufzuarbeiten. Ein zu starker Fokus auf die psychosozialen und traumatisierenden Folgen des Nationalsozialismus und des Verschweigens auf Täterseite suggeriert eine Opferposition, wenn sie nicht mit dem historischen Kontext und der Betonung der politischen und ideologischen Überzeugung für den Nationalsozialismus verbunden wird. Zwar bezieht sich Friebel an vielen Stellen auf die Arbeiten bspw. von Harald Welzer. Der starke Fokus auf die psychische Belastung auch von Täter*innen-Nachkommen hätte in meinen Augen aber besser kontextualisiert werden müssen, was in diesem schmalen Format kaum gelingt.
3. Wie schon erwähnt, sind zum Thema der Erinnerungskultur in den vergangenen Jahren, insbesondere vor dem Hintergrund des „Historikerstreits 2.0“, viele Bücher herausgekommen. Einige davon werden forschungsintern kontrovers diskutiert. So stehen sich beispielsweise Michael Rothbergs Konzept des „multidirektionalen Erinnerns“ und die Kritik an diesem (bspw. von Dan Diner oder Steffen Klävers) gegenüber. Auch die Autorin Charlotte Wiedemann ist, ebenso wie ihr Buch „Den Schmerz der Anderen begreifen“, umstritten. Das bedeutet nicht, dass man auf die Autor*innen nicht verweisen kann, es fällt allerdings auf, dass Friebel der Heterogenität der gegenwärtigen Holocaustforschung und den erbitterten Auseinandersetzungen um Formen des Erinnerns keinerlei Beachtung schenkt und seine Bezugnahme auf diese kulturwissenschaftlich geprägte Strömung nicht kontextualisiert. Da es der explizite Anspruch des Autors ist, eine „Erinnerungskultur für die Zukunft“ (Klappentext) zu entwerfen, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie eine solche Erinnerungskultur inhaltlich aussehen kann. Und hier ist die nicht transparent begründete Übernahme einer Forschungstradition, die sich dem Vorwurf einer Gleichsetzung von Antisemitismus und Rassismus und einer mindestens unbeabsichtigten Relativierung des Holocaust vor dem Hintergrund andere globaler Verbrechen wie dem Kolonialismus ausgesetzt sieht, mindestens problematisch. Hier wäre eine sorgfältigere und vollständigere Auseinandersetzung mit den aktuellen Debatten gewinnbringend und nötig gewesen, um die spezifische Relevanz der individuellen familiengeschichtlichen Aufarbeitung im Kontext dieses Konflikts zu betonen.
Denn, so mein Fazit: Der Forschungshintergrund von Friebel hat das Potential, die forschungsseitig geäußerte Kritik an einer mangelnden Aufarbeitung individueller Täterschaft und der Auswirkungen ebendieser auf die Nachfolgegenerationen produktiv zu wenden. Soll eine solche biografisch orientierte Aufarbeitung aber auch eine politisch-emanzipatorische Ebene haben, den noch immer bestehenden Rassismus und Antisemitismus überwinden und nicht nur bestehende psychische Konflikte befrieden, so ist für ein solches Projekt die tiefgehende Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Zielsetzungen von Erinnerungskultur und den sich daraus jeweils ergebenden Schwierigkeiten nötig. Dies jedoch gelingt Friebel im vorliegenden Essay nicht, weshalb ich zwar die Intention begrüße, von der Umsetzung aber leider nicht überzeugt bin.