Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » Diskurs 1-2025 | Gesundheit des pädagogischen Personals und Auswirkungen auf Heranwachsende in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Diskurs 1-2025 | Gesundheit des pädagogischen Personals und Auswirkungen auf Heranwachsende in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Erscheinungsdatum : 18.03.2025
22,00 €
- Inhalt
- Bibliografie
- Produktsicherheit
- Zusatzmaterial
- Bewertungen (0)
- Autor*innen
- Schlagwörter
- Abstracts
Inhalt
Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research
1-2025: Gesundheit des pädagogischen Personals und Auswirkungen auf Heranwachsende in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Editorial
Andrea G. Eckhardt / Maike Rönnau-Böse / Matthias Schmidt: Gesundheit des pädagogischen Personals und Auswirkungen auf Heranwachsende in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Schwerpunktbeiträge
Alfons Hollederer / Ines Dieckmännken: Arbeit und Gesundheit von Erwerbstätigen in Kindertageseinrichtungen in Deutschland: Ergebnisse des Mikrozensus 2021
Andy Schieler: Gesund bleiben in der Kita: Was Kita-Fachkräfte aus Sicht der Kita-Leitung belastet und gesund hält. Ergebnisse der DKLK-Studie 2022
Regina Remsperger-Kehm: Wenn Stress zu Verletzung führt – Verletzendes Verhalten gegenüber Kita-Kindern verstehen und verhindern
Freie Beiträge
Laura von Albedyhll / Teresa Vielstädte: Das ‚gute Kindergartenkind‘ und die ‚gute Fachkraft‘ – Praxistheoretische Perspektiven auf die Bearbeitung kindheitspädagogischer Normen
Manfred Liebel: Haben Schwarze Kinder (k)eine Kindheit? Anmerkungen zur Adultification-Debatte in den USA
Eric van Santen / Andreas Herz: Die Integrationskraft der Angebote der offenen und verbandlichen Jugendarbeit – Empirische Hinweise
Kurzbeitrag
Theresia Gabriele Hummel / Kristina Hausladen: „Do it digital and healthy!“ – Eine Fortbildungsmaßnahme zur Förderung der psychischen Gesundheit frühpädagogischen Bildungspersonals
Mathias Albert / Gudrun Quenzel / Ulrich Schneekloth: Die 19. Shell Jugendstudie – Pragmatisch zwischen Verdrossenheit und gelebter Vielfalt
Rezension
Jens Ostwaldt: Langner, Joachim, Zschach, Maren, Schott, Marco & Weigelt, Ina (Hrsg.) (2023). Jugend und islamistischer Extremismus. Pädagogik im Spannungsfeld von Radikalisierung und Distanzierung
Einzelbeitrags-Download (Open Access/Gebühr): diskurs.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den Diskurs-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1862-5002 |
| eISSN | 2193-9713 |
| Jahrgang | 20. Jahrgang 2025 |
| Ausgabe | 1-2025 |
| Erscheinungsdatum | 18.03.2025 |
| Umfang | 136 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Zusatzmaterial
Autor*innen
Schlagwörter19. Shell Jugendstudie, Adultifizierung, Adultismus, Arbeitsbedingungen, Arbeitsunfähigkeit, Belastung, Diskriminierung, Einbindung, Fachkraft-Kind-Interaktion, Fachkräfte, Gesundheit, Integration, Kinder- und Jugendhilfe, Kindertageseinrichtung, Kindertageseinrichtungen, Kindheit, Kindheitspädagogik, Kita-Leitung, Mikrozensus, März 2025, Normativität, offene Kinder- und Jugendarbeit, Online-Befragung, Praktiken, Prävention, Psychische Gesundheit, pädagogisches Personal, Rassismus, Schwarze Kinder, Sexismus, Stress, USA, Verbandliche Jugendarbeit, verletzendes Verhalten, Zugang
Abstracts
Arbeit und Gesundheit von Erwerbstätigen in Kindertageseinrichtungen in Deutschland: Ergebnisse des Mikrozensus 2021 (Alfons Hollederer, Ines Dieckmännken)
Erwerbstätige im Sozialwesen sind von berufsbedingten Belastungen betroffen, die die Entwicklung von psychischen und physischen Erkrankungen sowie Arbeitsunfähigkeit begünstigen. Auf Datenbasis des Mikrozensus 2021 wurde die Arbeits- und Gesundheitssituation der Erwerbstätigen im Wirtschaftszweig „Kindergärten und Vorschulen“ analysiert (N = 4.636; hochgerechnet 613.816). Es wurde ermittelt, dass Angehörige der Berufe „Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege“ in Kindergärten und Vorschulen signifikant häufiger (p < 0,001) in den letzten vier Wochen krank waren (19,4 %) als a) diese Berufsgruppe in anderen Wirtschaftszweigen (16,4 %) und b) andere Berufe (11,5 %). Gleichzeitig waren mit 45 Prozent mehr Angehörige der Berufe „Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege“ in Kindergärten und Vorschulen sehr zufrieden mit der Tätigkeit als in anderen Wirtschaftszweigen (39,5 %) und anderen Berufen (38,5 %). Es werden Implikationen für Maßnahmen der betrieblichen Gesundheit diskutiert. Schlagwörter: Arbeitsbedingungen, Arbeitsunfähigkeit, Gesundheit, Kindertageseinrichtungen, Mikrozensus
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Gesund bleiben in der Kita: Was Kita-Fachkräfte aus Sicht der Kita-Leitung belastet und gesund hält. Ergebnisse der DKLK-Studie 2022 (Andy Schieler)
Zahlreiche Befunde belegen die psychische und emotionale Erschöpfung von pädagogischen Fachkräften im Arbeitsfeld Kita. Neben den Belastungen des Fachkräftemangels sehen sich die Fachkräfte in ihrem pädagogischen Alltag mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert und sind demnach verschiedenen Belastungsfaktoren ausgesetzt. Um einen differenzierten Blick darauf zu bekommen, was Kita Fachkräfte belastet und was sie gesund hält, wurden im Rahmen der Studie des Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK-Studie) 2022 bundesweit 4.827 Kita-Leiter:innen zu Fragen der Gesundheit und Gesundheitsprävention befragt. Die Ergebnisse zeigen u. a., dass 70 Prozent der Befragten angaben, dass es in ihrer Kita kein Konzept zum Thema Gesundheit/Gesundheitsprävention für das pädagogische Fachpersonal gibt. Als stärkste gesundheitsfördernde Faktoren gaben die befragten Kita-Leiter:innen den respektvollen Umgang miteinander (93 %), die Zusammenarbeit im Team (87 %) und den Betriebssport (86 %) an; als stärkste gesundheitsgefährdende Faktoren nennen sie kranke Kinder in der Kita (95 %), Geräuschpegel (93 %) und Verwaltungsaufwand (87 %). Die DKLK-Studie 2022 leistet ihren Beitrag dazu, dass die Förderung der Gesundheit der pädagogischen Fach- und Leitungskräfte noch stärker in den Fokus der gesellschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und berufspraktischen Aufmerksamkeit gelangt. Schlagwörter: Gesundheit, Belastung, Fachkräfte, Kita-Leitung, Online-Befragung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Wenn Stress zu Verletzung führt – Verletzendes Verhalten gegenüber Kita-Kindern verstehen und Verhindern (Regina Remsperger-Kehm)
Studien zeigen, dass sich pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen Kindern gegenüber manchmal auch verletzend verhalten (Prengel, 2019; Maywald, 2019; Hildebrandt et al., 2021). Neben persönlichen und berufsbiografischen Gründen gelten stressbedingte Faktoren als Ursache für verletzendes Verhalten (Boll & Remsperger-Kehm, 2021). Die hohe und mit Stress verbundene Belastung des Kita-Personals ist seit Langem wissenschaftlich belegt (Viernickel & Voss, 2012). Ziel dieses Beitrags ist es, das wachsende Stressempfinden pädagogischer Fachkräfte in Alltagssituationen und die möglichen Auswirkungen auf einen nicht-feinfühligen Umgang mit Kindern zu beleuchten. Hierfür werden zentrale Ergebnisse der Analyse eskalierender Interaktionen zwischen Fachkräften und Kindern vorgestellt (Remsperger-Kehm & Boll, 2024). Schlagwörter: Fachkraft-Kind-Interaktion, verletzendes Verhalten, Stress, Prävention
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Das ‚gute Kindergartenkind‘ und die ‚gute Fachkraft‘ – Praxistheoretische Perspektiven auf die Bearbeitung kindheitspädagogischer Normen (Laura von Albedyhll, Teresa Vielstädte)
Normative Setzungen pädagogischen Handelns in der Kindheitspädagogik werden im vorliegenden Beitrag aus empirischer Perspektive bearbeitet. Dabei ist das Ziel anhand von zwei Studien Praktiken von frühpädagogischen Fachkräften und Kindern in Kindertageseinrichtungen exemplarisch zu beschreiben, zu vergleichen und zu kontrastieren. Diese verdeutlichen, wie Normen im Feld der Kita praktisch bearbeitet werden. In der Rekonstruktion von Alltagshandlungen entsprechen Kinder und Fachkräfte den an sie herangetragenen Anforderungen oder weisen sie zurück und können so als ‚gute‘ Fachkraft oder ‚gutes‘ Kindergartenkind sichtbar werden. Die unbelebten Dinge treten als Teil dieser Praktiken hervor und wirken auf Handlungsspielräume ein. Schlagwörter: Praktiken, Normativität, Kindheitspädagogik, Kindertageseinrichtung, Fachkraft-Kind-Interaktion
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Haben Schwarze Kinder (k)eine Kindheit? Anmerkungen zur Adultification-Debatte in den USA (Manfred Liebel)
Im Beitrag wird die anhaltende Debatte in den USA über Schwarze Kinder unter dem Stichwort „Adultification“ (Adultifizierung) diskutiert. Der Begriff dient als Konzept, um die Tatsache kritisch zu benennen, dass diese Kinder nicht „als Kinder“ mit den Eigenschaften wahrgenommen werden, die üblicherweise in Europa der Kindheit zugeschrieben werden, sondern als Menschen, die eher wie Erwachsene sind. Aufgrund ihrer rassistischen Konnotation hat diese Zuschreibung schwerwiegende, meist negative und manchmal sogar fatale Folgen für junge Menschen. Der Artikel greift diese Debatte auf, indem er verschiedene Ebenen von Adultifizierung analysiert und andere mögliche Erklärungen für rassistische Diskriminierung und Gewalt gegen Schwarze Jungen und Mädchen anbietet. Besondere Bedeutung wird der Frage beigemessen, wie Kindheit aufgefasst wird, insbesondere im Hinblick auf „Unschuld“ als vermeintlich universellem Merkmal dieser Phase oder Altersgruppe. Schlagwörter: Kindheit, Adultifizierung, Schwarze Kinder, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Adultismus, USA
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Integrationskraft der Angebote der offenen und verbandlichen Jugendarbeit – Empirische Hinweise (Eric van Santen, Andreas Herz)
Offene und verbandliche Jugendarbeit sind Angebote, die gemäß ihrem Selbstverständnis für alle jungen Menschen bereitstehen und nicht sozial selektiv sind. Im Beitrag wird die Integrationskraft der Felder der Jugendarbeit im Hinblick auf zwei Schwellen untersucht: 1. Wer nutzt die Angebote? – (Zugang). 2. Wer ist über diese Nutzung zeitlich umfangreicher gebunden oder engagiert? – (Einbindung). Auf der Grundlage des AID:A 2019 Survey zeigt sich für 12- bis 27-Jährige, dass für beide Schwellen und beide Felder das Alter der jungen Menschen relevant ist. Geschlecht, Bildung ebenso wie Deprivation im Haushalt stellen für den Zugang aber nicht für die Einbindung eine Selektion dar, wobei die Effekte in den Feldern z. T. unterschiedlich sind. Ohne Eltern und in städtischen Regionen leben, stellt eine Hürde im Zugang zur offenen Jugendarbeit sowie Migrationshintergrund für den Zugang und die Einbindung in der verbandlichen Jugendarbeit dar. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse wird die Integrationskraft der Felder diskutiert. Schlagwörter: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Verbandliche Jugendarbeit, Integration, Zugang, Einbindung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research
1-2025: Gesundheit des pädagogischen Personals und Auswirkungen auf Heranwachsende in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Editorial
Andrea G. Eckhardt / Maike Rönnau-Böse / Matthias Schmidt: Gesundheit des pädagogischen Personals und Auswirkungen auf Heranwachsende in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe
Schwerpunktbeiträge
Alfons Hollederer / Ines Dieckmännken: Arbeit und Gesundheit von Erwerbstätigen in Kindertageseinrichtungen in Deutschland: Ergebnisse des Mikrozensus 2021
Andy Schieler: Gesund bleiben in der Kita: Was Kita-Fachkräfte aus Sicht der Kita-Leitung belastet und gesund hält. Ergebnisse der DKLK-Studie 2022
Regina Remsperger-Kehm: Wenn Stress zu Verletzung führt – Verletzendes Verhalten gegenüber Kita-Kindern verstehen und verhindern
Freie Beiträge
Laura von Albedyhll / Teresa Vielstädte: Das ‚gute Kindergartenkind‘ und die ‚gute Fachkraft‘ – Praxistheoretische Perspektiven auf die Bearbeitung kindheitspädagogischer Normen
Manfred Liebel: Haben Schwarze Kinder (k)eine Kindheit? Anmerkungen zur Adultification-Debatte in den USA
Eric van Santen / Andreas Herz: Die Integrationskraft der Angebote der offenen und verbandlichen Jugendarbeit – Empirische Hinweise
Kurzbeitrag
Theresia Gabriele Hummel / Kristina Hausladen: „Do it digital and healthy!“ – Eine Fortbildungsmaßnahme zur Förderung der psychischen Gesundheit frühpädagogischen Bildungspersonals
Mathias Albert / Gudrun Quenzel / Ulrich Schneekloth: Die 19. Shell Jugendstudie – Pragmatisch zwischen Verdrossenheit und gelebter Vielfalt
Rezension
Jens Ostwaldt: Langner, Joachim, Zschach, Maren, Schott, Marco & Weigelt, Ina (Hrsg.) (2023). Jugend und islamistischer Extremismus. Pädagogik im Spannungsfeld von Radikalisierung und Distanzierung
Einzelbeitrags-Download (Open Access/Gebühr): diskurs.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den Diskurs-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1862-5002 |
| eISSN | 2193-9713 |
| Jahrgang | 20. Jahrgang 2025 |
| Ausgabe | 1-2025 |
| Erscheinungsdatum | 18.03.2025 |
| Umfang | 136 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Zusatzmaterial
Zusatzmaterial
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
Schlagwörter19. Shell Jugendstudie, Adultifizierung, Adultismus, Arbeitsbedingungen, Arbeitsunfähigkeit, Belastung, Diskriminierung, Einbindung, Fachkraft-Kind-Interaktion, Fachkräfte, Gesundheit, Integration, Kinder- und Jugendhilfe, Kindertageseinrichtung, Kindertageseinrichtungen, Kindheit, Kindheitspädagogik, Kita-Leitung, Mikrozensus, März 2025, Normativität, offene Kinder- und Jugendarbeit, Online-Befragung, Praktiken, Prävention, Psychische Gesundheit, pädagogisches Personal, Rassismus, Schwarze Kinder, Sexismus, Stress, USA, Verbandliche Jugendarbeit, verletzendes Verhalten, Zugang
Abstracts
Abstracts
Arbeit und Gesundheit von Erwerbstätigen in Kindertageseinrichtungen in Deutschland: Ergebnisse des Mikrozensus 2021 (Alfons Hollederer, Ines Dieckmännken)
Erwerbstätige im Sozialwesen sind von berufsbedingten Belastungen betroffen, die die Entwicklung von psychischen und physischen Erkrankungen sowie Arbeitsunfähigkeit begünstigen. Auf Datenbasis des Mikrozensus 2021 wurde die Arbeits- und Gesundheitssituation der Erwerbstätigen im Wirtschaftszweig „Kindergärten und Vorschulen“ analysiert (N = 4.636; hochgerechnet 613.816). Es wurde ermittelt, dass Angehörige der Berufe „Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege“ in Kindergärten und Vorschulen signifikant häufiger (p < 0,001) in den letzten vier Wochen krank waren (19,4 %) als a) diese Berufsgruppe in anderen Wirtschaftszweigen (16,4 %) und b) andere Berufe (11,5 %). Gleichzeitig waren mit 45 Prozent mehr Angehörige der Berufe „Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege“ in Kindergärten und Vorschulen sehr zufrieden mit der Tätigkeit als in anderen Wirtschaftszweigen (39,5 %) und anderen Berufen (38,5 %). Es werden Implikationen für Maßnahmen der betrieblichen Gesundheit diskutiert. Schlagwörter: Arbeitsbedingungen, Arbeitsunfähigkeit, Gesundheit, Kindertageseinrichtungen, Mikrozensus
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Gesund bleiben in der Kita: Was Kita-Fachkräfte aus Sicht der Kita-Leitung belastet und gesund hält. Ergebnisse der DKLK-Studie 2022 (Andy Schieler)
Zahlreiche Befunde belegen die psychische und emotionale Erschöpfung von pädagogischen Fachkräften im Arbeitsfeld Kita. Neben den Belastungen des Fachkräftemangels sehen sich die Fachkräfte in ihrem pädagogischen Alltag mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert und sind demnach verschiedenen Belastungsfaktoren ausgesetzt. Um einen differenzierten Blick darauf zu bekommen, was Kita Fachkräfte belastet und was sie gesund hält, wurden im Rahmen der Studie des Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK-Studie) 2022 bundesweit 4.827 Kita-Leiter:innen zu Fragen der Gesundheit und Gesundheitsprävention befragt. Die Ergebnisse zeigen u. a., dass 70 Prozent der Befragten angaben, dass es in ihrer Kita kein Konzept zum Thema Gesundheit/Gesundheitsprävention für das pädagogische Fachpersonal gibt. Als stärkste gesundheitsfördernde Faktoren gaben die befragten Kita-Leiter:innen den respektvollen Umgang miteinander (93 %), die Zusammenarbeit im Team (87 %) und den Betriebssport (86 %) an; als stärkste gesundheitsgefährdende Faktoren nennen sie kranke Kinder in der Kita (95 %), Geräuschpegel (93 %) und Verwaltungsaufwand (87 %). Die DKLK-Studie 2022 leistet ihren Beitrag dazu, dass die Förderung der Gesundheit der pädagogischen Fach- und Leitungskräfte noch stärker in den Fokus der gesellschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und berufspraktischen Aufmerksamkeit gelangt. Schlagwörter: Gesundheit, Belastung, Fachkräfte, Kita-Leitung, Online-Befragung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Wenn Stress zu Verletzung führt – Verletzendes Verhalten gegenüber Kita-Kindern verstehen und Verhindern (Regina Remsperger-Kehm)
Studien zeigen, dass sich pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen Kindern gegenüber manchmal auch verletzend verhalten (Prengel, 2019; Maywald, 2019; Hildebrandt et al., 2021). Neben persönlichen und berufsbiografischen Gründen gelten stressbedingte Faktoren als Ursache für verletzendes Verhalten (Boll & Remsperger-Kehm, 2021). Die hohe und mit Stress verbundene Belastung des Kita-Personals ist seit Langem wissenschaftlich belegt (Viernickel & Voss, 2012). Ziel dieses Beitrags ist es, das wachsende Stressempfinden pädagogischer Fachkräfte in Alltagssituationen und die möglichen Auswirkungen auf einen nicht-feinfühligen Umgang mit Kindern zu beleuchten. Hierfür werden zentrale Ergebnisse der Analyse eskalierender Interaktionen zwischen Fachkräften und Kindern vorgestellt (Remsperger-Kehm & Boll, 2024). Schlagwörter: Fachkraft-Kind-Interaktion, verletzendes Verhalten, Stress, Prävention
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Das ‚gute Kindergartenkind‘ und die ‚gute Fachkraft‘ – Praxistheoretische Perspektiven auf die Bearbeitung kindheitspädagogischer Normen (Laura von Albedyhll, Teresa Vielstädte)
Normative Setzungen pädagogischen Handelns in der Kindheitspädagogik werden im vorliegenden Beitrag aus empirischer Perspektive bearbeitet. Dabei ist das Ziel anhand von zwei Studien Praktiken von frühpädagogischen Fachkräften und Kindern in Kindertageseinrichtungen exemplarisch zu beschreiben, zu vergleichen und zu kontrastieren. Diese verdeutlichen, wie Normen im Feld der Kita praktisch bearbeitet werden. In der Rekonstruktion von Alltagshandlungen entsprechen Kinder und Fachkräfte den an sie herangetragenen Anforderungen oder weisen sie zurück und können so als ‚gute‘ Fachkraft oder ‚gutes‘ Kindergartenkind sichtbar werden. Die unbelebten Dinge treten als Teil dieser Praktiken hervor und wirken auf Handlungsspielräume ein. Schlagwörter: Praktiken, Normativität, Kindheitspädagogik, Kindertageseinrichtung, Fachkraft-Kind-Interaktion
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Haben Schwarze Kinder (k)eine Kindheit? Anmerkungen zur Adultification-Debatte in den USA (Manfred Liebel)
Im Beitrag wird die anhaltende Debatte in den USA über Schwarze Kinder unter dem Stichwort „Adultification“ (Adultifizierung) diskutiert. Der Begriff dient als Konzept, um die Tatsache kritisch zu benennen, dass diese Kinder nicht „als Kinder“ mit den Eigenschaften wahrgenommen werden, die üblicherweise in Europa der Kindheit zugeschrieben werden, sondern als Menschen, die eher wie Erwachsene sind. Aufgrund ihrer rassistischen Konnotation hat diese Zuschreibung schwerwiegende, meist negative und manchmal sogar fatale Folgen für junge Menschen. Der Artikel greift diese Debatte auf, indem er verschiedene Ebenen von Adultifizierung analysiert und andere mögliche Erklärungen für rassistische Diskriminierung und Gewalt gegen Schwarze Jungen und Mädchen anbietet. Besondere Bedeutung wird der Frage beigemessen, wie Kindheit aufgefasst wird, insbesondere im Hinblick auf „Unschuld“ als vermeintlich universellem Merkmal dieser Phase oder Altersgruppe. Schlagwörter: Kindheit, Adultifizierung, Schwarze Kinder, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Adultismus, USA
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Integrationskraft der Angebote der offenen und verbandlichen Jugendarbeit – Empirische Hinweise (Eric van Santen, Andreas Herz)
Offene und verbandliche Jugendarbeit sind Angebote, die gemäß ihrem Selbstverständnis für alle jungen Menschen bereitstehen und nicht sozial selektiv sind. Im Beitrag wird die Integrationskraft der Felder der Jugendarbeit im Hinblick auf zwei Schwellen untersucht: 1. Wer nutzt die Angebote? – (Zugang). 2. Wer ist über diese Nutzung zeitlich umfangreicher gebunden oder engagiert? – (Einbindung). Auf der Grundlage des AID:A 2019 Survey zeigt sich für 12- bis 27-Jährige, dass für beide Schwellen und beide Felder das Alter der jungen Menschen relevant ist. Geschlecht, Bildung ebenso wie Deprivation im Haushalt stellen für den Zugang aber nicht für die Einbindung eine Selektion dar, wobei die Effekte in den Feldern z. T. unterschiedlich sind. Ohne Eltern und in städtischen Regionen leben, stellt eine Hürde im Zugang zur offenen Jugendarbeit sowie Migrationshintergrund für den Zugang und die Einbindung in der verbandlichen Jugendarbeit dar. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse wird die Integrationskraft der Felder diskutiert. Schlagwörter: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Verbandliche Jugendarbeit, Integration, Zugang, Einbindung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)


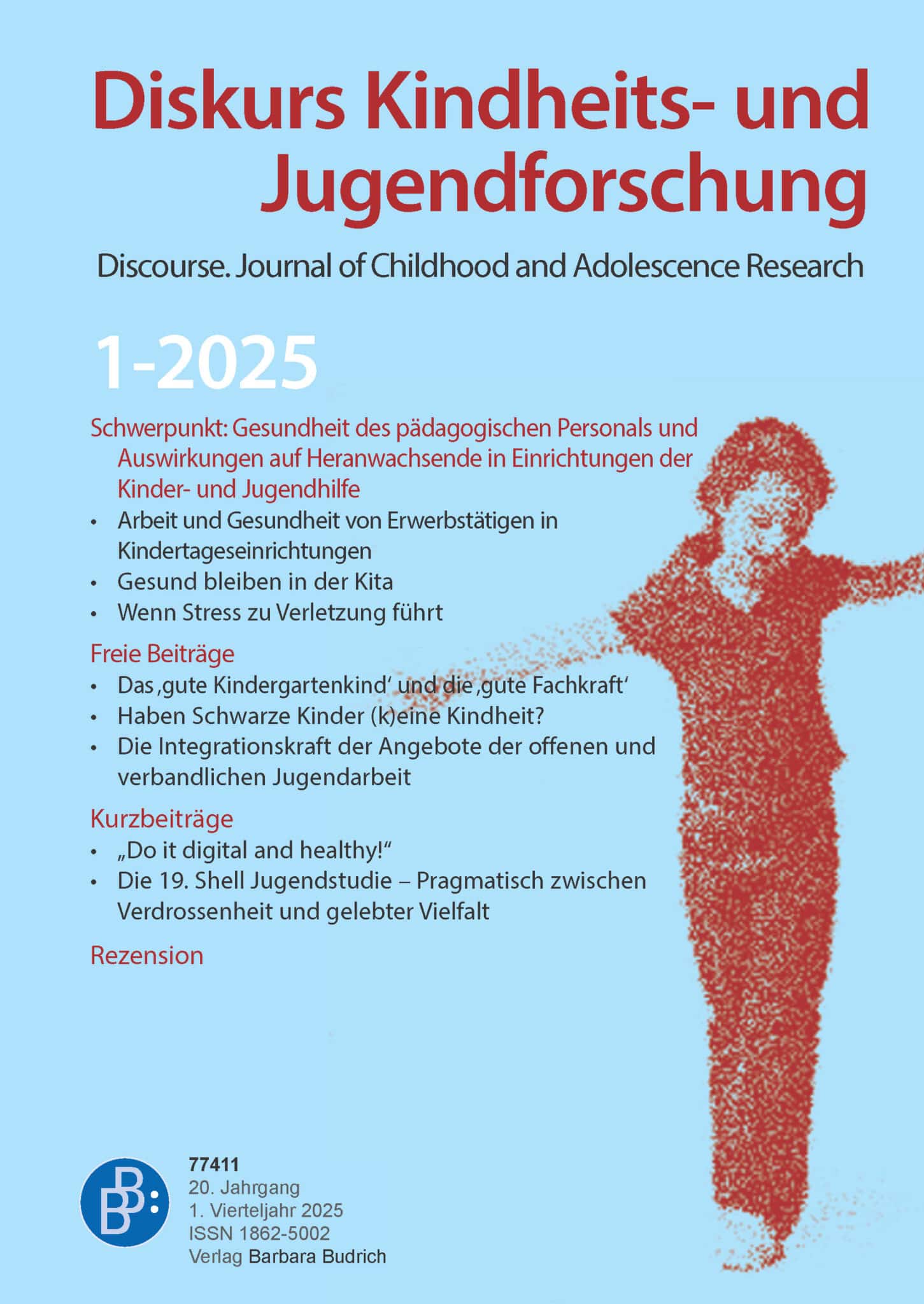


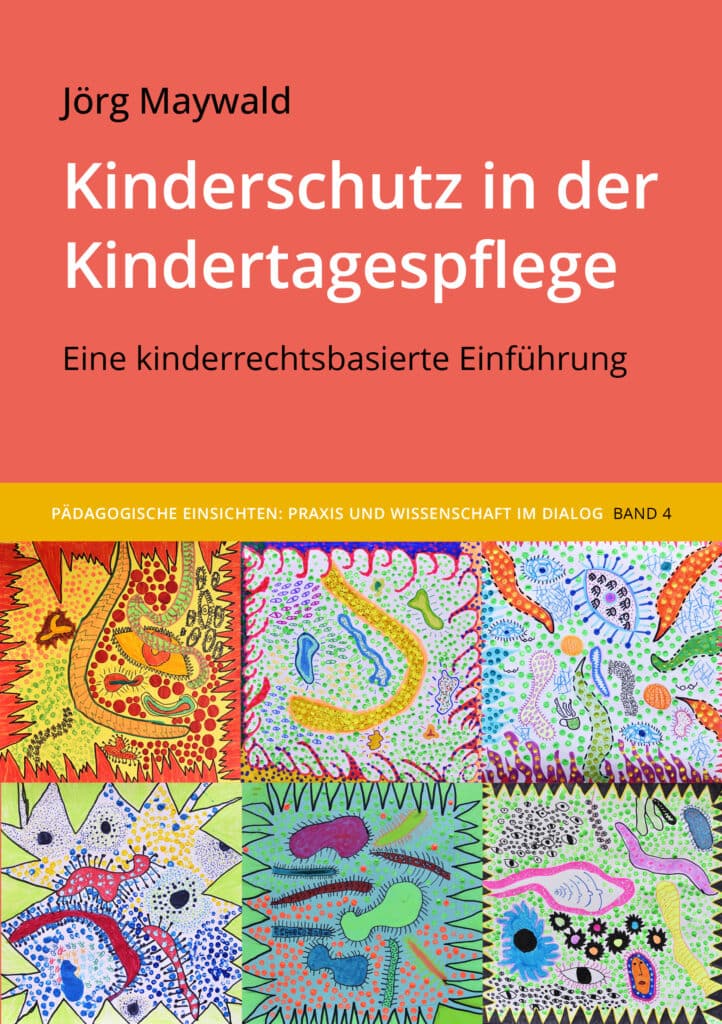


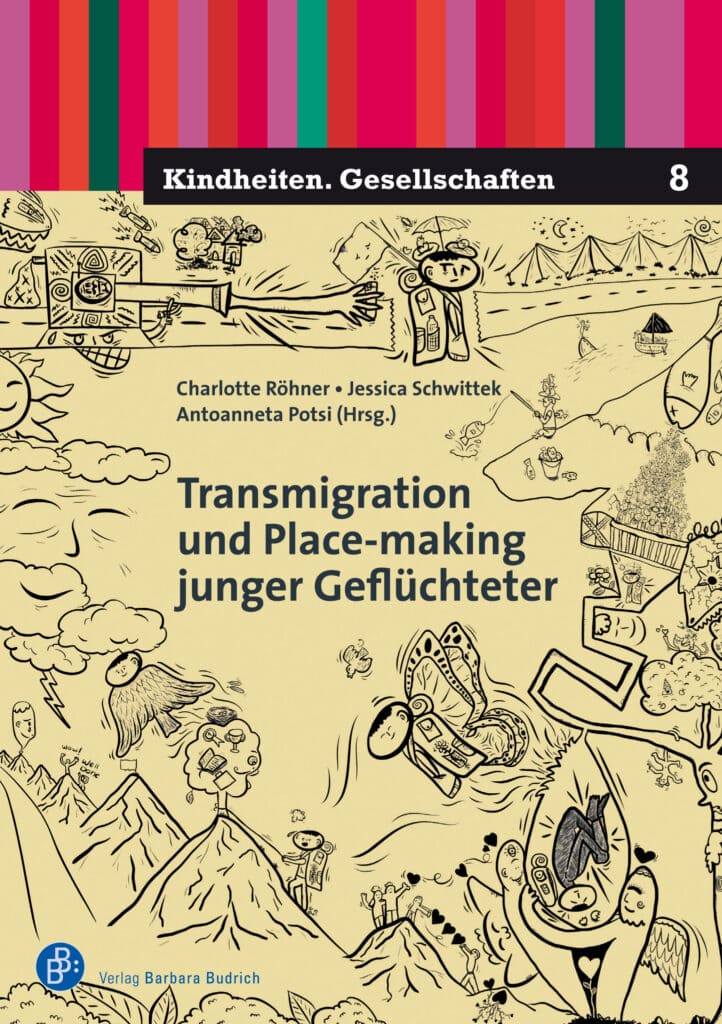
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.