Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » ZPTh 1-2025 | Jubiläumsheft zum 50. Todesjahr von Hannah Arendt: Nietzsche im politischen Denken von Arendt
ZPTh 1-2025 | Jubiläumsheft zum 50. Todesjahr von Hannah Arendt: Nietzsche im politischen Denken von Arendt
Erscheinungsdatum : 24.09.2025
30,00 €
- Inhalt
- Bibliografie
- Produktsicherheit
- Zusatzmaterial
- Bewertungen (0)
- Autor*innen
- Schlagwörter
- Abstracts
Inhalt
ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie
1-2025: Jubiläumsheft zum 50. Todesjahr von Hannah Arendt: Nietzsche im politischen Denken von Arendt
Gast-Hrsg.: Harald Bluhm & Grit Straßenberger
Harald Bluhm / Grit Straßenberger: Einleitung: Hannah Arendts Aneignungen von Nietzsches Philosophieren. Denkanstöße und Kritik
Beiträge:
Reinhard Mehring: Von Marburg nach Heidelberg. Jaspers, Nietzsche, Arendt
Marcus Llanque: Hannah Arendts Perspektive auf Nietzsche mit und gegen Martin Heidegger
Hans-Peter Müller: Nietzsche und Arendt über „Massengesellschaft“ – mit Simmel und Weber gelesen
Dirk Jörke: Nietzscheanische Argumentationsfiguren in der Demokratiekritik Arendts (im Open Access verfügbar)
Jürgen Förster: Traditionsbruch und die Sorge um die Welt
Matthias Bohlender: Gegen/Dialektik oder Zum Verhältnis von Freiheit, Befreiung und Herrschaft bei Nietzsche und Arendt
Rieke Trimçev: Plastisches Kräftemessen. Shklar, Arendt, Nietzsche und die Politik der Ideengeschichte
Weitere Abhandlung
Lucas von Ramin: Zwischen Ablehnung und Affirmation. Ostdeutschland und der Streit um Identitätspolitik
Interview
Manuel Kautz: Gemeinsam wider die Entpolitisierung der Demokratie. Cristina Lafonts und Nadia Urbinatis kooperative Kritik an lottokratischen Demokratietheorien
Manuel Kautz: The Ship of Democracy and the Lottocratic Iceberg. An Interview with Cristina Lafont and Nadia Urbinati
Rezensionen
Mario Clemens: Arendts Urteilskraft
Waltraud Meints-Stender: Kosmos und Republik als Denkraum
Eckhard Jesse: Das Netzwerk des Frankfurter Instituts für Sozialforschung in der Analyse von Philipp Lenhard
Henrike Bloemen: „Die alten Barrieren einzureißen“ für einen „Raum zum Atmen“: Mit Geschlecht und Sexualität die Politik und das Politische neu denken
Wiedergelesen: Helmuth Plessners „Grenzen der Gemeinschaft“
Wilfried Heise: Die Wiederkehr des sozialen Radikalismus: Pathologische Wurzeln und krankhafte Dynamiken in Gemeinschaft und Gesellschaft
Nachruf
Oliver Eberl: Für eine aufgeklärte Demokratietheorie. Zum Tode von Ingeborg Maus (1937–2024)
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zpth.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZPTh-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1869-3016 |
| eISSN | 2196-2103 |
| Jahrgang | 16. Jahrgang 2025 |
| Ausgabe | 1-2025 |
| Erscheinungsdatum | 24.09.2025 |
| Umfang | 196 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Zusatzmaterial
Autor*innen
SchlagwörterAgonalität, Arendt, Aristokratismus, Befreiung, Befähigung, Demokratiekritik, Denken, Denkstil, Entpolitisierung der Demokratie, Freiheit, Friedrich Nietzsche, Gegen-Dialektik, Genealogie der Moral, Georg Simmel, Hannah Arendt, Heidegger, Herr-Knecht-Dialektik, Herrschaft, Ideenpolitik, Identitätspolitik, Jaspers, Judith N. Shklar, Macht, Marginalisierung, Martin Heidegger, Masse und Massengesellschaft, Massendiskurs, Max Weber, Metaphern, Mitleid, Nietzsche, Ostdeutschland, Pluralität, Populismus, Radikaldemokratie, Rahel Varnhagen, Rebellion, Religionsphilosophie, Rezeptionsgeschichte, Romantik, Schicksal, Seinsgeschichte, September 2025, Sorge um die Welt, Souveränität, Tradition, Traditionsbruch, Transzendenz, Versprechen, Verwirklichung der Philosophie
Abstracts
Hannah Arendts Aneignungen von Nietzsches Philosophieren Denkanstöße und Kritik (Harald Bluhm / Grit Straßenberger)
Der Essay erkundet exemplarisch Spuren, Quellen und Lektüren, die Arendts Rezeption von Nietzsche kennzeichnen. Ihre frühe Nietzsche-Lektüre und die Interpretationen von Jaspers und Heidegger sind dabei wesentlich. Arendts Aneignung von Nietzsches Philosophieren im Horizont ihrer republikanischen politischen Theorie ist innovativ, aber trotz Distanz zu ihm auch problematisch. Es wird gezeigt, dass Nietzsche für eine Reihe von Themen (produktive Machtauffassung, agonale Politikkonzeption, Kritik der Mitleidstradition, Traditionsbruch) zentral war. Insgesamt stellt sich Nietzsche als sehr wichtige Anregungsquelle für Arendts Denken und ihren Denkstil heraus. Schlüsselwörter: Denken, Rebellion, Tradition, Macht, Agonalität, Mitleid, Metaphern, Denkstil
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Von Marburg nach Heidelberg. Jaspers, Nietzsche, Arendt (Reinhard Mehring)
Jaspers kritisierte Kierkegaard wie Nietzsche als polare Ausflüchte vor dem wahrhaft „philo-sophischen Glauben“. Als Psychopathologe vom individuellen Fall ausgehend war seine Nietzsche-Monographie von 1936 seine erste personenzentrierte Klassikeranalytik. Arendt folgte im Verfahren schon beim Rahel-Projekt mehr Jaspers als Heidegger, auch wenn sie dessen kulturprotestantische Beschwörung der „Transzendenz“ ablehnte und interaktivistisch umdeutete. Schlüsselwörter: Jaspers, Arendt, Nietzsche, Heidegger, Max Weber, Rahel Varnhagen, Transzendenz, Religionsphilosophie, Schicksal, Freiheit
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Hannah Arendts Perspektive auf Nietzsche mit und gegen Martin Heidegger (Marcus Llanque)
Arendts Nietzsche-Rezeption ist zweifellos durch ihre Kenntnis von Heideggers Philosophie geprägt, aber nicht bestimmt. Wo Arendt Nietzsche wie Heidegger aus denselben Gründen kritisiert, nämlich hinsichtlich ihrer apolitischen Ausrichtung, eröffnet sich für sie zugleich die Stelle, an welcher sie über Heidegger und Nietzsche hinaus einen Grundgedanken Nietzsches aufgreift und über ihn hinaus fortentwickelt: der Mensch ist ein Tier, ‚das versprechen darf‘. Schlüsselwörter: Hannah Arendt, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Seinsgeschichte, Genealogie der Moral, Versprechen
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Nietzsche und Arendt über „Massengesellschaft“ – mit Simmel und Weber gelesen (Hans-Peter Müller)
Das Konzept der Masse und der Massengesellschaft spielt in den Werken von Nietzsche und Arendt eine Schlüsselrolle für ihr Verständnis der Moderne. Um diesen Sachverhalt zu klären, wird zunächst an das Konzept der Masse in den Sozialwissenschaften erinnert, dann Nietzsche als einer der ersten Massentheoretiker vorgestellt und schließlich aufgezeigt, wie bei Arendt das Zeitalter der Massen Politik und Gesellschaft beeinflussen. Die These lautet: Nietzsche erspürt Rolle und Dynamik der auf-kommenden Masse und der Massengesellschaft in der Moderne, sieht im aristokratischen Individualismus aber noch immer eine Gegenmacht. Arendt dekliniert die Folgen dieses Phänomens durch und diagnostiziert die Masse als Spielball totalitärer Herrschaft. Beide Denker teilen eine Ambivalenz gegenüber dem Phänomen und suchen nach Lösungen, die den depravierenden Einfluss der Massen dämpfen können. Nietzsche setzt auf den ‚Übermenschen‘ als Vorbild, Arendt auf Politik und Öffentlichkeit. Schlüsselwörter: Hannah Arendt, Friedrich Nietzsche, Georg Simmel, Max Weber, Masse und Massengesellschaft
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Nietzscheanische Argumentationsfiguren in der Demokratiekritik Arendts (Dirk Jörke)
Der Artikel zeigt die Parallelen zwischen Nietzsches und Arendts Demokratiekritik auf. Beide gehen von einer Spaltung zwischen den Wenigen und den Vielen aus, beklagen den Verfall der Kultur bzw. des politischen Handelns in der ‚Massengesellschaft‘, befürchten Demagogie sowie ‚Mehr-heitstyrannei‘ als Folge des allgemeinen Wahlrechts und beklagen die Mediokrität der Parteienherr-schaft. Zugleich besteht aber ein doppelter Unterschied. Arendt beklagt nicht mehr in erster Linie die negativen Auswirkungen auf das kulturelle Schaffen, sondern die Verunmöglichung politischen Han-delns in der ‚Arbeitsgesellschaft‘. Zudem fällt die Demokratiekritik Arendts moderater und in den Kon-sequenzen auch ambivalenter aus. Gleichwohl ist sie keine Demokratin, sondern eine Republikanerin und als solche eine „aristokratische Melancholikerin“. Schlüsselwörter: Nietzsche, Arendt, Massendiskurs, Demokratiekritik, Aristokratismus
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Traditionsbruch und die Sorge um die Welt (Jürgen Förster)
Hannah Arendt schätzte das Werk von Nietzsche sehr. Er ist in ihren Schriften und Briefen allgegenwärtig. Dennoch möchte der Beitrag zeigen, dass die Rede von einer „nietzscheanischen Arendt“ (Villa) irreführend ist. Zwischen Arendt und Nietzsche gibt es grundlegende Gegensätze, die sich im Anschluss an Vasti Roodt an der amor fati und der amor mundi und an der Umgangsweise mit dem Traditionsbruchs aufzeigen lassen. Bei Nietzsche und der nietzscheanisch-poststrukturalistischen Linken gibt es keine Möglichkeit, die Sorge um die Welt zu denken, wie sie für Arendt wesentlich ist. Schlüsselwörter: Pluralität, Traditionsbruch, Sorge um die Welt, Souveränität, Versprechen, Verwirklichung der Philosophie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Gegen/Dialektik oder Zum Verhältnis von Freiheit, Befreiung und Herrschaft bei Nietzsche und Arendt (Matthias Bohlender)
In diesem Aufsatz geht es darum, Arendt und Nietzsche als zentrale Kritiker_innen eines einflussreichen Befreiungsnarrativs zu begreifen, das seine Wurzeln in der Herr-Knecht-Dialektik von Hegels Phänomenologie des Geistes hat und von Marx und Alexandre Kojève weiter ausgearbeitet wurde. Während Arendt die dialektische Selbstbefreiung des Knechts durch Arbeit in Frage stellt und in der Tätigkeitsform der Arbeit geradezu eine Dialektik der Verknechtung ausmacht, geht Nietzsche noch einen Schritt weiter: er sieht in der Dialektik der Befreiung die doppelsinnige Formierung eines Herrensubjekts, das sich in seiner Befreiung selbst unterwerfen muss. Schlüsselwörter: Herr-Knecht Dialektik, Gegen-Dialektik, Herrschaft, Befreiung, Befähigung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Plastisches Kräftemessen. Shklar, Arendt, Nietzsche und die Politik der Ideengeschichte (Rieke Trimçev)
Schon bevor Arendt-Interpret:innen in den 1990er Jahren die Einflüsse Nietzsches auf das Werk von Hannah Arendt diskutierten, hatte die liberale Politiktheoretikerin Judith Shklar seit den 1950er Jahren in unterschiedlichen Texten auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Dieser Beitrag zeigt, dass Shklars kritische Auseinandersetzung mit Arendt maßgeblich von ihrem Blick auf Nietzsche geprägt ist. Er lässt die Frage nach der Politik der Ideengeschichte in den Mittelpunkt fast jeder Aus-einandersetzung mit Arendt rücken. Bis Mitte der 1970er Jahre setzt sich Shklar dabei vor allem mit den antiliberalen Motiven in Arendts Werk auseinander, später tritt die Auseinandersetzung mit ideengeschichtlichen Erzählformen in den Vordergrund. Schlüsselwörter: Hannah Arendt, Judith N. Shklar, Friedrich Nietzsche, Romantik, Rezeptionsgeschichte, Ideenpolitik
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Zwischen Ablehnung und Affirmation. Ostdeutschland und der Streit um Identitätspolitik (Lucas von Ramin)
Die Diskussion um den gesellschaftlichen Mehrwert von Identitätspolitik gehört zu den zentralen politischen Debatten der letzten Jahre. Identitätspolitik steht dabei im Spannungsfeld zwischen legitimen Anerkennungskämpfen benachteiligter Gruppen und der Warnung vor einem Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch die Fragmentierung in einzelne Gruppenzugehörigkeiten. Besonders deutlich wird dieses Spannungsfeld an einem spezifischen Identitätsbildungsprozess, der in der Debatte oft nur am Rande behandelt wird: der Frage nach einer ostdeutschen Identität. Der vorliegende Beitrag beleuchtet das Konzept der Identitätspolitik und untersucht seine Bedeutung im Kontext von Emanzipations- und Demokratisierungsprozessen. Dabei werden zentrale Kritikpunkte wie der Essentialismus- und der Kulturalismusvorwurf diskutiert. Darüber hinaus wird das Konzept einer demokratischen Identitätspolitik am Fallbeispiel Ostdeutschland kritisch hinterfragt. Auf der Grundlage einer Hermeneutik der Marginalisierung des Ostens und der damit verbundenen Identitätspolitiken, die durch empirische Studien untermauert wird, soll diskutiert werden, inwiefern der Anspruch auf politische Emanzipation und Ermächtigung haltbar ist. Schlüsselwörter: Identitätspolitik, Radikaldemokratie, Marginalisierung, Ostdeutschland, Populismus
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie
1-2025: Jubiläumsheft zum 50. Todesjahr von Hannah Arendt: Nietzsche im politischen Denken von Arendt
Gast-Hrsg.: Harald Bluhm & Grit Straßenberger
Harald Bluhm / Grit Straßenberger: Einleitung: Hannah Arendts Aneignungen von Nietzsches Philosophieren. Denkanstöße und Kritik
Beiträge:
Reinhard Mehring: Von Marburg nach Heidelberg. Jaspers, Nietzsche, Arendt
Marcus Llanque: Hannah Arendts Perspektive auf Nietzsche mit und gegen Martin Heidegger
Hans-Peter Müller: Nietzsche und Arendt über „Massengesellschaft“ – mit Simmel und Weber gelesen
Dirk Jörke: Nietzscheanische Argumentationsfiguren in der Demokratiekritik Arendts (im Open Access verfügbar)
Jürgen Förster: Traditionsbruch und die Sorge um die Welt
Matthias Bohlender: Gegen/Dialektik oder Zum Verhältnis von Freiheit, Befreiung und Herrschaft bei Nietzsche und Arendt
Rieke Trimçev: Plastisches Kräftemessen. Shklar, Arendt, Nietzsche und die Politik der Ideengeschichte
Weitere Abhandlung
Lucas von Ramin: Zwischen Ablehnung und Affirmation. Ostdeutschland und der Streit um Identitätspolitik
Interview
Manuel Kautz: Gemeinsam wider die Entpolitisierung der Demokratie. Cristina Lafonts und Nadia Urbinatis kooperative Kritik an lottokratischen Demokratietheorien
Manuel Kautz: The Ship of Democracy and the Lottocratic Iceberg. An Interview with Cristina Lafont and Nadia Urbinati
Rezensionen
Mario Clemens: Arendts Urteilskraft
Waltraud Meints-Stender: Kosmos und Republik als Denkraum
Eckhard Jesse: Das Netzwerk des Frankfurter Instituts für Sozialforschung in der Analyse von Philipp Lenhard
Henrike Bloemen: „Die alten Barrieren einzureißen“ für einen „Raum zum Atmen“: Mit Geschlecht und Sexualität die Politik und das Politische neu denken
Wiedergelesen: Helmuth Plessners „Grenzen der Gemeinschaft“
Wilfried Heise: Die Wiederkehr des sozialen Radikalismus: Pathologische Wurzeln und krankhafte Dynamiken in Gemeinschaft und Gesellschaft
Nachruf
Oliver Eberl: Für eine aufgeklärte Demokratietheorie. Zum Tode von Ingeborg Maus (1937–2024)
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zpth.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZPTh-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1869-3016 |
| eISSN | 2196-2103 |
| Jahrgang | 16. Jahrgang 2025 |
| Ausgabe | 1-2025 |
| Erscheinungsdatum | 24.09.2025 |
| Umfang | 196 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Zusatzmaterial
Zusatzmaterial
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterAgonalität, Arendt, Aristokratismus, Befreiung, Befähigung, Demokratiekritik, Denken, Denkstil, Entpolitisierung der Demokratie, Freiheit, Friedrich Nietzsche, Gegen-Dialektik, Genealogie der Moral, Georg Simmel, Hannah Arendt, Heidegger, Herr-Knecht-Dialektik, Herrschaft, Ideenpolitik, Identitätspolitik, Jaspers, Judith N. Shklar, Macht, Marginalisierung, Martin Heidegger, Masse und Massengesellschaft, Massendiskurs, Max Weber, Metaphern, Mitleid, Nietzsche, Ostdeutschland, Pluralität, Populismus, Radikaldemokratie, Rahel Varnhagen, Rebellion, Religionsphilosophie, Rezeptionsgeschichte, Romantik, Schicksal, Seinsgeschichte, September 2025, Sorge um die Welt, Souveränität, Tradition, Traditionsbruch, Transzendenz, Versprechen, Verwirklichung der Philosophie
Abstracts
Abstracts
Hannah Arendts Aneignungen von Nietzsches Philosophieren Denkanstöße und Kritik (Harald Bluhm / Grit Straßenberger)
Der Essay erkundet exemplarisch Spuren, Quellen und Lektüren, die Arendts Rezeption von Nietzsche kennzeichnen. Ihre frühe Nietzsche-Lektüre und die Interpretationen von Jaspers und Heidegger sind dabei wesentlich. Arendts Aneignung von Nietzsches Philosophieren im Horizont ihrer republikanischen politischen Theorie ist innovativ, aber trotz Distanz zu ihm auch problematisch. Es wird gezeigt, dass Nietzsche für eine Reihe von Themen (produktive Machtauffassung, agonale Politikkonzeption, Kritik der Mitleidstradition, Traditionsbruch) zentral war. Insgesamt stellt sich Nietzsche als sehr wichtige Anregungsquelle für Arendts Denken und ihren Denkstil heraus. Schlüsselwörter: Denken, Rebellion, Tradition, Macht, Agonalität, Mitleid, Metaphern, Denkstil
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Von Marburg nach Heidelberg. Jaspers, Nietzsche, Arendt (Reinhard Mehring)
Jaspers kritisierte Kierkegaard wie Nietzsche als polare Ausflüchte vor dem wahrhaft „philo-sophischen Glauben“. Als Psychopathologe vom individuellen Fall ausgehend war seine Nietzsche-Monographie von 1936 seine erste personenzentrierte Klassikeranalytik. Arendt folgte im Verfahren schon beim Rahel-Projekt mehr Jaspers als Heidegger, auch wenn sie dessen kulturprotestantische Beschwörung der „Transzendenz“ ablehnte und interaktivistisch umdeutete. Schlüsselwörter: Jaspers, Arendt, Nietzsche, Heidegger, Max Weber, Rahel Varnhagen, Transzendenz, Religionsphilosophie, Schicksal, Freiheit
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Hannah Arendts Perspektive auf Nietzsche mit und gegen Martin Heidegger (Marcus Llanque)
Arendts Nietzsche-Rezeption ist zweifellos durch ihre Kenntnis von Heideggers Philosophie geprägt, aber nicht bestimmt. Wo Arendt Nietzsche wie Heidegger aus denselben Gründen kritisiert, nämlich hinsichtlich ihrer apolitischen Ausrichtung, eröffnet sich für sie zugleich die Stelle, an welcher sie über Heidegger und Nietzsche hinaus einen Grundgedanken Nietzsches aufgreift und über ihn hinaus fortentwickelt: der Mensch ist ein Tier, ‚das versprechen darf‘. Schlüsselwörter: Hannah Arendt, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Seinsgeschichte, Genealogie der Moral, Versprechen
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Nietzsche und Arendt über „Massengesellschaft“ – mit Simmel und Weber gelesen (Hans-Peter Müller)
Das Konzept der Masse und der Massengesellschaft spielt in den Werken von Nietzsche und Arendt eine Schlüsselrolle für ihr Verständnis der Moderne. Um diesen Sachverhalt zu klären, wird zunächst an das Konzept der Masse in den Sozialwissenschaften erinnert, dann Nietzsche als einer der ersten Massentheoretiker vorgestellt und schließlich aufgezeigt, wie bei Arendt das Zeitalter der Massen Politik und Gesellschaft beeinflussen. Die These lautet: Nietzsche erspürt Rolle und Dynamik der auf-kommenden Masse und der Massengesellschaft in der Moderne, sieht im aristokratischen Individualismus aber noch immer eine Gegenmacht. Arendt dekliniert die Folgen dieses Phänomens durch und diagnostiziert die Masse als Spielball totalitärer Herrschaft. Beide Denker teilen eine Ambivalenz gegenüber dem Phänomen und suchen nach Lösungen, die den depravierenden Einfluss der Massen dämpfen können. Nietzsche setzt auf den ‚Übermenschen‘ als Vorbild, Arendt auf Politik und Öffentlichkeit. Schlüsselwörter: Hannah Arendt, Friedrich Nietzsche, Georg Simmel, Max Weber, Masse und Massengesellschaft
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Nietzscheanische Argumentationsfiguren in der Demokratiekritik Arendts (Dirk Jörke)
Der Artikel zeigt die Parallelen zwischen Nietzsches und Arendts Demokratiekritik auf. Beide gehen von einer Spaltung zwischen den Wenigen und den Vielen aus, beklagen den Verfall der Kultur bzw. des politischen Handelns in der ‚Massengesellschaft‘, befürchten Demagogie sowie ‚Mehr-heitstyrannei‘ als Folge des allgemeinen Wahlrechts und beklagen die Mediokrität der Parteienherr-schaft. Zugleich besteht aber ein doppelter Unterschied. Arendt beklagt nicht mehr in erster Linie die negativen Auswirkungen auf das kulturelle Schaffen, sondern die Verunmöglichung politischen Han-delns in der ‚Arbeitsgesellschaft‘. Zudem fällt die Demokratiekritik Arendts moderater und in den Kon-sequenzen auch ambivalenter aus. Gleichwohl ist sie keine Demokratin, sondern eine Republikanerin und als solche eine „aristokratische Melancholikerin“. Schlüsselwörter: Nietzsche, Arendt, Massendiskurs, Demokratiekritik, Aristokratismus
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Traditionsbruch und die Sorge um die Welt (Jürgen Förster)
Hannah Arendt schätzte das Werk von Nietzsche sehr. Er ist in ihren Schriften und Briefen allgegenwärtig. Dennoch möchte der Beitrag zeigen, dass die Rede von einer „nietzscheanischen Arendt“ (Villa) irreführend ist. Zwischen Arendt und Nietzsche gibt es grundlegende Gegensätze, die sich im Anschluss an Vasti Roodt an der amor fati und der amor mundi und an der Umgangsweise mit dem Traditionsbruchs aufzeigen lassen. Bei Nietzsche und der nietzscheanisch-poststrukturalistischen Linken gibt es keine Möglichkeit, die Sorge um die Welt zu denken, wie sie für Arendt wesentlich ist. Schlüsselwörter: Pluralität, Traditionsbruch, Sorge um die Welt, Souveränität, Versprechen, Verwirklichung der Philosophie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Gegen/Dialektik oder Zum Verhältnis von Freiheit, Befreiung und Herrschaft bei Nietzsche und Arendt (Matthias Bohlender)
In diesem Aufsatz geht es darum, Arendt und Nietzsche als zentrale Kritiker_innen eines einflussreichen Befreiungsnarrativs zu begreifen, das seine Wurzeln in der Herr-Knecht-Dialektik von Hegels Phänomenologie des Geistes hat und von Marx und Alexandre Kojève weiter ausgearbeitet wurde. Während Arendt die dialektische Selbstbefreiung des Knechts durch Arbeit in Frage stellt und in der Tätigkeitsform der Arbeit geradezu eine Dialektik der Verknechtung ausmacht, geht Nietzsche noch einen Schritt weiter: er sieht in der Dialektik der Befreiung die doppelsinnige Formierung eines Herrensubjekts, das sich in seiner Befreiung selbst unterwerfen muss. Schlüsselwörter: Herr-Knecht Dialektik, Gegen-Dialektik, Herrschaft, Befreiung, Befähigung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Plastisches Kräftemessen. Shklar, Arendt, Nietzsche und die Politik der Ideengeschichte (Rieke Trimçev)
Schon bevor Arendt-Interpret:innen in den 1990er Jahren die Einflüsse Nietzsches auf das Werk von Hannah Arendt diskutierten, hatte die liberale Politiktheoretikerin Judith Shklar seit den 1950er Jahren in unterschiedlichen Texten auf diesen Zusammenhang hingewiesen. Dieser Beitrag zeigt, dass Shklars kritische Auseinandersetzung mit Arendt maßgeblich von ihrem Blick auf Nietzsche geprägt ist. Er lässt die Frage nach der Politik der Ideengeschichte in den Mittelpunkt fast jeder Aus-einandersetzung mit Arendt rücken. Bis Mitte der 1970er Jahre setzt sich Shklar dabei vor allem mit den antiliberalen Motiven in Arendts Werk auseinander, später tritt die Auseinandersetzung mit ideengeschichtlichen Erzählformen in den Vordergrund. Schlüsselwörter: Hannah Arendt, Judith N. Shklar, Friedrich Nietzsche, Romantik, Rezeptionsgeschichte, Ideenpolitik
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Zwischen Ablehnung und Affirmation. Ostdeutschland und der Streit um Identitätspolitik (Lucas von Ramin)
Die Diskussion um den gesellschaftlichen Mehrwert von Identitätspolitik gehört zu den zentralen politischen Debatten der letzten Jahre. Identitätspolitik steht dabei im Spannungsfeld zwischen legitimen Anerkennungskämpfen benachteiligter Gruppen und der Warnung vor einem Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch die Fragmentierung in einzelne Gruppenzugehörigkeiten. Besonders deutlich wird dieses Spannungsfeld an einem spezifischen Identitätsbildungsprozess, der in der Debatte oft nur am Rande behandelt wird: der Frage nach einer ostdeutschen Identität. Der vorliegende Beitrag beleuchtet das Konzept der Identitätspolitik und untersucht seine Bedeutung im Kontext von Emanzipations- und Demokratisierungsprozessen. Dabei werden zentrale Kritikpunkte wie der Essentialismus- und der Kulturalismusvorwurf diskutiert. Darüber hinaus wird das Konzept einer demokratischen Identitätspolitik am Fallbeispiel Ostdeutschland kritisch hinterfragt. Auf der Grundlage einer Hermeneutik der Marginalisierung des Ostens und der damit verbundenen Identitätspolitiken, die durch empirische Studien untermauert wird, soll diskutiert werden, inwiefern der Anspruch auf politische Emanzipation und Ermächtigung haltbar ist. Schlüsselwörter: Identitätspolitik, Radikaldemokratie, Marginalisierung, Ostdeutschland, Populismus
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)




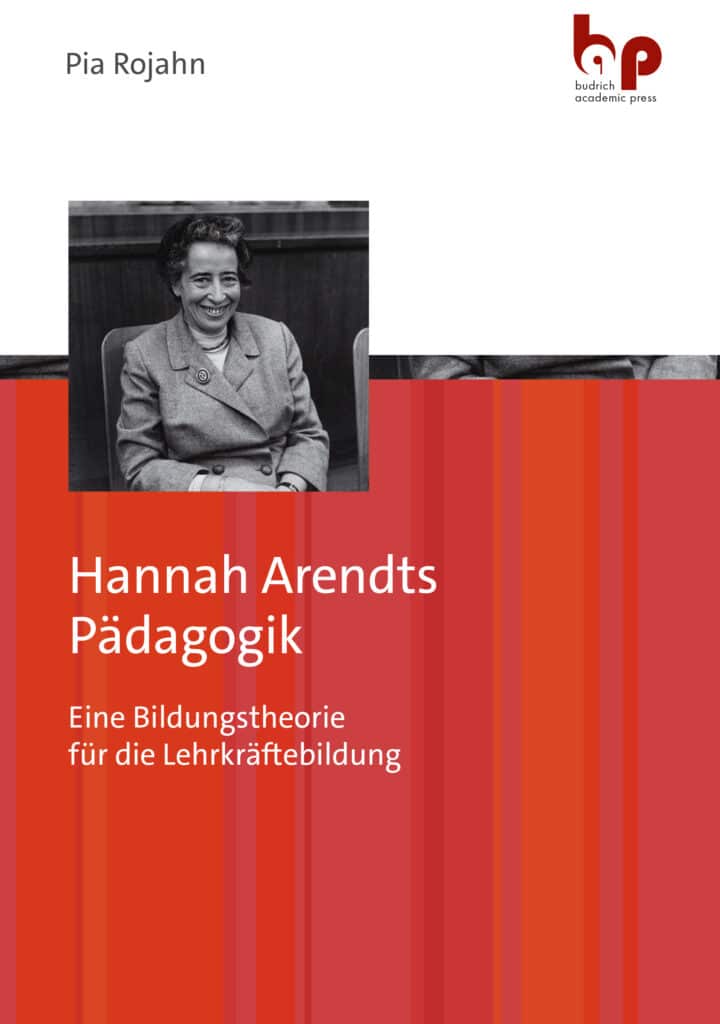
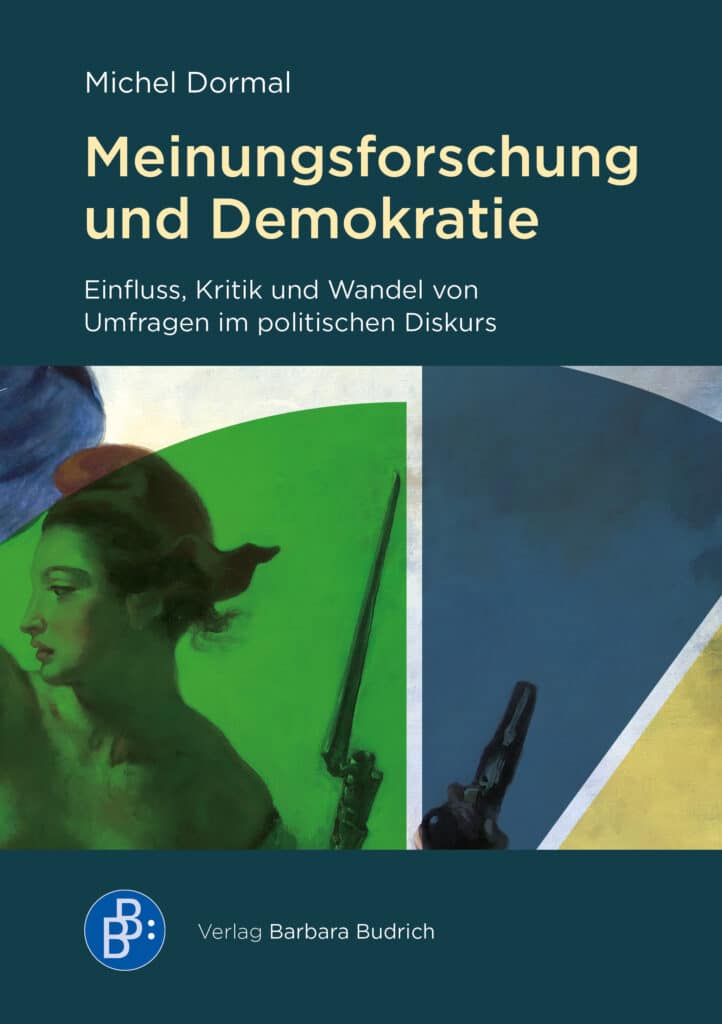
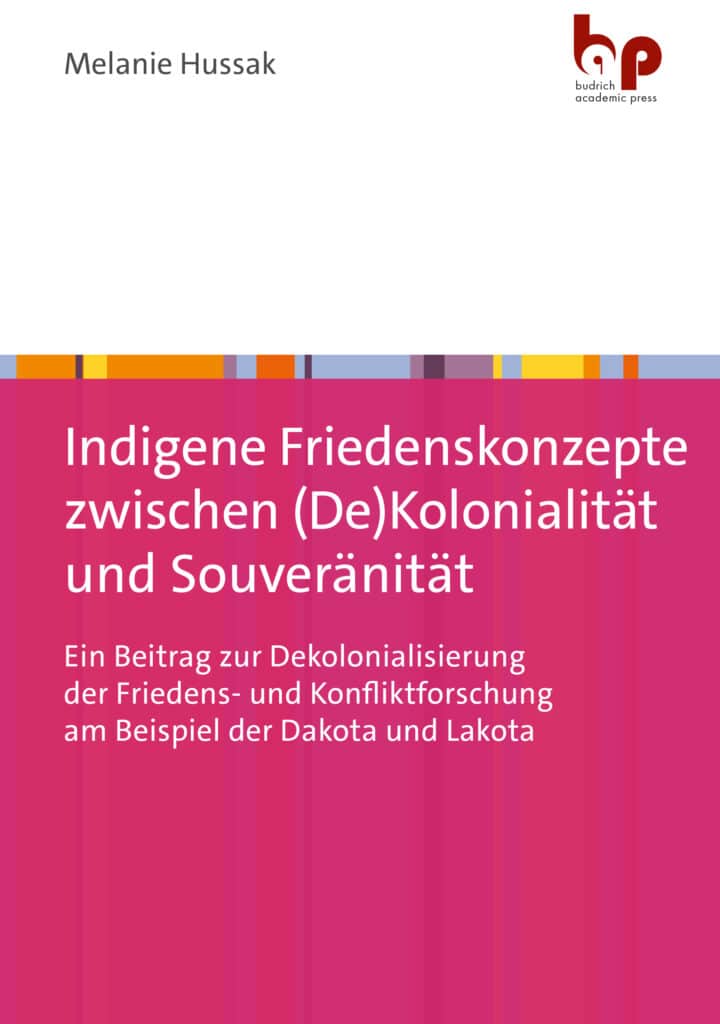
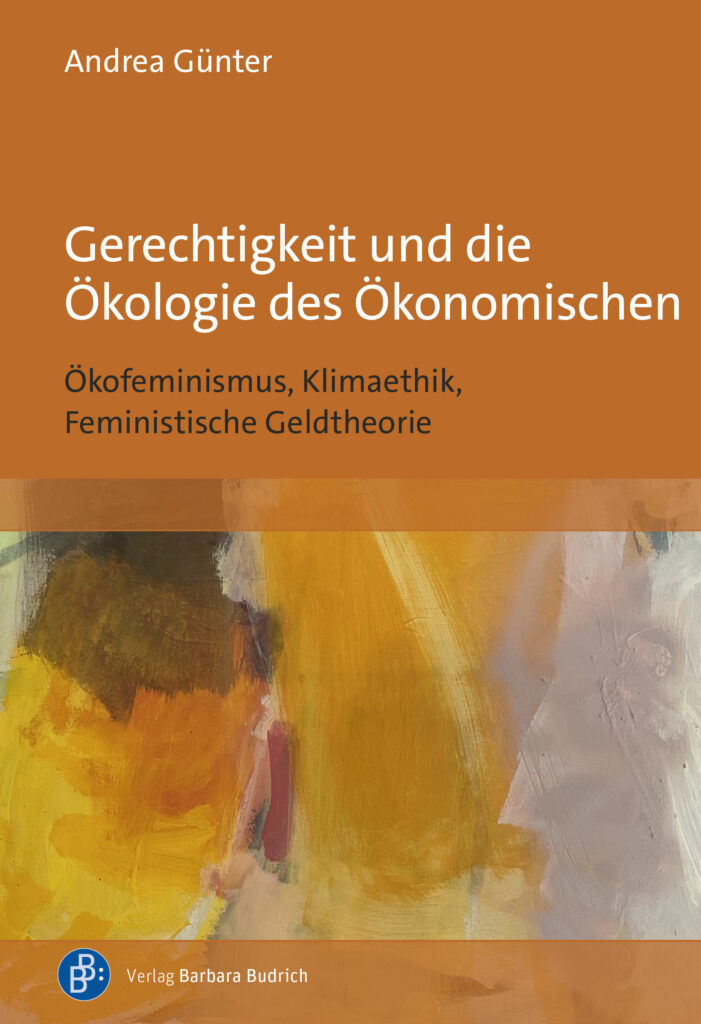

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.