Informationen zum Buch
Home » Publications » Lesen als Kunst: Literaturdidaktik in der Waldorfpädagogik
Lesen als Kunst: Literaturdidaktik in der Waldorfpädagogik
Subjektbildung durch ästhetische Erfahrung im Jugendalter
Erscheinungsdatum : 30.09.2024
34,99 € - 38,00 €
- Beschreibung
- Bibliography
- Produktsicherheit
- Additional Content
- Bewertungen (0)
- Authors
- Tags
- Pressestimmen
Beschreibung
Ausgehend von der Rezeptionsästhetik der Frühromantiker werden in diesem Buch grundlegende literaturdidaktische Ansätze und Konzepte der Subjektkonstituierung durch Literatur im Jugendalter mit besonderer Berücksichtigung der Waldorfpädagogik behandelt. Vor dem Hintergrund digitaler Lebenswelten wird der Wert und die Bedeutung ästhetischer Selbstbildung durch literarische Texte vielschichtig herausgearbeitet.
Ein besonderer Fokus legt der Autor dabei auf die Durchsicht und Analyse der waldorfpädagogischen Literaturdidaktik der Oberstufe. Diese beinhaltet sowohl methodisch als auch didaktisch einige diskursrelevante Ansätze, wie beispielsweise hinsichtlich der Strukturierung und Gliederung des Literaturunterrichts, bezüglich der jugendpädagogischen Frage nach Liminalitätserfahrungen oder im Hinblick auf die Herstellung individueller Resonanzbeziehungen zur Welt. Der Gedanke eines „peripheren Ichs“, der sich aus der Erkenntnistheorie von Rudolf Steiner, dem Begründer der Waldorfpädagogik, ableitet, wird als konstituierendes Element des Buches wiederholt im Zusammenhang mit dem Motiv der ästhetischen Selbstbildung im Jugendalter aufgegriffen und variiert, zuletzt durch einen vom Autor für Lehrende entwickelten Ansatz peripheren oder pädagogischen Lesens. Der Autor leistet einen Beitrag zu einer Anthropologie des Ästhetischen im Sinne einer vielschichtigen, transformativen Selbstwerdung durch die Rezeption literarischer Kunstwerke.
Der Autor:
Philipp Kleinfercher, Freie Hochschule Stuttgart
Der Fachbereich:
Educational Science
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISBN | 978-3-96665-092-2 |
| eISBN | 978-3-96665-904-8 |
| Format | 14,8 x 21,0 cm |
| Scope | 261 |
| Year of publication | 2024 |
| Date of publication | 30.09.2024 |
| Edition | 1. |
| Language | Deutsch |
Additional Content
Autor*innen
KeywordsAdoleszenz, Deutschunterricht, Lesen, Literaturdidaktik, Rezeptionsprozess, Rezeptionsästhetik, Rudolf Steiner, Selbstbildung, Subjektkonstituierung, Waldorfpädagogik
Wie gewinnbringend es sein kann, Literaturdidaktik aus einer historischen Perspektive zu betrachten und daraus Konzepte für die Gegenwart und Zukunft zu gewinnen, zeigt die jüngst publizierte Dissertationsschrift von Philipp Kleinfercher. Dieser unternimmt es, Traditionslinien einer Erziehung durch Literatur in der Waldorfpädagogik nachzuzeichnen, sie mit rezeptionsästhetischen Ansätzen von der Frühromantik über Wolfgang Iser bis zu aktuellen literaturdidaktischen Positionen in Verbindung zu bringen und daraus ein eigenes Programm des »Lesen[s] als künstlerische[r] Tätigkeit« (Kleinfercher 2024, S. 226) abzuleiten. Ebenso beeindruckend wie in der Lektüre bereichernd ist dabei die Breite und Vielzahl an philosophischen, rezeptionsästhetischen und literaturdidaktischen Konzepten, die Kleinfercher zusammenbringt, angefangen von Fichtes Idealismus, welcher Romantiker wie Schlegel oder Novalis inspirierte und insbesondere maßgeblichen Einfluss auf Rudolf Steiners (literatur )pädagogische Überlegungen hatte, bis hin zu Spinners elf Aspekten, dem Heidelberger Unterrichtsgespräch, einer Resonanzpädagogik sensu Rosa oder auch einer responsiven Literaturdidaktik.
Johannes Odendahl, ide 3-2025
Allen denjenigen, die nach einer konkreten Utopie pädagogischen Handelns in Krisenzeiten suchen und an einer anspruchsvollen geistesgeschichtlich und anthropologisch dimensionierten Grundlegung und Aktualisierung von Literaturdidaktik und Waldorfpädagogik interessiert sind, sei dieses Buch zur Lektüre dringend ans Herz gelegt.
Rita Schumacher, Journal für Waldorfpädagogik, Juli 2025, S. 83-88
Mit diesem Buch leistet der Autor einen Beitrag zu einer Anthropologie des Ästhetischen im Sinne einer vielschichtigen, transformativen Selbstwerdung durch die Rezeption literarischer Kunstwerke.
Wilfried Wulfers, AOL-Bücherbrief, Annotierte Auswahl aktueller Bücher und elektronischer Medien, Jg. 44/2025
Das Buch schließt mit neun Gesichtspunkten, die für den Literaturunterricht entscheidend sind und Orientierung geben können – nicht nur für Schüler:innen. Auch wenn auf den ersten Blick vielleicht vor allem Pädagog:innen sich angesprochen fühlen, so sind die Fragen, die gestellt werden, für jeden interessant und bereichernd, der ein zeitgenössischer Mensch unserer komplexen und komplizierten Welt zu sein versucht.
Ariane Eichenberg, erziehungskunst waldorf.leben, 01-02/2025
Beschreibung
Beschreibung
Ausgehend von der Rezeptionsästhetik der Frühromantiker werden in diesem Buch grundlegende literaturdidaktische Ansätze und Konzepte der Subjektkonstituierung durch Literatur im Jugendalter mit besonderer Berücksichtigung der Waldorfpädagogik behandelt. Vor dem Hintergrund digitaler Lebenswelten wird der Wert und die Bedeutung ästhetischer Selbstbildung durch literarische Texte vielschichtig herausgearbeitet.
Ein besonderer Fokus legt der Autor dabei auf die Durchsicht und Analyse der waldorfpädagogischen Literaturdidaktik der Oberstufe. Diese beinhaltet sowohl methodisch als auch didaktisch einige diskursrelevante Ansätze, wie beispielsweise hinsichtlich der Strukturierung und Gliederung des Literaturunterrichts, bezüglich der jugendpädagogischen Frage nach Liminalitätserfahrungen oder im Hinblick auf die Herstellung individueller Resonanzbeziehungen zur Welt. Der Gedanke eines „peripheren Ichs“, der sich aus der Erkenntnistheorie von Rudolf Steiner, dem Begründer der Waldorfpädagogik, ableitet, wird als konstituierendes Element des Buches wiederholt im Zusammenhang mit dem Motiv der ästhetischen Selbstbildung im Jugendalter aufgegriffen und variiert, zuletzt durch einen vom Autor für Lehrende entwickelten Ansatz peripheren oder pädagogischen Lesens. Der Autor leistet einen Beitrag zu einer Anthropologie des Ästhetischen im Sinne einer vielschichtigen, transformativen Selbstwerdung durch die Rezeption literarischer Kunstwerke.
Der Autor:
Philipp Kleinfercher, Freie Hochschule Stuttgart
Der Fachbereich:
Educational Science
Bibliography
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISBN | 978-3-96665-092-2 |
| eISBN | 978-3-96665-904-8 |
| Format | 14,8 x 21,0 cm |
| Scope | 261 |
| Year of publication | 2024 |
| Date of publication | 30.09.2024 |
| Edition | 1. |
| Language | Deutsch |
Produktsicherheit
Additional Content
Additional Content
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Authors
Autor*innen
Tags
KeywordsAdoleszenz, Deutschunterricht, Lesen, Literaturdidaktik, Rezeptionsprozess, Rezeptionsästhetik, Rudolf Steiner, Selbstbildung, Subjektkonstituierung, Waldorfpädagogik
Pressestimmen
Wie gewinnbringend es sein kann, Literaturdidaktik aus einer historischen Perspektive zu betrachten und daraus Konzepte für die Gegenwart und Zukunft zu gewinnen, zeigt die jüngst publizierte Dissertationsschrift von Philipp Kleinfercher. Dieser unternimmt es, Traditionslinien einer Erziehung durch Literatur in der Waldorfpädagogik nachzuzeichnen, sie mit rezeptionsästhetischen Ansätzen von der Frühromantik über Wolfgang Iser bis zu aktuellen literaturdidaktischen Positionen in Verbindung zu bringen und daraus ein eigenes Programm des »Lesen[s] als künstlerische[r] Tätigkeit« (Kleinfercher 2024, S. 226) abzuleiten. Ebenso beeindruckend wie in der Lektüre bereichernd ist dabei die Breite und Vielzahl an philosophischen, rezeptionsästhetischen und literaturdidaktischen Konzepten, die Kleinfercher zusammenbringt, angefangen von Fichtes Idealismus, welcher Romantiker wie Schlegel oder Novalis inspirierte und insbesondere maßgeblichen Einfluss auf Rudolf Steiners (literatur )pädagogische Überlegungen hatte, bis hin zu Spinners elf Aspekten, dem Heidelberger Unterrichtsgespräch, einer Resonanzpädagogik sensu Rosa oder auch einer responsiven Literaturdidaktik.
Johannes Odendahl, ide 3-2025
Allen denjenigen, die nach einer konkreten Utopie pädagogischen Handelns in Krisenzeiten suchen und an einer anspruchsvollen geistesgeschichtlich und anthropologisch dimensionierten Grundlegung und Aktualisierung von Literaturdidaktik und Waldorfpädagogik interessiert sind, sei dieses Buch zur Lektüre dringend ans Herz gelegt.
Rita Schumacher, Journal für Waldorfpädagogik, Juli 2025, S. 83-88
Mit diesem Buch leistet der Autor einen Beitrag zu einer Anthropologie des Ästhetischen im Sinne einer vielschichtigen, transformativen Selbstwerdung durch die Rezeption literarischer Kunstwerke.
Wilfried Wulfers, AOL-Bücherbrief, Annotierte Auswahl aktueller Bücher und elektronischer Medien, Jg. 44/2025
Das Buch schließt mit neun Gesichtspunkten, die für den Literaturunterricht entscheidend sind und Orientierung geben können – nicht nur für Schüler:innen. Auch wenn auf den ersten Blick vielleicht vor allem Pädagog:innen sich angesprochen fühlen, so sind die Fragen, die gestellt werden, für jeden interessant und bereichernd, der ein zeitgenössischer Mensch unserer komplexen und komplizierten Welt zu sein versucht.
Ariane Eichenberg, erziehungskunst waldorf.leben, 01-02/2025


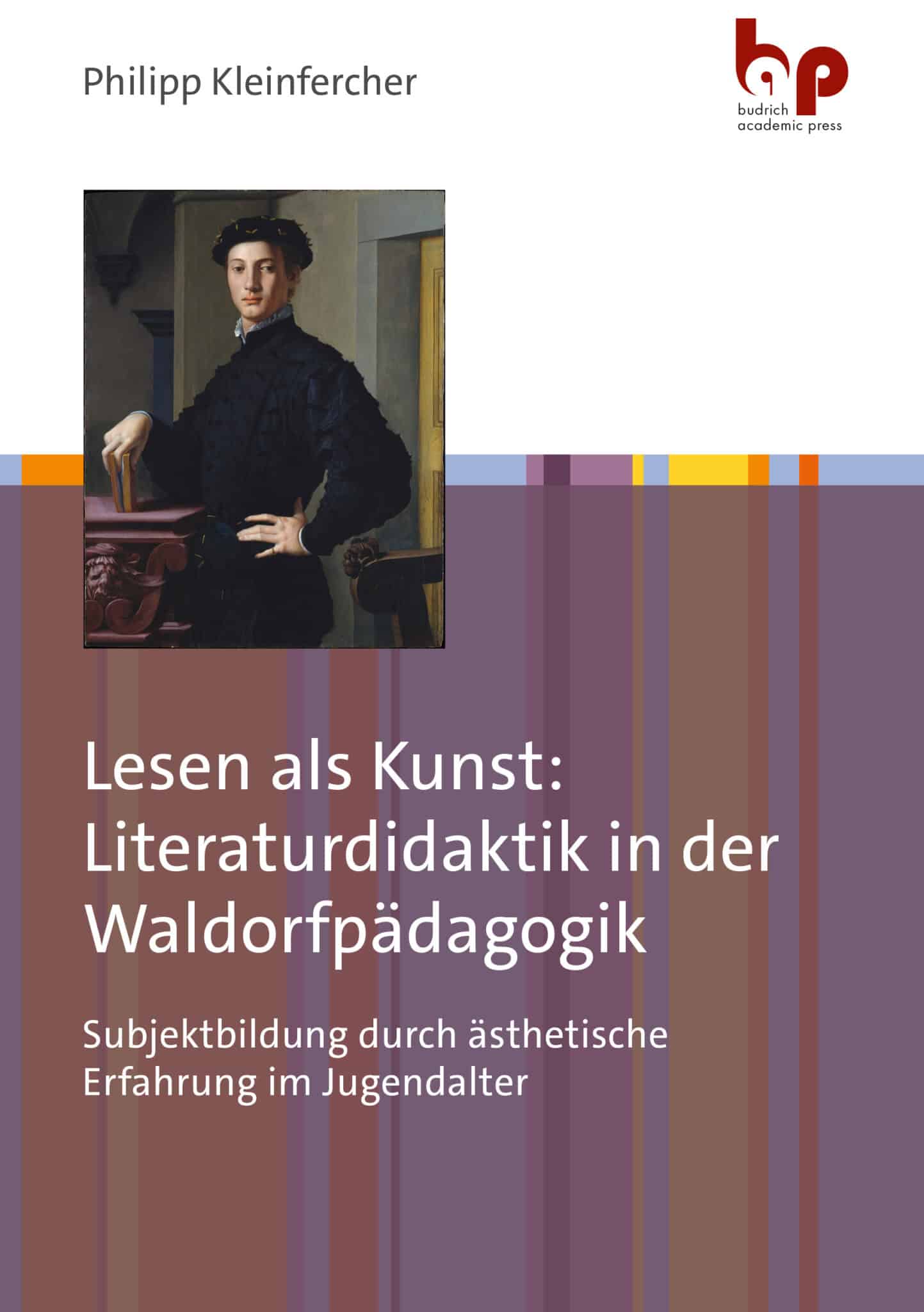


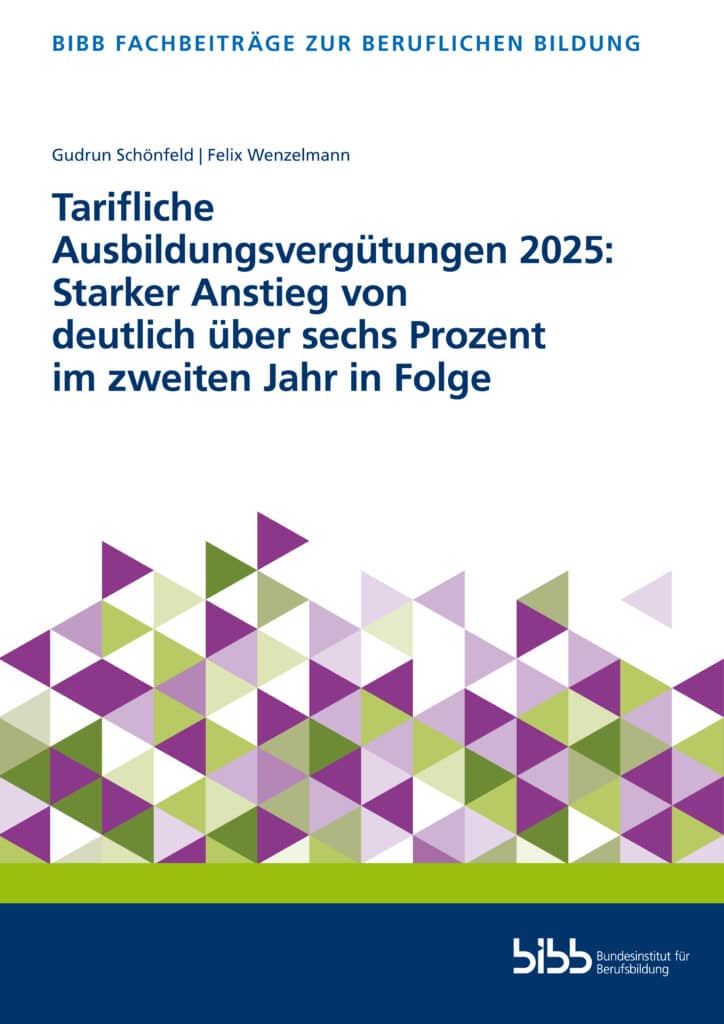
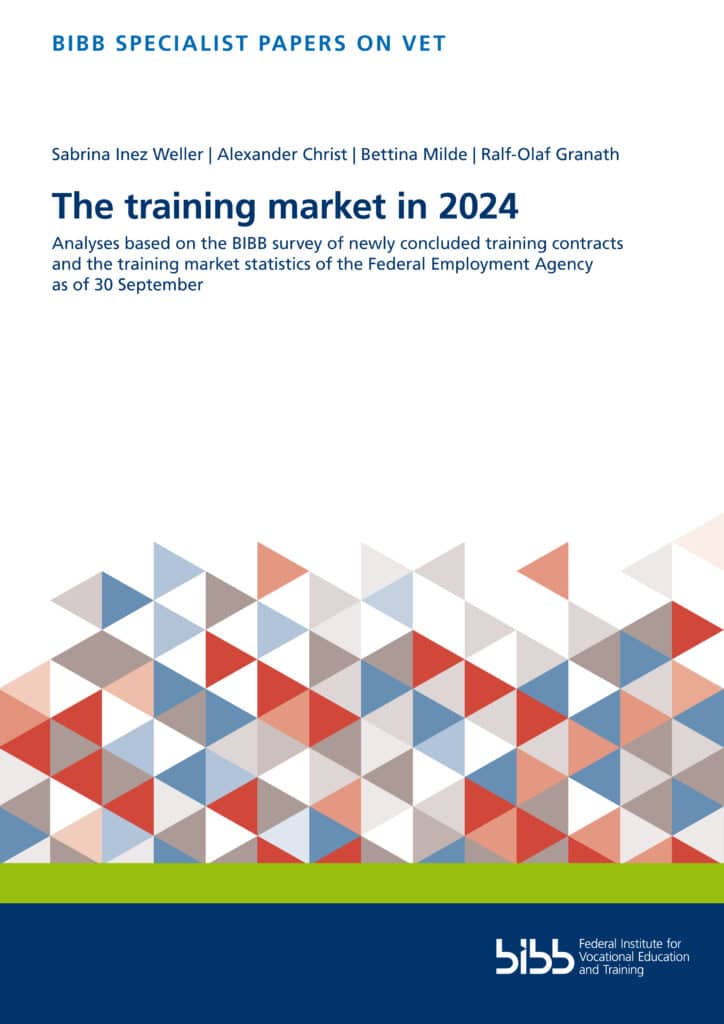
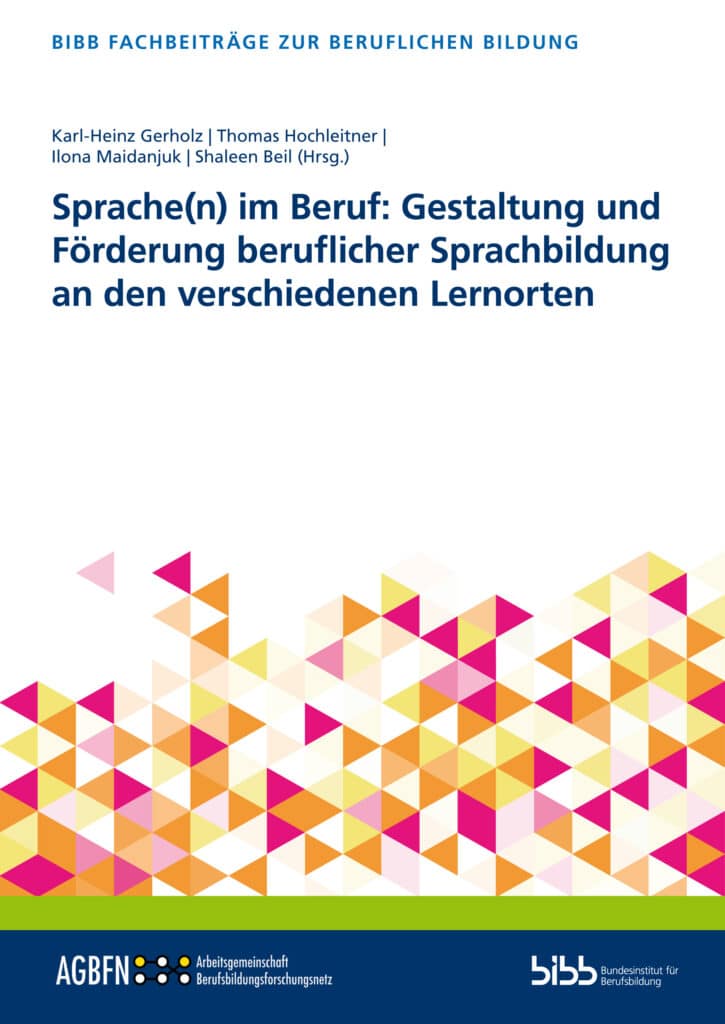
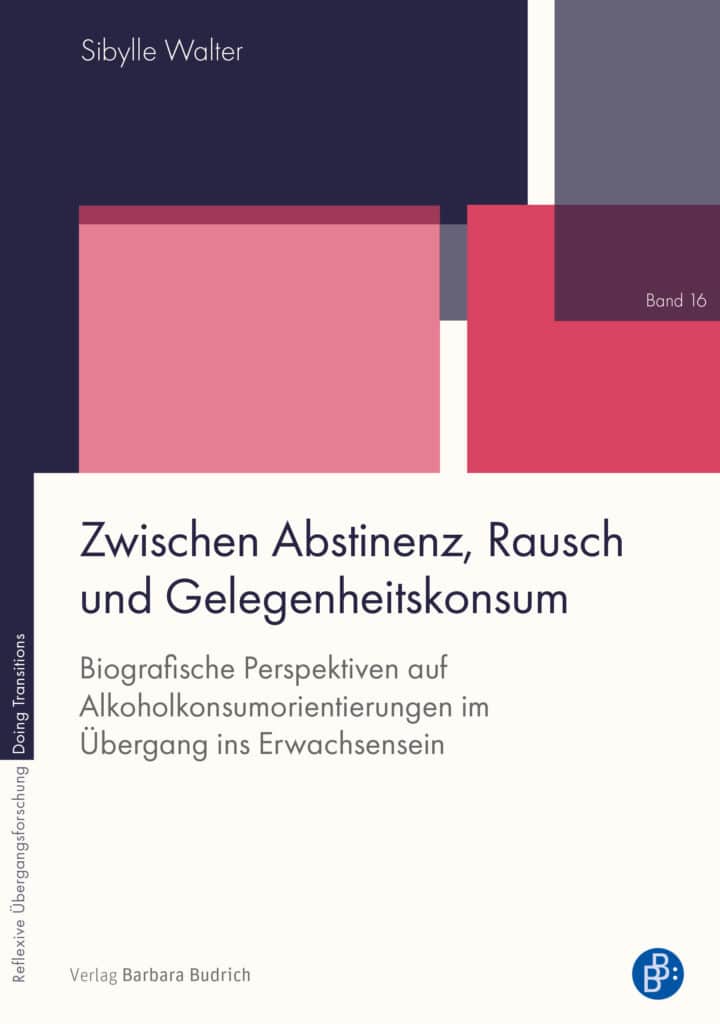
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.