Informationen zum Buch
Startseite » Programm » Psychosoziale Beratung und Soziale Arbeit
Psychosoziale Beratung und Soziale Arbeit
Empirische Befunde zur gesellschaftlichen Relevanz niedrigschwelliger Angebote am Beispiel der Telefonseelsorge
Erscheinungsdatum : 16.05.2022
0,00 € - 36,00 € inkl. MwSt.
Beschreibung
Der Sammelband greift die steigende Bedeutung niedrigschwelliger Beratungsangebote auf und geht der Frage nach den subjektiv gemeinten und den latenten Sinngehalten nach, die sich in den individuellen Anliegen der Nutzer*innen spiegeln. Dabei werden am Beispiel der Telefonseelsorge auf der Grundlage von Gesprächsprotokollen, Berichtsblättern der Geschäftsstellen sowie statistischer Daten sowohl die spezifischen psychosozialen Problemlagen der Anrufenden als auch die generellen Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels für den Einzelnen beleuchtet, die im Kontext niedrigschwelliger Beratungsformate deutlich zutage treten.
Seit der explosiven Einrichtung psychosozialer Beratungsstellen in den 1970er Jahren lässt sich im Zuge beschleunigter Modernisierungsprozesse ein stetig wachsender Beratungsbedarf beobachten. Beratung erscheint in diesem Zusammenhang als zeitgemäße Form der Begleitung und Bearbeitung von Orientierungs- und Bewältigungsproblemen moderner Lebensführung, bei der wegweisende und haltgebende „Leitplanken“ immer mehr erodieren. Insbesondere die Einrichtung so genannter Krisentelefone, zu denen die Telefonseelsorge oder das Kinder- und Jugendtelefon gehören, deuten auf einen erheblichen Bedarf eines anonymen Gesprächsangebots hin, der für fluide Gesellschaften, in denen sich ein Wandel der sozialen Ordnung ins Ungewisse vollzieht, charakteristisch zu sein scheint. Im Vergleich zur steigenden Bedeutung niedrigschwelliger Beratungsangebote mangelt es jedoch immer noch an empirischen Studien, die sowohl die Problemlagen und Motivationen der Anrufer*innen beleuchten als auch die soziale Bedeutung dieser Angebote auf der Folie gesamtgesellschaftlicher Entwicklungsprozesse reflektieren. Dieses Forschungsdesiderat greift der Sammelband auf, der am Beispiel der Telefonseelsorge den genannten Aspekten in insgesamt fünf Beiträgen nachgeht. Als Grundlage dafür dienen vor allem drei aktuelle empirische Studien, deren Ergebnisse vorgestellt, diskutiert und in den Kontext der allgemeinen Beratungsforschung eingeordnet werden. Anhand dieser Untersuchungen wird zum einen mit Hilfe quantitativ ausgewerteter Daten das manifeste Nutzungsverhalten von Anrufenden sichtbar, während zwei weitere qualitativ angelegte Studien die subjektiven Anliegen sowie die latenten Problemstrukturen von Nutzer*innen nachzeichnen. Insgesamt liefert der Sammelband einen wichtigen Beitrag zur Beratungsforschung, da nicht zuletzt Einblicke in realtypische Beratungsprozesse ermöglicht werden.
Inhaltsverzeichnis + Leseprobe
Die Herausgeberinnen:
Walburga Hoff, Professorin für Soziale Arbeit und Ethik an der Fakultät Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften der Universität Vechta
Christiane Rohleder, Professorin für Soziologie an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abt. Münster
Hier finden Sie den Waschzettel zum Buch (PDF-Infoblatt).
Die Zielgruppe:
Forschende und Praxis der Sozialen Arbeit und der praktischen Theologie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISBN | 978-3-8474-2409-3 |
| eISBN | 978-3-8474-1833-7 |
| Format | 14,8 x 21 cm |
| Umfang | 339 |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Erscheinungsdatum | 16.05.2022 |
| Auflage | 1. |
| Sprache | Deutsch |
| Reihe | |
| Band | 28 |
Autor*innen
SchlagwörterBeratung in Krisensituationen, Beratungsdienste, Beratungsforschung, Beratungsprozesse, Ehrenamtliche Beratung, Evaluation von Beratungsangeboten, Latente Sinnstrukturen, Modernisierungsprozesse, Realtypische Beratungsprozesse, Seelsorge, Seelsorge am Telefon, subjektive Anliegen von Anrufer, Telefonische Beratung, Telefonseelsorge, Typen von Anrufern bei der Telefonseelsorge, Typologie der Anrufer
Beschreibung
Beschreibung
Der Sammelband greift die steigende Bedeutung niedrigschwelliger Beratungsangebote auf und geht der Frage nach den subjektiv gemeinten und den latenten Sinngehalten nach, die sich in den individuellen Anliegen der Nutzer*innen spiegeln. Dabei werden am Beispiel der Telefonseelsorge auf der Grundlage von Gesprächsprotokollen, Berichtsblättern der Geschäftsstellen sowie statistischer Daten sowohl die spezifischen psychosozialen Problemlagen der Anrufenden als auch die generellen Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels für den Einzelnen beleuchtet, die im Kontext niedrigschwelliger Beratungsformate deutlich zutage treten.
Seit der explosiven Einrichtung psychosozialer Beratungsstellen in den 1970er Jahren lässt sich im Zuge beschleunigter Modernisierungsprozesse ein stetig wachsender Beratungsbedarf beobachten. Beratung erscheint in diesem Zusammenhang als zeitgemäße Form der Begleitung und Bearbeitung von Orientierungs- und Bewältigungsproblemen moderner Lebensführung, bei der wegweisende und haltgebende „Leitplanken“ immer mehr erodieren. Insbesondere die Einrichtung so genannter Krisentelefone, zu denen die Telefonseelsorge oder das Kinder- und Jugendtelefon gehören, deuten auf einen erheblichen Bedarf eines anonymen Gesprächsangebots hin, der für fluide Gesellschaften, in denen sich ein Wandel der sozialen Ordnung ins Ungewisse vollzieht, charakteristisch zu sein scheint. Im Vergleich zur steigenden Bedeutung niedrigschwelliger Beratungsangebote mangelt es jedoch immer noch an empirischen Studien, die sowohl die Problemlagen und Motivationen der Anrufer*innen beleuchten als auch die soziale Bedeutung dieser Angebote auf der Folie gesamtgesellschaftlicher Entwicklungsprozesse reflektieren. Dieses Forschungsdesiderat greift der Sammelband auf, der am Beispiel der Telefonseelsorge den genannten Aspekten in insgesamt fünf Beiträgen nachgeht. Als Grundlage dafür dienen vor allem drei aktuelle empirische Studien, deren Ergebnisse vorgestellt, diskutiert und in den Kontext der allgemeinen Beratungsforschung eingeordnet werden. Anhand dieser Untersuchungen wird zum einen mit Hilfe quantitativ ausgewerteter Daten das manifeste Nutzungsverhalten von Anrufenden sichtbar, während zwei weitere qualitativ angelegte Studien die subjektiven Anliegen sowie die latenten Problemstrukturen von Nutzer*innen nachzeichnen. Insgesamt liefert der Sammelband einen wichtigen Beitrag zur Beratungsforschung, da nicht zuletzt Einblicke in realtypische Beratungsprozesse ermöglicht werden.
Inhaltsverzeichnis + Leseprobe
Die Herausgeberinnen:
Walburga Hoff, Professorin für Soziale Arbeit und Ethik an der Fakultät Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften der Universität Vechta
Christiane Rohleder, Professorin für Soziologie an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Abt. Münster
Hier finden Sie den Waschzettel zum Buch (PDF-Infoblatt).
Die Zielgruppe:
Forschende und Praxis der Sozialen Arbeit und der praktischen Theologie
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISBN | 978-3-8474-2409-3 |
| eISBN | 978-3-8474-1833-7 |
| Format | 14,8 x 21 cm |
| Umfang | 339 |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Erscheinungsdatum | 16.05.2022 |
| Auflage | 1. |
| Sprache | Deutsch |
| Reihe | |
| Band | 28 |
Produktsicherheit
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterBeratung in Krisensituationen, Beratungsdienste, Beratungsforschung, Beratungsprozesse, Ehrenamtliche Beratung, Evaluation von Beratungsangeboten, Latente Sinnstrukturen, Modernisierungsprozesse, Realtypische Beratungsprozesse, Seelsorge, Seelsorge am Telefon, subjektive Anliegen von Anrufer, Telefonische Beratung, Telefonseelsorge, Typen von Anrufern bei der Telefonseelsorge, Typologie der Anrufer
Das könnte Sie auch interessieren:
Verlag Barbara Budrich
- +49 (0)2171.79491-50
- info@budrich.de
-
Stauffenbergstr. 7
51379 Leverkusen
Deutschland








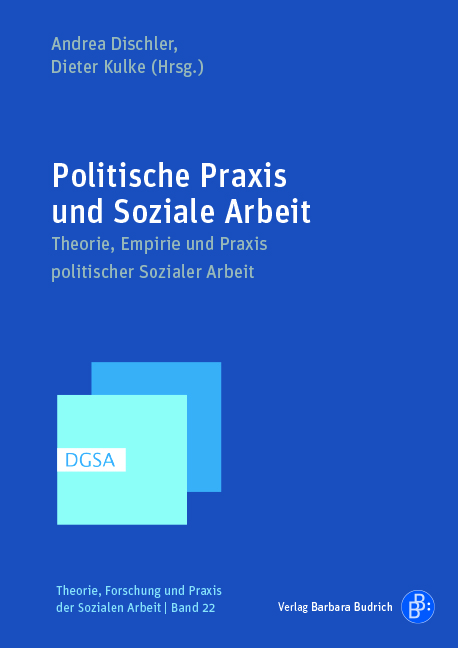


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.