Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » ZISU 14 (2025) | Schule und Unterricht in der (post-)migrantischen Gesellschaft – Migration und Mehrsprachigkeit
ZISU 14 (2025) | Schule und Unterricht in der (post-)migrantischen Gesellschaft – Migration und Mehrsprachigkeit
Erscheinungsdatum : 21.05.2025
27,00 €
- Inhalt
- Bibliografie
- Produktsicherheit
- Zusatzmaterial
- Bewertungen (0)
- Autor*innen
- Schlagwörter
- Abstracts
Inhalt
ZISU – Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung
Heft 14 (2025): Schule und Unterricht in der (post-)migrantischen Gesellschaft – Migration und Mehrsprachigkeit
hrsg. von: Andreas Bonnet, Merle Hummrich, Thorsten Merl & Matthias Schierz
Editorial
Andreas Bonnet / Merle Hummrich / Thorsten Merl / Matthias Schierz: Schule und Unterricht in der (post-)migrantischen Gesellschaft – Migration und Mehrsprachigkeit. Ein Basisbeitrag zur Einführung
Thementeil
Ellen Kollender / Dorothee Schwendowius: „Was die Organisation betrifft, ham wir sicherlich vom System her was gelernt“: Neue schulische Routinen und institutionelle Ausschlüsse im Kontext der Fluchtmigration aus der Ukraine (im Open Access verfügbar)
Ioanna Lialiou: Internationale Lehrkräfte mit Fluchterfahrung im Umgang mit sprachlichen Normen im deutschen Schulsystem
Annika Koch: Teachers’ professional attitudes toward Muslim religious norms: studying the organizational context of moral position-taking
Jessica Löser / Jacqueline Tietz / Birgit Schädlich: Sprechen über Sprachlichkeit im schulischen Kontext. Ethnografische Beobachtungen zu Wissenspraktiken in einem Kollegium
Allgemeiner Teil
Katharina Gather / Judith Küper: Von Subjekt- und Sachbezügen im Pädagogikunterricht. Zur Herstellung von Fachlichkeit im Unterricht im Adressierungsgeschehen
Julia Sacher / Marina Bonanati: doing being normative – Sprechen über schulische Interaktionspraxis zwischen Normativität und Deskriptivität
Oxana Ivanova-Chessex / Anja Morawietz: Kinder als Subjekte der Bildrezeption? Empirische Erkundungen in schulischen und musealen Kontexten
Rezensionen
Thorsten Merl: Schumann, Daniel (2024): Epistemologien der Integration: Wissenspolitiken der postmigrantischen Gesellschaft am Beispiel von Schulbüchern. Bielefeld: transcript
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zisu.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZISU-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 2191-3560 |
| eISSN | 2195-2671 |
| ISBN | 978-3-8474-3169-5 |
| Jahrgang | 14. Jahrgang 2025 |
| Ausgabe | 14 (2025) |
| Erscheinungsdatum | 21.05.2025 |
| Umfang | 144 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Zusatzmaterial
Autor*innen
SchlagwörterAdressierungsanalyse, Bildrezeption, Differenzierung, documentary method, Ethnografie, Fachlichkeit, Fachunterrichtsforschung, Flucht, Gesprächsanalyse, Handlungsfähigkeit der Kinder, Hochschulsozialisation, international ausgebildete Lehrkräfte, Kasuistik, Lehrerbildung, Mai 2025, Mehrsprachigkeit, Migration, native-Speakerism, Normativität, pedagogical attitudes, Praxeologie, Praxistheorie, Professionalisierung, Pädagogikunterricht, religious diversity, Routine, Schule, Schulforschung, studentische Gruppenarbeit, Subjektivierung, teacher professionalization, Ukraine, Unterricht, Videographie, Wissenstransfer
Abstracts
„Was die Organisation betrifft, ham wir sicherlich vom System her was gelernt“: Neue schulische Routinen und institutionelle Ausschlüsse im Kontext der Fluchtmigration aus der Ukraine (Ellen Kollender, Dorothee Schwendowius)
Der Beitrag fokussiert aus einer migrationsgesellschaftlichen Perspektive die Etablierung neuer schulischer Routinen im Kontext der Fluchtmigrationen der letzten Jahre. Mit Fokus auf die Deutungen schulischer Professioneller in Sekundarschulen in zwei Bundesländern wird die Institutionalisierung schulorganisatorischer Praktiken rekonstruiert, die auf den Einbezug geflüchteter Schüler*innen und Eltern gerichtet sind. Am Beispiel der Institutionalisierung von teilintegrativen Beschulungsformen und Modellen der Deutschförderung sowie neuer Routinen der Adressierung geflüchteter Eltern wird betrachtet, wie Ausschlüsse, natio-ethno-kulturelle Grenzziehungen sowie Schlechterstellungen geflüchteter Schüler*innen und Eltern durch diese Institutionalisierungen hinterfragt, verändert und/oder neu etabliert werden. Der Beitrag leistet so einen Beitrag zur Forschung über institutionelle Diskriminierung im Kontext aktueller Fluchtmigrationen. Schlagwörter: Flucht, Schule, Differenzierung, Routine, Ukraine
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Internationale Lehrkräfte mit Fluchterfahrung im Umgang mit sprachlichen Normen im deutschen Schulsystem (Ioanna Lialiou)
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit den Inklusionsperspektiven international ausgebildeter Lehrkräfte mit Fluchterfahrung, die am Qualifizierungsprogramm „Lehrkräfte Plus“ teilnehmen und in das deutsche Schulsystem einmünden. Im Fokus der Arbeit steht die Rolle der Sprache für den Professionalisierungsprozess sowie der Umgang mit den sprachlichen Normen der monolingualen Schule. Um Zugang zu den Erfahrungen und Orientierungen der Lehrkräfte zu erhalten, wurden (berufs-)biografische Interviews mit MINT-Lehrkräften aus dem Programm qualitativ-rekonstruktiv untersucht und mit der dokumentarischen Methode ausgewertet. Erste Ergebnisse zeigen, dass neben der erwartbaren Dominanz der deutschen Sprache auch kontrastierende Perspektiven im Umgang mit den sprachlichen Normen der Schule hervortreten, die eine zentrale Bedeutung für den Professionalisierungsprozess internationaler Lehrkräfte haben. Dabei konnten zwei Typen rekonstruiert werden, die im Folgenden vorgestellt und diskutiert werden. Schlagwörter: Professionalisierung, international ausgebildete Lehrkräfte, native-Speakerism, Mehrsprachigkeit
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Teachers’ professional attitudes toward Muslim religious norms: studying the organizational context of moral position-taking (Annika Koch)
Many studies to date have shown how teachers disadvantage Muslim students due to unconscious bias. Much less is known about how teachers’ attitudes are influenced by the organizational context of their schools. I aim to contribute to filling this research gap by analyzing interviews with teachers at high schools with a large share of Muslim students. I show how my interview partners were forced to position themselves according to the religious norms of their students and the secularized Christian norms that are often taken for granted in the German school system. My interview partners adopted various ethical perspectives. However, their positioning was always ambivalent and linked to both recognizing their students’ backgrounds and distancing themselves from this. Keywords: Religious diversity; pedagogical attitudes; teacher professionalization; Documentary Method
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Sprechen über Sprachlichkeit im schulischen Kontext. Ethnografische Beobachtungen zu Wissenspraktiken in einem Kollegium (Jessica Löser, Jacqueline Tietz, Birgit Schädlich)
Dieser Beitrag fragt nach den Aushandlungsprozessen unter Lehrkräften zu ,Sprachlichkeit‘, welche wir als Voraussetzung (lebensweltlich bedingte Mehrsprachigkeit) und Ziel (Mehrsprachigkeit als Fluchtpunkt schulischer Fremdsprachenangebote) schulischer Bildung verstehen. Basierend auf einer ethnografischen Fallstudie rekonstruieren wir, wie Normen und damit verbundenen Inklusions- und Exklusionsprozesse in Gesprächen zu Sprachlichkeit in einem Kollegium aufgerufen werden. Dabei oszillieren wir in unserer Argumentation zwischen empirischen Rekonstruktionen und wissenschaftlichen Diskursen. Im Ergebnis zeigen wir verschiedene Wissenspraktiken im Kollegium auf, die widersprüchlich zueinander stehen. Insgesamt wird deutlich: Obwohl an sprachliche Bildung inklusive Ansprüche gestellt werden, sind die schulischen Sprachenangebote doch hochgradig diversifiziert und mit bisweilen stark exkludierenden Praktiken assoziiert. Schlagwörter: Mehrsprachigkeit – Ethnografie – Schulforschung – Wissenstransfer – Praxeologie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Von Subjekt- und Sachbezügen im Pädagogikunterricht. Zur Herstellung von Fachlichkeit im Unterricht im Adressierungsgeschehen (Katharina Gather, Judith Küper)
In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, wie Schüler*innen im Pädagogikunterricht in Sachbezüge verwickelt werden. Darüber nehmen wir in den Blick, wie die Sache des Unterrichts als zu lernende hervorgebracht wird. In unserer empirischen Rekonstruktion gehen wir adressierungsanalytisch vor, um anschließend zu diskutieren, inwiefern die Materialbeobachtungen aufschlussreich dafür sein können, wie Fachlichkeit in unterrichtlicher Interaktion hergestellt wird. Schlagwörter: Fachlichkeit, Fachunterrichtsforschung, Praxistheorie, Subjektivierung, Adressierungsanalyse, Pädagogikunterricht
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
doing being normative – Sprechen über schulische Interaktionspraxis zwischen Normativität und Deskriptivität (Julia Sacher, Marina Bonanati)
Die kasuistische Arbeit an Datenmaterial von authentischem Unterricht stellt angehende Lehrer*innen vor Herausforderungen: Die Perspektive einer bestimmten wissenschaftlichen Disziplin einzunehmen oder die entsprechend angemessene Fachterminologie zu verwenden, ist für Studierende nicht selbstverständlich. Wir diskutieren in unserem Beitrag mit doing being normative eine spezifische studentische Interaktionspraxis im Kontext kasuistischer Lehre. Darunter verstehen wir die interaktive Verhandlung normativer Orientierungen an Datenmaterial im Rahmen gesprächsanalytisch-deskriptiv modellierter Fallarbeit mit Unterrichtstranskripten. Ausgangspunkt der Praktik ist das Lehrpersonenhandeln, das durch verschiedene Formen von Bewertungen und die Konstruktion von Perspektiven kritisiert wird. Wir argumentieren, dass Studierende mit doing being normative auf die hochschulischen Anforderungen der Datenarbeit reagieren. Schlagwörter: Lehrerbildung, studentische Gruppenarbeit, Normativität, Gesprächsanalyse, Kasuistik, Hochschulsozialisation
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Kinder als Subjekte der Bildrezeption? Empirische Erkundungen in schulischen und musealen Kontexten (Oxana Ivanova-Chessex, Anja Morawietz )
Die Bildrezeption stellt in den ersten Schuljahren ein wichtiges Element des Kunstunterrichts dar. In didaktischen Konzeptualisierungen zur Bildrezeption wird dabei die aktive, ko-deutende Rolle der Schüler*innen betont. Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, inwiefern und wie Kinder als Subjekte der Rezeption von Bildern aus der Kunst in schulischen und musealen Kontexten in Erscheinung treten. Um dieser Frage nachzugehen, wird im vorliegenden Beitrag die Praxis der Bildrezeption mit Kindern der ersten Jahre der Primarstufe unter subjektivierungs- und praxistheoretischen Perspektiven analysiert. Die hermeneutisch gedeuteten videographischen Daten verweisen auf Mikrofreiräume, die Kinder für sich erschließen und die sich in Relation zu im Unterricht wirksamen generationalen und pädagogischen Ordnungen entfalten. Schlagwörter: Bildrezeption, Videographie, Subjektivierung, Praxistheorie, Handlungsfähigkeit der Kinder
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
ZISU – Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung
Heft 14 (2025): Schule und Unterricht in der (post-)migrantischen Gesellschaft – Migration und Mehrsprachigkeit
hrsg. von: Andreas Bonnet, Merle Hummrich, Thorsten Merl & Matthias Schierz
Editorial
Andreas Bonnet / Merle Hummrich / Thorsten Merl / Matthias Schierz: Schule und Unterricht in der (post-)migrantischen Gesellschaft – Migration und Mehrsprachigkeit. Ein Basisbeitrag zur Einführung
Thementeil
Ellen Kollender / Dorothee Schwendowius: „Was die Organisation betrifft, ham wir sicherlich vom System her was gelernt“: Neue schulische Routinen und institutionelle Ausschlüsse im Kontext der Fluchtmigration aus der Ukraine (im Open Access verfügbar)
Ioanna Lialiou: Internationale Lehrkräfte mit Fluchterfahrung im Umgang mit sprachlichen Normen im deutschen Schulsystem
Annika Koch: Teachers’ professional attitudes toward Muslim religious norms: studying the organizational context of moral position-taking
Jessica Löser / Jacqueline Tietz / Birgit Schädlich: Sprechen über Sprachlichkeit im schulischen Kontext. Ethnografische Beobachtungen zu Wissenspraktiken in einem Kollegium
Allgemeiner Teil
Katharina Gather / Judith Küper: Von Subjekt- und Sachbezügen im Pädagogikunterricht. Zur Herstellung von Fachlichkeit im Unterricht im Adressierungsgeschehen
Julia Sacher / Marina Bonanati: doing being normative – Sprechen über schulische Interaktionspraxis zwischen Normativität und Deskriptivität
Oxana Ivanova-Chessex / Anja Morawietz: Kinder als Subjekte der Bildrezeption? Empirische Erkundungen in schulischen und musealen Kontexten
Rezensionen
Thorsten Merl: Schumann, Daniel (2024): Epistemologien der Integration: Wissenspolitiken der postmigrantischen Gesellschaft am Beispiel von Schulbüchern. Bielefeld: transcript
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zisu.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZISU-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 2191-3560 |
| eISSN | 2195-2671 |
| ISBN | 978-3-8474-3169-5 |
| Jahrgang | 14. Jahrgang 2025 |
| Ausgabe | 14 (2025) |
| Erscheinungsdatum | 21.05.2025 |
| Umfang | 144 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Zusatzmaterial
Zusatzmaterial
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterAdressierungsanalyse, Bildrezeption, Differenzierung, documentary method, Ethnografie, Fachlichkeit, Fachunterrichtsforschung, Flucht, Gesprächsanalyse, Handlungsfähigkeit der Kinder, Hochschulsozialisation, international ausgebildete Lehrkräfte, Kasuistik, Lehrerbildung, Mai 2025, Mehrsprachigkeit, Migration, native-Speakerism, Normativität, pedagogical attitudes, Praxeologie, Praxistheorie, Professionalisierung, Pädagogikunterricht, religious diversity, Routine, Schule, Schulforschung, studentische Gruppenarbeit, Subjektivierung, teacher professionalization, Ukraine, Unterricht, Videographie, Wissenstransfer
Abstracts
Abstracts
„Was die Organisation betrifft, ham wir sicherlich vom System her was gelernt“: Neue schulische Routinen und institutionelle Ausschlüsse im Kontext der Fluchtmigration aus der Ukraine (Ellen Kollender, Dorothee Schwendowius)
Der Beitrag fokussiert aus einer migrationsgesellschaftlichen Perspektive die Etablierung neuer schulischer Routinen im Kontext der Fluchtmigrationen der letzten Jahre. Mit Fokus auf die Deutungen schulischer Professioneller in Sekundarschulen in zwei Bundesländern wird die Institutionalisierung schulorganisatorischer Praktiken rekonstruiert, die auf den Einbezug geflüchteter Schüler*innen und Eltern gerichtet sind. Am Beispiel der Institutionalisierung von teilintegrativen Beschulungsformen und Modellen der Deutschförderung sowie neuer Routinen der Adressierung geflüchteter Eltern wird betrachtet, wie Ausschlüsse, natio-ethno-kulturelle Grenzziehungen sowie Schlechterstellungen geflüchteter Schüler*innen und Eltern durch diese Institutionalisierungen hinterfragt, verändert und/oder neu etabliert werden. Der Beitrag leistet so einen Beitrag zur Forschung über institutionelle Diskriminierung im Kontext aktueller Fluchtmigrationen. Schlagwörter: Flucht, Schule, Differenzierung, Routine, Ukraine
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Internationale Lehrkräfte mit Fluchterfahrung im Umgang mit sprachlichen Normen im deutschen Schulsystem (Ioanna Lialiou)
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit den Inklusionsperspektiven international ausgebildeter Lehrkräfte mit Fluchterfahrung, die am Qualifizierungsprogramm „Lehrkräfte Plus“ teilnehmen und in das deutsche Schulsystem einmünden. Im Fokus der Arbeit steht die Rolle der Sprache für den Professionalisierungsprozess sowie der Umgang mit den sprachlichen Normen der monolingualen Schule. Um Zugang zu den Erfahrungen und Orientierungen der Lehrkräfte zu erhalten, wurden (berufs-)biografische Interviews mit MINT-Lehrkräften aus dem Programm qualitativ-rekonstruktiv untersucht und mit der dokumentarischen Methode ausgewertet. Erste Ergebnisse zeigen, dass neben der erwartbaren Dominanz der deutschen Sprache auch kontrastierende Perspektiven im Umgang mit den sprachlichen Normen der Schule hervortreten, die eine zentrale Bedeutung für den Professionalisierungsprozess internationaler Lehrkräfte haben. Dabei konnten zwei Typen rekonstruiert werden, die im Folgenden vorgestellt und diskutiert werden. Schlagwörter: Professionalisierung, international ausgebildete Lehrkräfte, native-Speakerism, Mehrsprachigkeit
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Teachers’ professional attitudes toward Muslim religious norms: studying the organizational context of moral position-taking (Annika Koch)
Many studies to date have shown how teachers disadvantage Muslim students due to unconscious bias. Much less is known about how teachers’ attitudes are influenced by the organizational context of their schools. I aim to contribute to filling this research gap by analyzing interviews with teachers at high schools with a large share of Muslim students. I show how my interview partners were forced to position themselves according to the religious norms of their students and the secularized Christian norms that are often taken for granted in the German school system. My interview partners adopted various ethical perspectives. However, their positioning was always ambivalent and linked to both recognizing their students’ backgrounds and distancing themselves from this. Keywords: Religious diversity; pedagogical attitudes; teacher professionalization; Documentary Method
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Sprechen über Sprachlichkeit im schulischen Kontext. Ethnografische Beobachtungen zu Wissenspraktiken in einem Kollegium (Jessica Löser, Jacqueline Tietz, Birgit Schädlich)
Dieser Beitrag fragt nach den Aushandlungsprozessen unter Lehrkräften zu ,Sprachlichkeit‘, welche wir als Voraussetzung (lebensweltlich bedingte Mehrsprachigkeit) und Ziel (Mehrsprachigkeit als Fluchtpunkt schulischer Fremdsprachenangebote) schulischer Bildung verstehen. Basierend auf einer ethnografischen Fallstudie rekonstruieren wir, wie Normen und damit verbundenen Inklusions- und Exklusionsprozesse in Gesprächen zu Sprachlichkeit in einem Kollegium aufgerufen werden. Dabei oszillieren wir in unserer Argumentation zwischen empirischen Rekonstruktionen und wissenschaftlichen Diskursen. Im Ergebnis zeigen wir verschiedene Wissenspraktiken im Kollegium auf, die widersprüchlich zueinander stehen. Insgesamt wird deutlich: Obwohl an sprachliche Bildung inklusive Ansprüche gestellt werden, sind die schulischen Sprachenangebote doch hochgradig diversifiziert und mit bisweilen stark exkludierenden Praktiken assoziiert. Schlagwörter: Mehrsprachigkeit – Ethnografie – Schulforschung – Wissenstransfer – Praxeologie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Von Subjekt- und Sachbezügen im Pädagogikunterricht. Zur Herstellung von Fachlichkeit im Unterricht im Adressierungsgeschehen (Katharina Gather, Judith Küper)
In diesem Beitrag gehen wir der Frage nach, wie Schüler*innen im Pädagogikunterricht in Sachbezüge verwickelt werden. Darüber nehmen wir in den Blick, wie die Sache des Unterrichts als zu lernende hervorgebracht wird. In unserer empirischen Rekonstruktion gehen wir adressierungsanalytisch vor, um anschließend zu diskutieren, inwiefern die Materialbeobachtungen aufschlussreich dafür sein können, wie Fachlichkeit in unterrichtlicher Interaktion hergestellt wird. Schlagwörter: Fachlichkeit, Fachunterrichtsforschung, Praxistheorie, Subjektivierung, Adressierungsanalyse, Pädagogikunterricht
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
doing being normative – Sprechen über schulische Interaktionspraxis zwischen Normativität und Deskriptivität (Julia Sacher, Marina Bonanati)
Die kasuistische Arbeit an Datenmaterial von authentischem Unterricht stellt angehende Lehrer*innen vor Herausforderungen: Die Perspektive einer bestimmten wissenschaftlichen Disziplin einzunehmen oder die entsprechend angemessene Fachterminologie zu verwenden, ist für Studierende nicht selbstverständlich. Wir diskutieren in unserem Beitrag mit doing being normative eine spezifische studentische Interaktionspraxis im Kontext kasuistischer Lehre. Darunter verstehen wir die interaktive Verhandlung normativer Orientierungen an Datenmaterial im Rahmen gesprächsanalytisch-deskriptiv modellierter Fallarbeit mit Unterrichtstranskripten. Ausgangspunkt der Praktik ist das Lehrpersonenhandeln, das durch verschiedene Formen von Bewertungen und die Konstruktion von Perspektiven kritisiert wird. Wir argumentieren, dass Studierende mit doing being normative auf die hochschulischen Anforderungen der Datenarbeit reagieren. Schlagwörter: Lehrerbildung, studentische Gruppenarbeit, Normativität, Gesprächsanalyse, Kasuistik, Hochschulsozialisation
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Kinder als Subjekte der Bildrezeption? Empirische Erkundungen in schulischen und musealen Kontexten (Oxana Ivanova-Chessex, Anja Morawietz )
Die Bildrezeption stellt in den ersten Schuljahren ein wichtiges Element des Kunstunterrichts dar. In didaktischen Konzeptualisierungen zur Bildrezeption wird dabei die aktive, ko-deutende Rolle der Schüler*innen betont. Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, inwiefern und wie Kinder als Subjekte der Rezeption von Bildern aus der Kunst in schulischen und musealen Kontexten in Erscheinung treten. Um dieser Frage nachzugehen, wird im vorliegenden Beitrag die Praxis der Bildrezeption mit Kindern der ersten Jahre der Primarstufe unter subjektivierungs- und praxistheoretischen Perspektiven analysiert. Die hermeneutisch gedeuteten videographischen Daten verweisen auf Mikrofreiräume, die Kinder für sich erschließen und die sich in Relation zu im Unterricht wirksamen generationalen und pädagogischen Ordnungen entfalten. Schlagwörter: Bildrezeption, Videographie, Subjektivierung, Praxistheorie, Handlungsfähigkeit der Kinder
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)


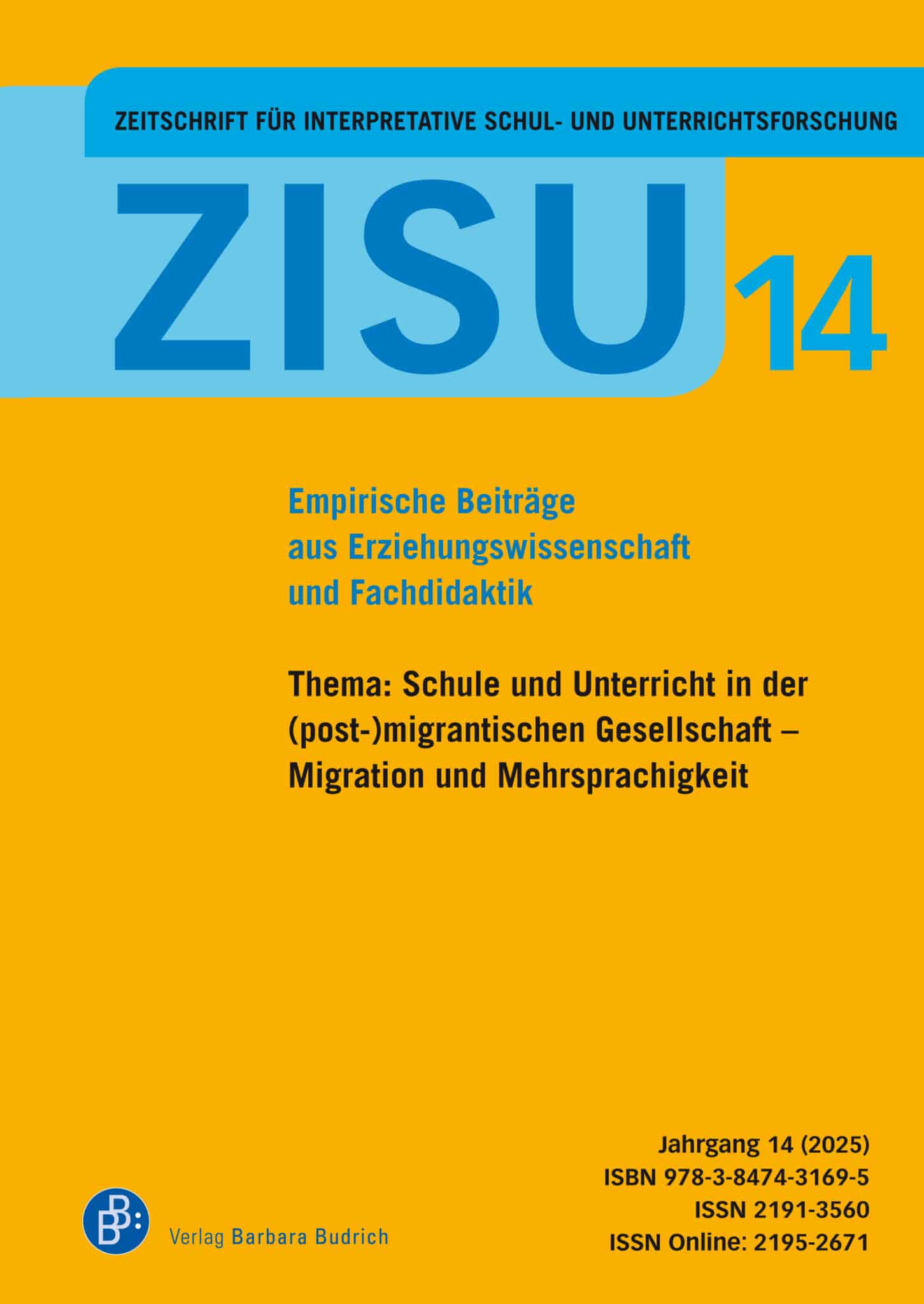


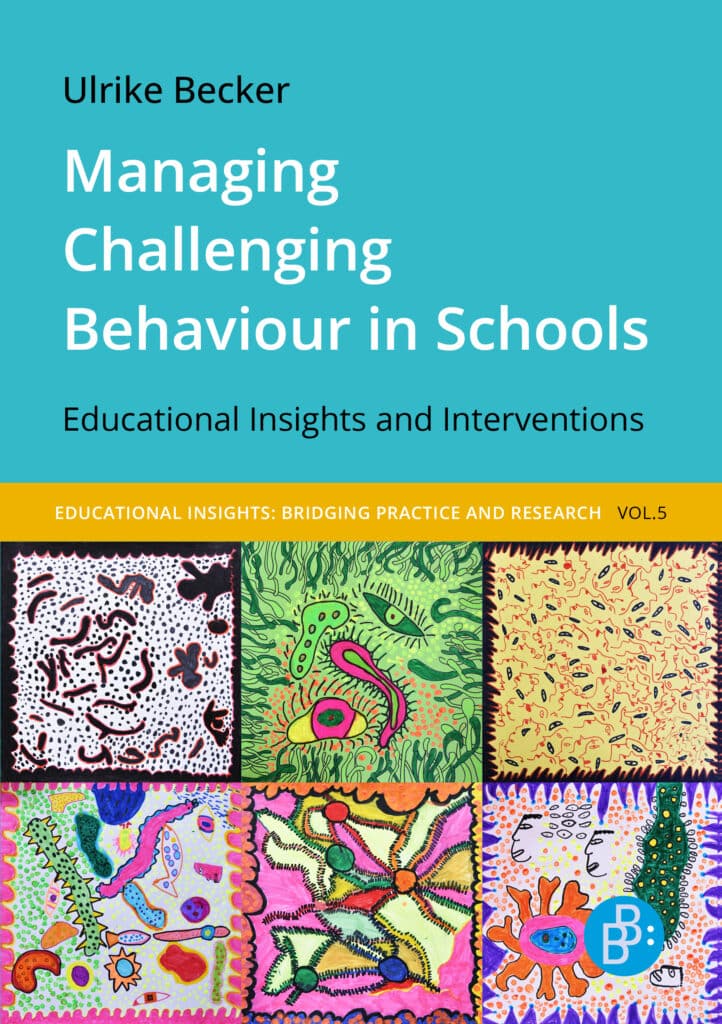


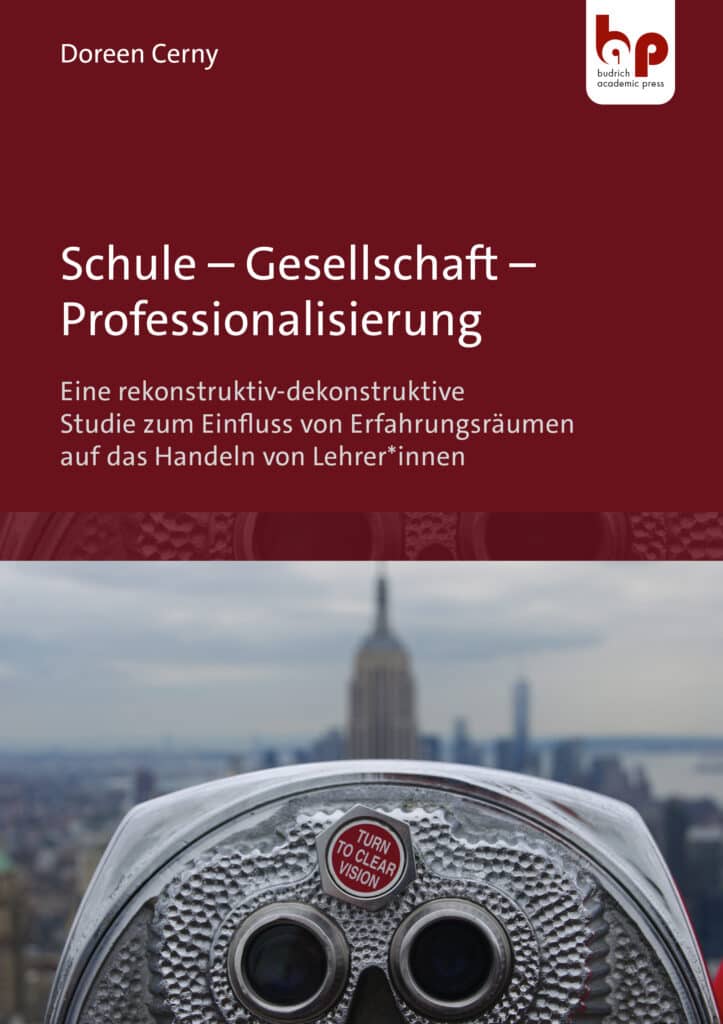
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.