Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » ZPTh 2-2018 | Themenheft zur politischen Theorie von Judith N. Shklar
ZPTh 2-2018 | Themenheft zur politischen Theorie von Judith N. Shklar
Erscheinungsdatum : 28.01.2020
0,00 € - 30,00 € inkl. MwSt.
Inhalt
ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie
2-2018: Themenheft zur politischen Theorie von Judith N. Shklar
Gast-Hrsg.: Hannes Bajohr & Rieke Trimҫev
Hannes Bajohr / Rieke Trimҫev: Editorial der Gastherausgeber
Übersetzungen
Judith N. Shklar: Gewissen und Freiheit
Seyla Benhabib / Paul Linden-Retek: Judith Shklars Kritik des Legalismus
Abhandlungen
Tobias Bülte: Politisches Denken jenseits von Begründung und Fatalismus. Überlegungen zu einer erweiterten Lesart Judith Shklars
Samantha Ashenden / Andreas Hess: Republican Elements in the Liberalism of Fear
Peter Vogt: Skepsis und Sozialdemokratie – Mésalliance oder Zukunftsbündnis? Ein Plädoyer im Anschluss an Judith Shklar
Christine Unrau: Judith Shklars Sinn für Veränderung Quellen und Voraussetzungen politischen Wandels im Denken Judith Shklars
Rieke Trimҫev: Verbindlichkeitskonflikte und politische Verpflichtung
Weitere Abhandlungen
Urs Lindner: Von der Chancengleichheit zur gleichen Teilhabe. Zur Rechtfertigung von Gleichstellungspolitik
Rezensionen
Micha Steinwachs: Freiheit und der skeptische Blick auf das Recht
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zpth.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZPTh-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1869-3016 |
| eISSN | 2196-2103 |
| Jahrgang | 9. Jahrgang 2018 |
| Ausgabe | 2 |
| Erscheinungsdatum | 28.01.2020 |
| Umfang | 137 |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Autor*innen
SchlagwörterBegründungstheorie, Chancengleichheit, demokratische Gleichheit, Dissens, Empathie, Freiheit, Gerechtigkeit, Gewissen, gleiche Teilhabe, Gleichstellungspolitik, Grausamkeit, Jean-Jacques Rousseau, Judith Shklar, Kritik, Legalismus, Liberalismus, Liberalismus der Furcht, Loyalität, negative und positive Freiheit, Pluralität, politische Verpflichtung, Republikanismus, Sinn für Ungerechtigkeit, Skepsis, Sozialdemokratie, Tugenden und Laster, Ungerechtigkeit, Veränderung
Abstracts
Politisches Denken jenseits von Begründung und Fatalismus. Überlegungen zu einer erweiterten Lesart Judith Shklars (Tobias Bülte)
In diesem Aufsatz zeige ich, dass Shklars liberale Politische Theorie und ihr Diktum, Grausamkeit an erste Stelle zu setzen, ohne begründungstheoretische Fundierung auskommen. Shklars Liberalismus erscheint dabei als eine parteiische, herrschaftskritische Perspektive ohne idealen Begründungsbezug, die nach kontextgebundenen und historischen Blockaden und Möglichkeiten der Selbstbestimmung gerade auch schwacher AkteurInnen fragt. Dafür arbeite ich Shklars Skepsis anhand dreier Weichenstellungen ihres Denkens heraus – Pluralität, Dissens und subjektiver Sinn für Ungerechtigkeit –, die einem begründungstheoretische Vorgehen entgegenstehen. In einem zweiten Schritt zeige ich dann, dass ihre Orientierung an der Grausamkeit keine statische, minimale Grundnorm ist, sondern eine beständige Befragung der Machtverhältnisse erfordert und eine fordernde, politische Perspektive jenseits der akuten Grausamkeitsverhinderung öffnet. Schlüsselwörter: Shklar, Pluralität, Dissens, Ungerechtigkeit, Liberalismus, Begründungstheorie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Republican Elements in the Liberalism of Fear (Samantha Ashenden, Andreas Hess)
Judith Shklars Liberalismus der Furcht unterscheidet sich von anderen Liberalismen. Er gewinnt seine einzigartige Prägung und Qualität durch eine lang andauernde und konsequente kritische Auseinandersetzung mit dem Republikanismus. Ihre Diskussion der gegenwärtigen Relevanz von Tugenden und Lastern, von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, die Fragen von Rechten, Repräsentation, Staatsbürgerschaft und Demokratie weisen auf ältere republikanische Einflüsse hin. Shklar war sich dennoch darüber im Klaren, dass ein unrekonstruierter Republikanismus und die republikanische Vorstellung eines tugendhaften Lebens auf moderne gesellschaftliche und politische Bedingungen nicht mehr anwendbar waren. Dies wird besonders deutlich in ihrer Diskussion über Rousseau und in ihrer Studie Ganz normale Laster. Der irreduzibel pluralistische und individualistische Charakter moderner Demokratien hat es unvorstellbar werden lassen, dass wir eine einheitliche Vorstellung des tugendhaften Lebens hegen. Shklars Betonung der positiven Freiheit, die sich kritisch gegen Isaiah Berlins Argument richtet, negative Rechte und negative Freiheit ständen im Mittelpunkt des modernen Liberalismus; ihr Beharren auf der Notwendigkeit eines gemeinsamen Geistes, wie er in ihrer Studie über Montesquieu zum Ausdruck kommt; die Notwendigkeit, in Hinsicht auf Wahl und Verdienst gleichgestellt zu sein, wie er in der amerikanischen Staatsbürgerschaft betont wird; und schließlich ihre Diskussion des sich wandelnden Charakters von Loyalität und politischer Verpflichtung in ihren letzten Harvard Vorträgen, sind allesamt Ausdruck der republikanischen Einflüsse, die in ihrem Elementarliberalismus zu erkennen sind. Schlüsselwörter: Republikanismus, Liberalismus der Furcht, Rousseau, Tugenden und Laster, negative und positive Freiheit, Loyalität, politische Verpflichtung
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Skepsis und Sozialdemokratie – Mésalliance oder Zukunftsbündnis? Ein Plädoyer im Anschluss an Judith Shklar (Peter Vogt)
Judith Shklars „Liberalismus der Furcht“ wird oft als ein Plädoyer für eine Art Nachtwächterliberalismus interpretiert. Im Gegensatz zu dieser Deutung konzentriere ich mich im Folgenden auf die gleichsam sozialdemokratischen Züge von Shklars Liberalismus. Diese Züge, so will ich zeigen, sind eng mit Shklars Auffassung von Skepsis verbunden. Shklars frühe historische Skepsis wendet sich sowohl gegen einen melancholischen Kulturpessimismus wie gegen einen illusionären Fortschrittsglauben. Für Shklars späte politische Skepsis sind zwei Charakteristika entscheidend. Erstens: Im Anschluss an einen terminologischen Vorschlag Hugo Friedrichs lässt sich Shklars politische Skepsis als eine „erschließende“ im Unterschied zu einer „zersetzenden“ begreifen. Dabei folgt Shklar zweitens dem Begründungsmodell einer „negativen Rechtfertigung“ (A. Margalit) jenseits von Relativismus und der Suche nach Letztbegründung. Shklars so zu charakterisierende Skepsis weist eine natürliche Affinität zu einem sozialdemokratisch angereicherten Liberalismus auf. Shklars „Liberalismus der Furcht“, der sowohl auf historischer als auch politischer Skepsis beruht, mündet letztlich in eine „Sozialdemokratie der Furcht“ (T. Judt). Schlüsselwörter: Skepsis, Grausamkeit, Liberalismus, Sozialdemokratie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Judith Shklars Sinn für Veränderung Quellen und Voraussetzungen politischen Wandels im Denken Judith Shklars (Christine Unrau)
Obwohl es oft in die Schublade eines negativen Liberalismus der Schadensbegrenzung gesteckt wird, spielt in Judith Shklars Denken die Aussicht auf gezielte Veränderung und Verbesserung der politischen Bedingungen eine wichtige Rolle. Der Beitrag geht der Bedeutung dieses Themas im Werk Shklars nach und stellt dabei die Frage nach den Quellen und Voraussetzungen von Veränderung in den Mittelpunkt. Damit soll letztlich aufgezeigt werden, dass Shklars Denken nicht nur um eine negative Gefahrenabwehr kreist, sondern einen richtungsweisenden Beitrag zur Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen politischer Veränderung leistet. Schlüsselwörter: Shklar, Veränderung, Sinn für Ungerechtigkeit, Empathie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Verbindlichkeitskonflikte und politische Verpflichtung (Rieke Trimҫev)
Kurz vor ihrem Tod im Jahr 1992 wandte sich Judith N. Shklar in mehreren Vorträgen und Texten dem Thema politischer Verpflichtung zu. Aus einer ideologiegeschichtlich geschulten Perspektive nimmt sie insbesondere Verbindlichkeitskonflikte in den Blick. Im Verhältnis zu anderen liberalen Verpflichtungstheorien erweisen sich Shklars Arbeiten in dieser Hinsicht als originell und zeitgemäß, weil sie Verbindlichkeitskonflikten eine verpflichtungsproduktive Rolle zugestehen. Der vorliegende Aufsatz rekonstruiert zentrale Elemente von Shklars Verpflichtungstheorie und bietet dabei auch eine Einordnung des in diesem Schwerpunktheft erstmals veröffentlichten Textes Gewissen und Freiheit. Er untersucht das Verhältnis von Shklars Ansatz zu gängigen Verpflichtungstheorien und schärft das Profil von Shklars Thesen insbesondere in einem exemplarischen Vergleich mit der Verpflichtungstheorie von Michael Walzer. Schlüsselwörter: Judith N. Shklar, Politische Verpflichtung, Loyalität, Konflikt
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Von der Chancengleichheit zur gleichen Teilhabe. Zur Rechtfertigung von Gleichstellungspolitik (Urs Lindner)
In den letzten Jahren hat (auch) in Deutschland eine Verschiebung in der Begründung von Gleichstellungspolitik stattgefunden: von der Chancengleichheit zur gleichen Teilhabe. Wie ist dieser Wandel zu verstehen? Was sind seine normativen Implikationen? Diese Fragen verweisen auf das tieferliegende Problem, wie Gleichstellungspolitik gerechtfertigt werden kann und welche Konzeption von Gleichheit dafür angemessen ist. Der Text bearbeitet dieses Problem, indem verschiedene Dimensionen des Gleichheitsbegriffs expliziert werden. In einem ersten Schritt wird gezeigt, dass sich Kontroversen um Gleichstellung häufig auf der Ebene prozeduraler Gerechtigkeit bewegen, wobei formale und substanzielle Auffassungen von Verfahrensgleichheit aufeinanderprallen. In den weiteren Abschnitten werden dann drei Gleichheitskonzeptionen mit mehr oder weniger substanziellem Anspruch vorgestellt: meritokratische Chancengleichheit, distributive Gleichheit und demokratische Gleichheit. Diskutiert wird, inwiefern sie in der Lage sind, Maßnahmen und Instrumente der Gleichstellungspolitik zu begründen. Einzig die demokratische Gleichheit, so die zu entwickelnde These, kann die Verschiebung von der Chancengleichheit zur gleichen Teilhabe verständlich machen und einen normativen Rechtfertigungsrahmen für beide bereitstellen. Schlüsselwörter: Gleichstellungspolitik, Chancengleichheit, gleiche Teilhabe, demokratische Gleichheit, Gerechtigkeit
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
ZPTh – Zeitschrift für Politische Theorie
2-2018: Themenheft zur politischen Theorie von Judith N. Shklar
Gast-Hrsg.: Hannes Bajohr & Rieke Trimҫev
Hannes Bajohr / Rieke Trimҫev: Editorial der Gastherausgeber
Übersetzungen
Judith N. Shklar: Gewissen und Freiheit
Seyla Benhabib / Paul Linden-Retek: Judith Shklars Kritik des Legalismus
Abhandlungen
Tobias Bülte: Politisches Denken jenseits von Begründung und Fatalismus. Überlegungen zu einer erweiterten Lesart Judith Shklars
Samantha Ashenden / Andreas Hess: Republican Elements in the Liberalism of Fear
Peter Vogt: Skepsis und Sozialdemokratie – Mésalliance oder Zukunftsbündnis? Ein Plädoyer im Anschluss an Judith Shklar
Christine Unrau: Judith Shklars Sinn für Veränderung Quellen und Voraussetzungen politischen Wandels im Denken Judith Shklars
Rieke Trimҫev: Verbindlichkeitskonflikte und politische Verpflichtung
Weitere Abhandlungen
Urs Lindner: Von der Chancengleichheit zur gleichen Teilhabe. Zur Rechtfertigung von Gleichstellungspolitik
Rezensionen
Micha Steinwachs: Freiheit und der skeptische Blick auf das Recht
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zpth.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZPTh-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 1869-3016 |
| eISSN | 2196-2103 |
| Jahrgang | 9. Jahrgang 2018 |
| Ausgabe | 2 |
| Erscheinungsdatum | 28.01.2020 |
| Umfang | 137 |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterBegründungstheorie, Chancengleichheit, demokratische Gleichheit, Dissens, Empathie, Freiheit, Gerechtigkeit, Gewissen, gleiche Teilhabe, Gleichstellungspolitik, Grausamkeit, Jean-Jacques Rousseau, Judith Shklar, Kritik, Legalismus, Liberalismus, Liberalismus der Furcht, Loyalität, negative und positive Freiheit, Pluralität, politische Verpflichtung, Republikanismus, Sinn für Ungerechtigkeit, Skepsis, Sozialdemokratie, Tugenden und Laster, Ungerechtigkeit, Veränderung
Abstracts
Abstracts
Politisches Denken jenseits von Begründung und Fatalismus. Überlegungen zu einer erweiterten Lesart Judith Shklars (Tobias Bülte)
In diesem Aufsatz zeige ich, dass Shklars liberale Politische Theorie und ihr Diktum, Grausamkeit an erste Stelle zu setzen, ohne begründungstheoretische Fundierung auskommen. Shklars Liberalismus erscheint dabei als eine parteiische, herrschaftskritische Perspektive ohne idealen Begründungsbezug, die nach kontextgebundenen und historischen Blockaden und Möglichkeiten der Selbstbestimmung gerade auch schwacher AkteurInnen fragt. Dafür arbeite ich Shklars Skepsis anhand dreier Weichenstellungen ihres Denkens heraus – Pluralität, Dissens und subjektiver Sinn für Ungerechtigkeit –, die einem begründungstheoretische Vorgehen entgegenstehen. In einem zweiten Schritt zeige ich dann, dass ihre Orientierung an der Grausamkeit keine statische, minimale Grundnorm ist, sondern eine beständige Befragung der Machtverhältnisse erfordert und eine fordernde, politische Perspektive jenseits der akuten Grausamkeitsverhinderung öffnet. Schlüsselwörter: Shklar, Pluralität, Dissens, Ungerechtigkeit, Liberalismus, Begründungstheorie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Republican Elements in the Liberalism of Fear (Samantha Ashenden, Andreas Hess)
Judith Shklars Liberalismus der Furcht unterscheidet sich von anderen Liberalismen. Er gewinnt seine einzigartige Prägung und Qualität durch eine lang andauernde und konsequente kritische Auseinandersetzung mit dem Republikanismus. Ihre Diskussion der gegenwärtigen Relevanz von Tugenden und Lastern, von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, die Fragen von Rechten, Repräsentation, Staatsbürgerschaft und Demokratie weisen auf ältere republikanische Einflüsse hin. Shklar war sich dennoch darüber im Klaren, dass ein unrekonstruierter Republikanismus und die republikanische Vorstellung eines tugendhaften Lebens auf moderne gesellschaftliche und politische Bedingungen nicht mehr anwendbar waren. Dies wird besonders deutlich in ihrer Diskussion über Rousseau und in ihrer Studie Ganz normale Laster. Der irreduzibel pluralistische und individualistische Charakter moderner Demokratien hat es unvorstellbar werden lassen, dass wir eine einheitliche Vorstellung des tugendhaften Lebens hegen. Shklars Betonung der positiven Freiheit, die sich kritisch gegen Isaiah Berlins Argument richtet, negative Rechte und negative Freiheit ständen im Mittelpunkt des modernen Liberalismus; ihr Beharren auf der Notwendigkeit eines gemeinsamen Geistes, wie er in ihrer Studie über Montesquieu zum Ausdruck kommt; die Notwendigkeit, in Hinsicht auf Wahl und Verdienst gleichgestellt zu sein, wie er in der amerikanischen Staatsbürgerschaft betont wird; und schließlich ihre Diskussion des sich wandelnden Charakters von Loyalität und politischer Verpflichtung in ihren letzten Harvard Vorträgen, sind allesamt Ausdruck der republikanischen Einflüsse, die in ihrem Elementarliberalismus zu erkennen sind. Schlüsselwörter: Republikanismus, Liberalismus der Furcht, Rousseau, Tugenden und Laster, negative und positive Freiheit, Loyalität, politische Verpflichtung
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Skepsis und Sozialdemokratie – Mésalliance oder Zukunftsbündnis? Ein Plädoyer im Anschluss an Judith Shklar (Peter Vogt)
Judith Shklars „Liberalismus der Furcht“ wird oft als ein Plädoyer für eine Art Nachtwächterliberalismus interpretiert. Im Gegensatz zu dieser Deutung konzentriere ich mich im Folgenden auf die gleichsam sozialdemokratischen Züge von Shklars Liberalismus. Diese Züge, so will ich zeigen, sind eng mit Shklars Auffassung von Skepsis verbunden. Shklars frühe historische Skepsis wendet sich sowohl gegen einen melancholischen Kulturpessimismus wie gegen einen illusionären Fortschrittsglauben. Für Shklars späte politische Skepsis sind zwei Charakteristika entscheidend. Erstens: Im Anschluss an einen terminologischen Vorschlag Hugo Friedrichs lässt sich Shklars politische Skepsis als eine „erschließende“ im Unterschied zu einer „zersetzenden“ begreifen. Dabei folgt Shklar zweitens dem Begründungsmodell einer „negativen Rechtfertigung“ (A. Margalit) jenseits von Relativismus und der Suche nach Letztbegründung. Shklars so zu charakterisierende Skepsis weist eine natürliche Affinität zu einem sozialdemokratisch angereicherten Liberalismus auf. Shklars „Liberalismus der Furcht“, der sowohl auf historischer als auch politischer Skepsis beruht, mündet letztlich in eine „Sozialdemokratie der Furcht“ (T. Judt). Schlüsselwörter: Skepsis, Grausamkeit, Liberalismus, Sozialdemokratie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Judith Shklars Sinn für Veränderung Quellen und Voraussetzungen politischen Wandels im Denken Judith Shklars (Christine Unrau)
Obwohl es oft in die Schublade eines negativen Liberalismus der Schadensbegrenzung gesteckt wird, spielt in Judith Shklars Denken die Aussicht auf gezielte Veränderung und Verbesserung der politischen Bedingungen eine wichtige Rolle. Der Beitrag geht der Bedeutung dieses Themas im Werk Shklars nach und stellt dabei die Frage nach den Quellen und Voraussetzungen von Veränderung in den Mittelpunkt. Damit soll letztlich aufgezeigt werden, dass Shklars Denken nicht nur um eine negative Gefahrenabwehr kreist, sondern einen richtungsweisenden Beitrag zur Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen politischer Veränderung leistet. Schlüsselwörter: Shklar, Veränderung, Sinn für Ungerechtigkeit, Empathie
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Verbindlichkeitskonflikte und politische Verpflichtung (Rieke Trimҫev)
Kurz vor ihrem Tod im Jahr 1992 wandte sich Judith N. Shklar in mehreren Vorträgen und Texten dem Thema politischer Verpflichtung zu. Aus einer ideologiegeschichtlich geschulten Perspektive nimmt sie insbesondere Verbindlichkeitskonflikte in den Blick. Im Verhältnis zu anderen liberalen Verpflichtungstheorien erweisen sich Shklars Arbeiten in dieser Hinsicht als originell und zeitgemäß, weil sie Verbindlichkeitskonflikten eine verpflichtungsproduktive Rolle zugestehen. Der vorliegende Aufsatz rekonstruiert zentrale Elemente von Shklars Verpflichtungstheorie und bietet dabei auch eine Einordnung des in diesem Schwerpunktheft erstmals veröffentlichten Textes Gewissen und Freiheit. Er untersucht das Verhältnis von Shklars Ansatz zu gängigen Verpflichtungstheorien und schärft das Profil von Shklars Thesen insbesondere in einem exemplarischen Vergleich mit der Verpflichtungstheorie von Michael Walzer. Schlüsselwörter: Judith N. Shklar, Politische Verpflichtung, Loyalität, Konflikt
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Von der Chancengleichheit zur gleichen Teilhabe. Zur Rechtfertigung von Gleichstellungspolitik (Urs Lindner)
In den letzten Jahren hat (auch) in Deutschland eine Verschiebung in der Begründung von Gleichstellungspolitik stattgefunden: von der Chancengleichheit zur gleichen Teilhabe. Wie ist dieser Wandel zu verstehen? Was sind seine normativen Implikationen? Diese Fragen verweisen auf das tieferliegende Problem, wie Gleichstellungspolitik gerechtfertigt werden kann und welche Konzeption von Gleichheit dafür angemessen ist. Der Text bearbeitet dieses Problem, indem verschiedene Dimensionen des Gleichheitsbegriffs expliziert werden. In einem ersten Schritt wird gezeigt, dass sich Kontroversen um Gleichstellung häufig auf der Ebene prozeduraler Gerechtigkeit bewegen, wobei formale und substanzielle Auffassungen von Verfahrensgleichheit aufeinanderprallen. In den weiteren Abschnitten werden dann drei Gleichheitskonzeptionen mit mehr oder weniger substanziellem Anspruch vorgestellt: meritokratische Chancengleichheit, distributive Gleichheit und demokratische Gleichheit. Diskutiert wird, inwiefern sie in der Lage sind, Maßnahmen und Instrumente der Gleichstellungspolitik zu begründen. Einzig die demokratische Gleichheit, so die zu entwickelnde These, kann die Verschiebung von der Chancengleichheit zur gleichen Teilhabe verständlich machen und einen normativen Rechtfertigungsrahmen für beide bereitstellen. Schlüsselwörter: Gleichstellungspolitik, Chancengleichheit, gleiche Teilhabe, demokratische Gleichheit, Gerechtigkeit
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Das könnte Sie auch interessieren:
Verlag Barbara Budrich
- +49 (0)2171.79491-50
- info@budrich.de
-
Stauffenbergstr. 7
51379 Leverkusen
Deutschland




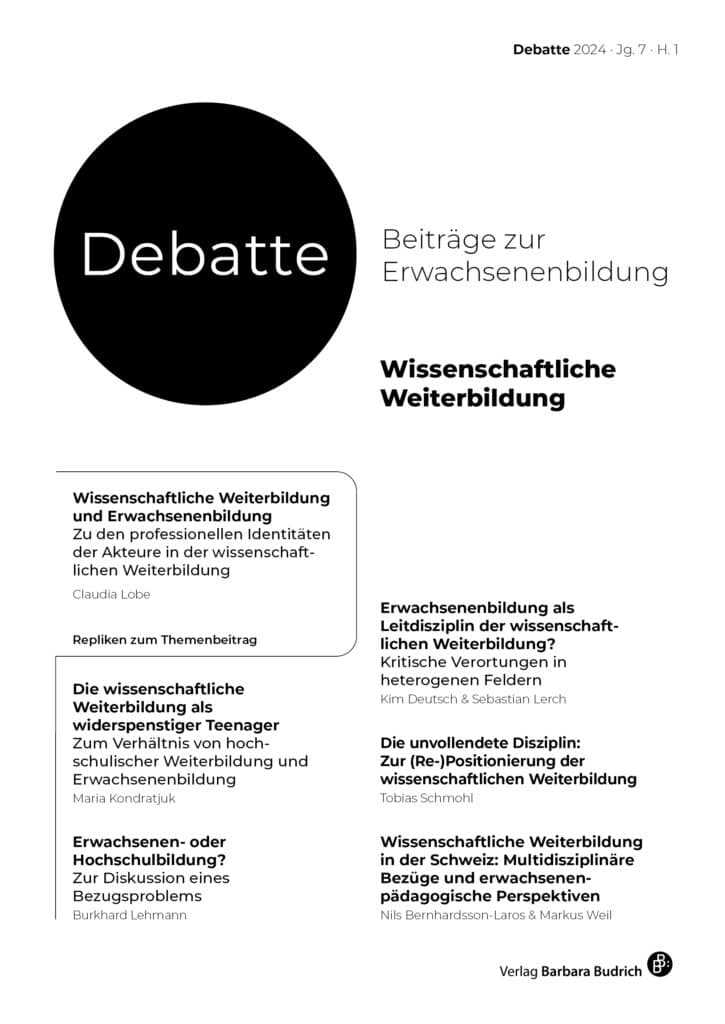

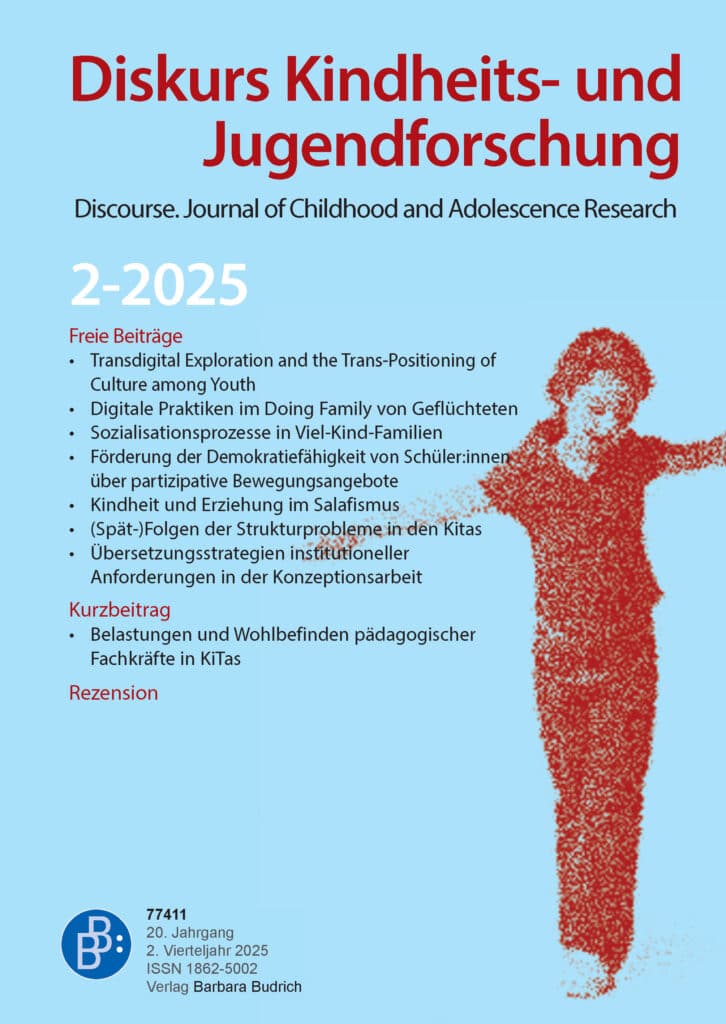
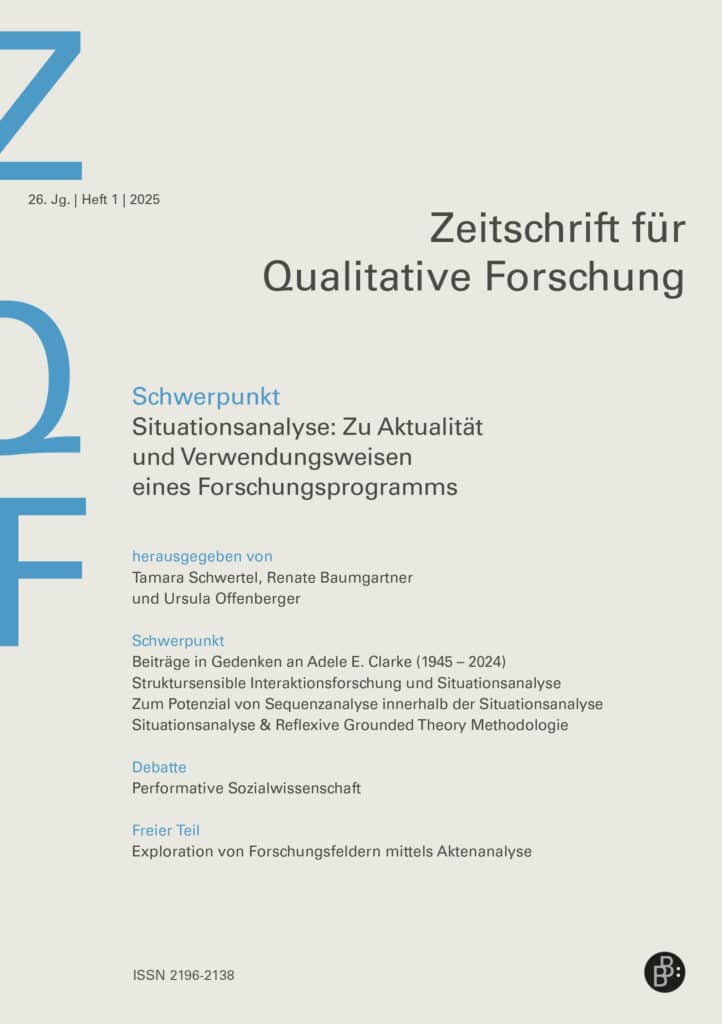



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.