Informationen zum Buch
Home » Publications » Guter Mann, echter Mann – Wie Männer im Kontext von Arbeitszeitreduktionen Männlichkeit konstruieren
Guter Mann, echter Mann – Wie Männer im Kontext von Arbeitszeitreduktionen Männlichkeit konstruieren
Erscheinungsdatum : 01.09.2025
52,99 € - 53,00 €
Beschreibung
Das Modell des männlichen Ernährers scheint im Zuge gegenwärtiger Transformationen der Arbeitswelt seit Jahren an Bedeutung zu verlieren. Dennoch sind Arbeitszeitreduktionen von Männern nach wie vor als nicht-normativer Übergang in männlichen Lebensläufen zu verstehen. Mit Rückgriff auf biografische Interviews und Diskursdokumente widmet sich die qualitative Studie der Frage, wie Männer in Deutschland im Kontext von Arbeitszeitreduktionen Männlichkeit konstruieren.
Ein zentrales Ergebnis besteht in der Systematisierung zweier Modi diskursiver Artikulationen, die jeweils Hegemonie beanspruchen. Die Differenzierung von Positionierungen als „moralisch guter“ und „echter Mann“ zeigt, dass eine in der Männlichkeitenforschung bisweilen vertretene Interpretation eines moralisch-bewertenden Diskurses als ‚alternative‘ oder ‚progressive‘ Männlichkeit fragwürdig ist. Während bestimmte Aspekte bürgerlich-industriegesellschaftlicher Männlichkeit (wie eine reine Konzentration auf Beruf und Öffentlichkeit oder die gewaltförmige Unterordnung von Frauen) einen Bedeutungsverlust erfahren, haben andere Elemente desselben Diskurses in veränderter Form Bestand: in einer mindestens teilweise persistenten Norm des männlichen Ernährers, aber auch in Vorstellungen individueller Unabhängigkeit und Souveränität; einer Anforderung, von der allerdings inzwischen längst nicht mehr nur Männer betroffen sind. Zudem erscheint „alternative“ Männlichkeit im Diskurs zunehmend als Chiffre der Distinktion, mittels derer sich ihre Vertreter gegenüber Männern unterer Gesellschaftsschichten abgrenzen.
Der Autor:
Dr. Lukas Kammerlander, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung, Goethe-Universität Frankfurt am Main
Der Fachbereich:
Erziehungswissenschaft, Gender Studies
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISBN | 978-3-8474-3149-7 |
| eISBN | 978-3-8474-3286-9 |
| Format | 14,8 x 21,0 cm |
| Scope | 434 |
| Year of publication | 2025 |
| Date of publication | 01.09.2025 |
| Edition | 1. |
| Language | Deutsch |
| Series | |
| Volume | 17 |
Additional Content
Autor*innen
Beschreibung
Beschreibung
Das Modell des männlichen Ernährers scheint im Zuge gegenwärtiger Transformationen der Arbeitswelt seit Jahren an Bedeutung zu verlieren. Dennoch sind Arbeitszeitreduktionen von Männern nach wie vor als nicht-normativer Übergang in männlichen Lebensläufen zu verstehen. Mit Rückgriff auf biografische Interviews und Diskursdokumente widmet sich die qualitative Studie der Frage, wie Männer in Deutschland im Kontext von Arbeitszeitreduktionen Männlichkeit konstruieren.
Ein zentrales Ergebnis besteht in der Systematisierung zweier Modi diskursiver Artikulationen, die jeweils Hegemonie beanspruchen. Die Differenzierung von Positionierungen als „moralisch guter“ und „echter Mann“ zeigt, dass eine in der Männlichkeitenforschung bisweilen vertretene Interpretation eines moralisch-bewertenden Diskurses als ‚alternative‘ oder ‚progressive‘ Männlichkeit fragwürdig ist. Während bestimmte Aspekte bürgerlich-industriegesellschaftlicher Männlichkeit (wie eine reine Konzentration auf Beruf und Öffentlichkeit oder die gewaltförmige Unterordnung von Frauen) einen Bedeutungsverlust erfahren, haben andere Elemente desselben Diskurses in veränderter Form Bestand: in einer mindestens teilweise persistenten Norm des männlichen Ernährers, aber auch in Vorstellungen individueller Unabhängigkeit und Souveränität; einer Anforderung, von der allerdings inzwischen längst nicht mehr nur Männer betroffen sind. Zudem erscheint „alternative“ Männlichkeit im Diskurs zunehmend als Chiffre der Distinktion, mittels derer sich ihre Vertreter gegenüber Männern unterer Gesellschaftsschichten abgrenzen.
Der Autor:
Dr. Lukas Kammerlander, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung, Goethe-Universität Frankfurt am Main
Der Fachbereich:
Erziehungswissenschaft, Gender Studies
Bibliography
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISBN | 978-3-8474-3149-7 |
| eISBN | 978-3-8474-3286-9 |
| Format | 14,8 x 21,0 cm |
| Scope | 434 |
| Year of publication | 2025 |
| Date of publication | 01.09.2025 |
| Edition | 1. |
| Language | Deutsch |
| Series | |
| Volume | 17 |
Produktsicherheit
Additional Content
Additional Content
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.




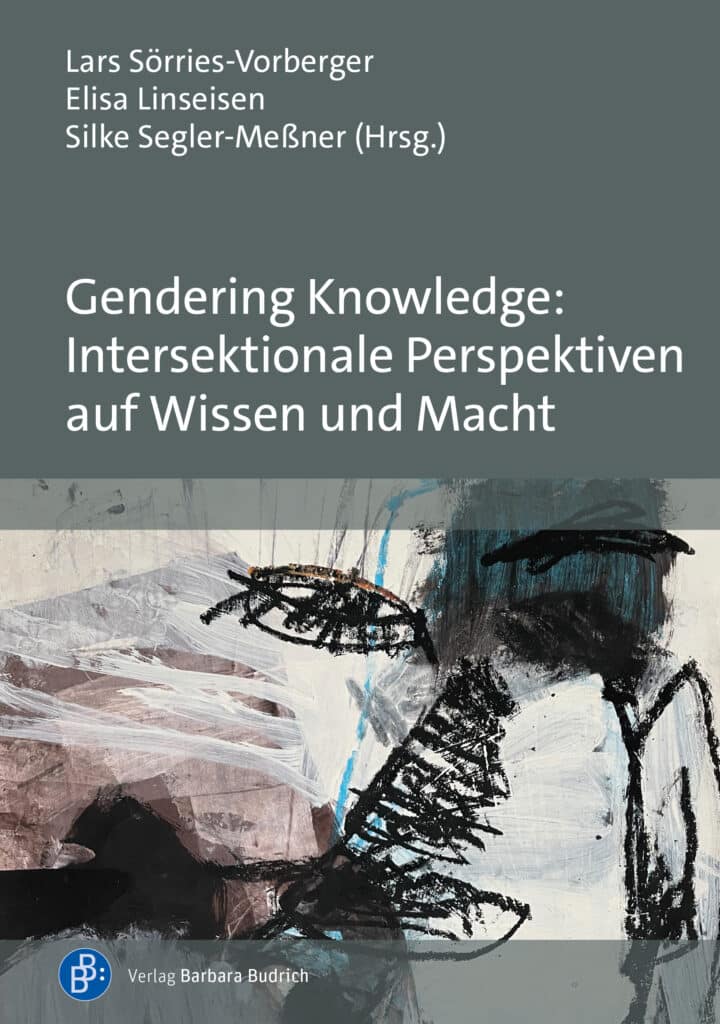
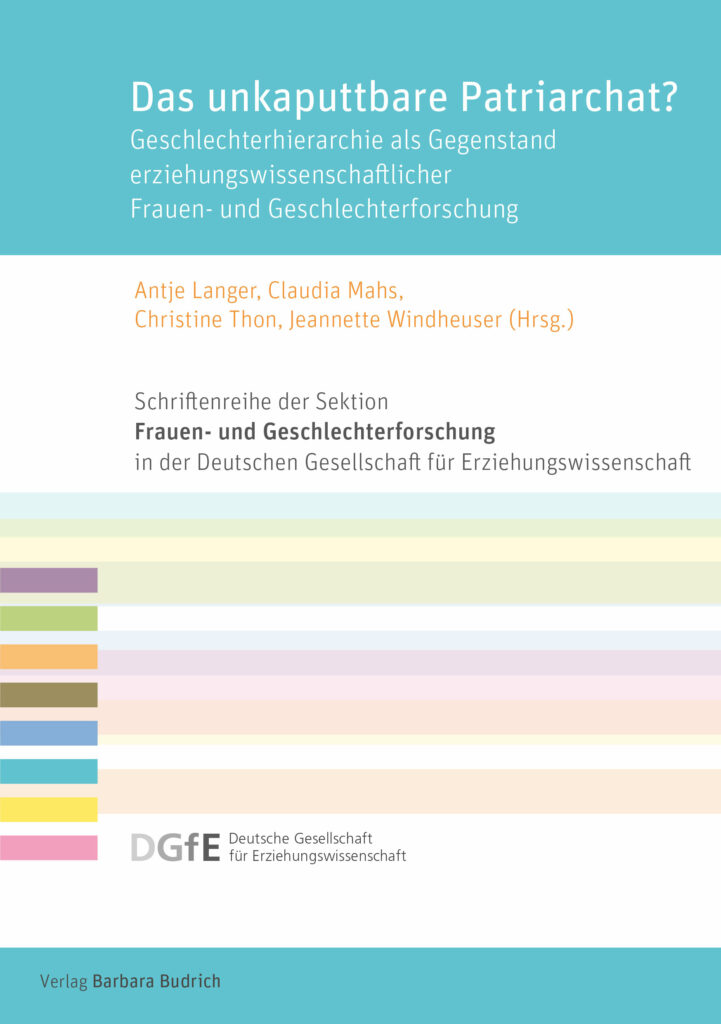
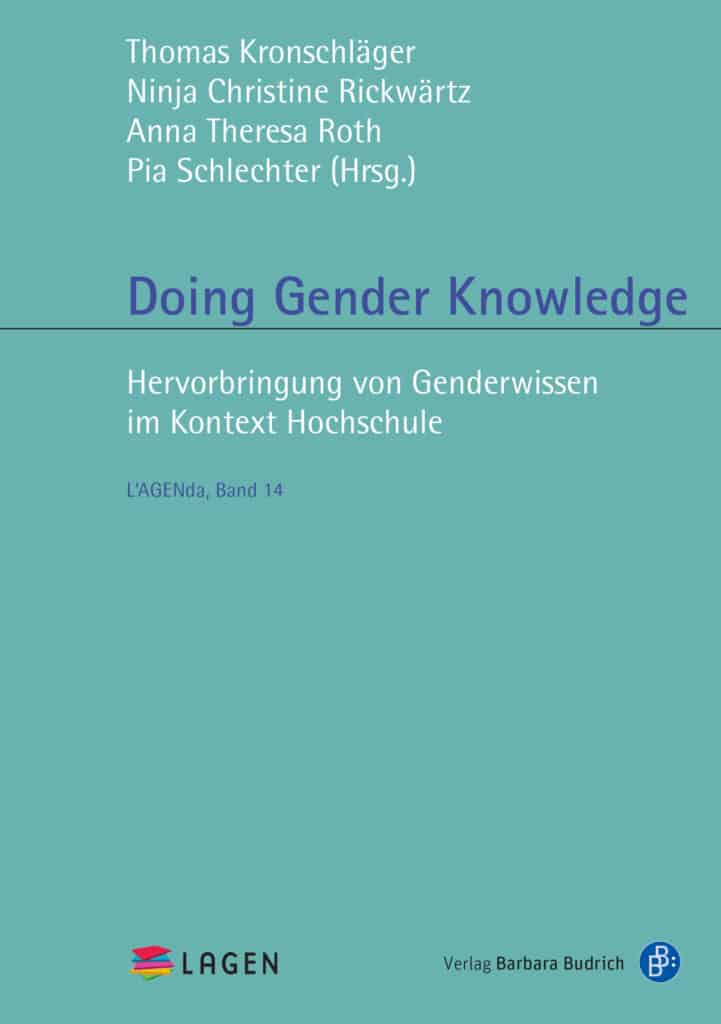


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.