Informationen zur Zeitschrift
Home » Publications » PERIPHERIE 1-2025 (Heft 177-178) | Gelebte Utopie
PERIPHERIE 1-2025 (Heft 177-178) | Gelebte Utopie
Erscheinungsdatum : 28.08.2025
29,90 €
Inhalt
PERIPHERIE – Politik • Ökonomie • Kultur
1-2025 (Heft 177-178): Gelebte Utopie
Zu diesem Heft. Gelebte Utopie
Schwerpunkt
Antje Daniel / Björn Wendt: Die Utopie lebt! Plädoyer für eine Blickerweiterung der soziologischen Zeitdiagnose und Gesellschaftstheorie (im Open Access verfügbar)
Alissa Starodub: Die Kunst des Überlebens auf einem mzerstörten Planeten. Neue Begriffe und Feldnotizen zur Ökologischen Solidarität
Olaf Kaltmeier: Das Oxymoron der anarchistischen Verfassung. Der Tod des Sozialen und die populare konstituierende Macht in Chile
Merlin Becskey: Die Rolle der Orthopraxis in der Entwicklung post-utopischer Kibbuz-Modelle
Miryam Frickel: No Future? Die Zukunft Siziliens
Alexander Neupert-Doppler: Vom Utopieverlust im Neoliberalismus zum Autoritarismus und zurück in die Zukunft
PERIPHERIE-Stichwort
Anja Habersang: Präfigurative Politik
Interview
Unrecht gilt es immer zu bekämpfen. Ruth Weiss im Gespräch über Politisierung, Jüdischsein zwischen Deutschland und Südafrika und Widersprüche der Befreiungsbewegungen (im Open Access verfügbar)
Weitere Beiträge
Anne Tittor / Eduardo Relly / Leoni Schlender / Maria Backhouse: Die amputierte Wiedereinbettung geistiger Eigentumsrechte an genetischen Ressourcen. Das Fallbeispiel Brasilien
Floris Biskamp: „Rasse“ und „Rassismus“ in politikwissenschaftlichen Fachwörterbüchern (Debatte)
Rezensionen
Nadine Pollvogt: Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria & Alberto Acosta (Hg.): Pluriversum. Ein Lexikon des Guten Lebens für alle
Albert Denk: Friederike Habermann: Overcoming Exploitation and Externalisation. An Intersectional Theory of Hegemony and Transformation
Andreas Bohne: Linda Melvern: A People Betrayed. The Role of the West in Rwanda’s Genocide
María Fernanda Córdova Suxo: Sebastian Garbe: Solidarität mit Wallmapu. Der transnationale Widerstand der Mapuche
Reinhart Kößler: Adam Blackler: An Imperial Homeland. Forging German Identity in Southwest Africa
Gerhard Hauck: Lucile Dreidemy, Johannes Knierzinger, David Mayer & Clemens Pfeffer (Hg.): Stimmen des Antikolonialismus. Eine globalhistorische Spurensammlung 1615-1915
Reinhart Kößler: Martin Oppelt, Christina Pauls & Nicki K. Weber (Hg.): Postkoloniale Staatsverständnisse
Eleonora Roldán Mendívil: Jules Joanne Gleeson & Elle O’Rouke (Hg.): Transgender Marxism
Arnold Schölzel: Matin Baraki: Afghanistan. Revolution, Intervention, 40 Jahre Krieg
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): peripherie.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den PERIPHERIE-Alert anmelden.
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 0173-184X |
| eISSN | 2366-4185 |
| Volume | 45. Jahrgang 2025 |
| Edition | 1-2025 (Heft 177-178) |
| Date of publication | 28.08.2025 |
| Scope | 240 Seiten |
| Language | Deutsch |
| Format | 14,8 x 21 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Additional Content
Autor*innen
Keywordsanarchistische Praxis, August 2025, Autoritarismus, Befreiungsbewegungen, Brasilien, Chile, Germany, Dystopie, Epistemologien, Fachwörterbücher, geistiges Eigentum, Gemein-Werdung, gesellschaftliche Wiedereinbettung, indigenes Wissen, intentionale Gemeinschaft, Jüdischsein, Kibbuz-Sozialismus, Klimakrise, kollektive Selbstverwaltung, Mafia, Nagoya-Protokoll, Neoliberalismus, Nicht-Bewegungen, Orthopraxis, Phantasie, Polanyi, politische Repräsentation, Politisierung, Post-Utopie, Posthumanismus, präfigurative Politik, Rasse, Rassismus, Sizilien, soziale Bewegungen, soziale Transformation, Südafrika, Utopie, Verfassung, Zukunft, zukunftsgerichtete Praktiken, ökologische Klasse, ökologische Solidarität
Abstracts
Die Utopie lebt! Plädoyer für eine Blickerweiterung der soziologischen Zeitdiagnose und Gesellschaftstheorie (Antje Daniel & Björn Wendt)
Häufig wird die Gegenwart in gesellschaftstheoretischen und zeitdiagnostischen Debatten als utopielos beschrieben. Furchtbilder, Niedergangserwartungen sowie apokalyptische und rückwärtsgewandte Erzählungen dominierten die Imaginationen von Zukunft. Wir nehmen diese zeitdiagnostische Beschreibung zum Ausgangspunkt, um zu zeigen, dass es trotz dieser Tendenzen falsch ist, die Gegenwart als ein utopieloses Zeitalter zu bestimmen. Diese, aber auch andere verbreitete (Fehl-)Annahmen zur Utopie unterziehen wir einer kritischen Prüfung. Gegen die These vom Ende der Utopie sowie gegen die Fassung von Utopien als ein spezifisches Genre fiktionaler Literatur, als fortschrittlich-emanzipatorische Projekte und als europäisches Phänomen argumentieren wir für einen mehrdimensionalen, elastischen Utopie-Begriff und die Aufwertung der Utopie als Gegenstandsbereich soziologischer Forschung. Eine Soziologie der Utopie hat zum Ziel, als wünschenswert imaginierte Sozialverhältnisse und variierende Vorstellungen des guten Lebens differenziert zu analysieren sowie ihre Verankerung in der sozialen Praxis und Bedeutung für Veränderungsprozesse in Gegenwartsgesellschaften auszuloten.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die Kunst des Überlebens auf einem zerstörten Planeten. Neue Begriffe und Feldnotizen zur Ökologischen Solidarität (Alissa Starodub)
Dieser Beitrag erkundet, wie Utopien angesichts der düsteren Prognosen der Klimakrise in der Gegenwart durch zukunftsgerichtete Praktiken verankert sind. Mit einer akteurszentrierten Betrachtungsweise untersucht er diese bei gewöhnlichen Menschen in ländlichen Gebieten, in sozialen Nicht-Bewegungen, wo im Streben nach einer alternativen Zukunft Praktiken der Überlebenskunst auf einem zerstörten Planeten entstehen. Aus der modernen posthumanistischen Theorie schöpfend, macht er die Begriffe der Ökologischen Solidarität und der Ökologischen Klasse für die Protest- und Solidaritätsforschung fruchtbar und illustriert sie mit einer Collage aus empirischem Material. Dabei zeigt er neue Formen des grenzenlosen Denkens und Handelns gesellschaftlicher Akteure auf, deren Gemeinsamkeiten in einer Praxis der Vergemeinschaftung und Gemein-Werdung liegen und eine gesellschaftspolitische Vision grenzenloser Solidarität als Multispezies-Solidarität in das Hier und Jetzt projizieren. Er schlägt vor, die neuen ontologischen Ansätze, welche diesen Suchbewegungen nach einer alternativen Zukunft zugrunde liegen, theoretisch herauszuarbeiten und meta-theoretisch zu unterfüttern, um sie für eine breite Auseinandersetzung mit zukunftsgerichteten Praktiken nutzen zu können.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Das Oxymoron der anarchistischen Verfassung. Der Tod des Sozialen und die populare konstituierende Macht in Chile (Olaf Kaltmeier)
Dieser Artikel analysiert den Verfassungsentwurf, der von der Verfassungsgebenden Versammlung in Chile zwischen 2021 und 2022 ausgearbeitet wurde, daraufhin, wie die vielfältigen und pluralen Belange unterschiedlicher Sozialer Bewegungen, die mit den Massenprotesten 2018 gegen die neoliberale Verfasstheit Chiles protestierten, in eine neue libertäre Form der politischen Repräsentation überführt werden können. Historisch arbeitet der Beitrag die stark autoritäre Verfassungstradition in Chile auf, die in der von der Militärdiktatur 1980 erlassenen Verfassung kulmuniert. Während diese popularen Anliegen unterdrückt wurden, was letztlich den Tod des Sozialen bewirkte, sorgt – so eine zentrale These dieses Beitrags – der Verfassungsgebende Konvent für eine Wiederbelegung des Sozialen, indem gerade die unterschiedlichen Anliegen von Bewegungen in den Verfassungstext eingeschrieben werden. Mit Rückgriff auf die politische Philosophie untersucht der Beitrag sowohl die Spannungen, die das paradoxe Projekt einer popularen anarchistische Verfassung hervorruft, als auch die Perspektiven für emanzipatorische Prozesse.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Rolle der Orthopraxis in der Entwicklung post-utopischer Kibbuz-Modelle (Merlin Becskey)
Dieser Artikel untersucht den Kibbuz Samar als ein seltenes Beispiel einer post-utopischen, egalitären Gemeinschaft, die zentrale Prinzipien des demokratischen Kibbuz-Sozialismus bewahrt und anarchistisch inspirierte Selbstorganisationspraktiken integriert. Basierend auf ethnografischer Feldforschung stellt er das Konzept der Orthopraxis – eine praxisorientierte Alternative zur ideologischen Orthodoxie – und zeigt, wie Samar hegemoniale neoliberale Logiken sowie bürokratischen Realismus unterläuft. Trotz wachsender interner Spannungen und externer Transformationsdrucke bleibt Samar ein Ort kollektiver Aushandlung, flexibler Kooperation und solidarischen Wirtschaftens – als gelebtes Gegenmodell zur kapitalistischen Realität.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
No Future? Die Zunkunft Siziliens (Miryam Frickel)
Der Beitrag untersucht, wie in Palermo auf Sizilien alternative Zukunftsvorstellungen entstehen, die dominante Erzählungen über die Mafia und Entwicklung infrage stellen. Anhand der Analysekategorie „Situierter Revisionen“ zeigt er empirisch auf, wie lokale Akteur:innen Machtverhältnisse verhandeln, offizielle Narrative umdeuten und eigene Perspektiven auf gesellschaftlichen Wandel formulieren.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Vom Utopieverlust im Neoliberalismus zum Autoritarismus und zurück in die Zukunft (Alexander Neupert-Doppler)
Wie hängen der Utopieverlust unserer Zeit und der Aufstieg des rechten Autoritarismus zusammen? Es ist der Erfolg des Neoliberalismus in den vergangenen Jahrzehnten, der gegen die utopische Kernidee der Gestaltbarkeit von Gesellschaft die Alternativlosigkeit des Marktes setzte. Gegenüber den Menschen folgt daraus eine Anrufung zur Selbstverantwortung, die sich gerade in Krisenzeiten als Überforderung erweist. Aufbauend auf dieser Vereinzelung ist der Rechtspopulismus erfolgreich, indem er nationale Zugehörigkeit als Entlastung verspricht. Die Erzählung von allmächtigen Verschwörungen ist dabei psychoanalytisch auch aus Erfahrungen eigener, verdrängter Ohnmacht zu erklären. Was geblieben ist, sind Dystopien einer drohenden Zukunft, an die angeknüpft werden kann, um der politischen Phantasie wieder Zugang zu utopischen Perspektiven zu verschaffen.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
PERIPHERIE-Stichwort: „Präfigurative Politik“ (Anja Habersang)
Das PERIPHERIE-Stichwort führt in die Funktionsweise präfigurativer Politik ein. Diese Politik fragt danach, wie Menschen die von ihnen angestrebten Zukünfte, utopischen Visionen und Vorstellungen von alternativen Gesellschaften durch ihr gegenwärtiges Handeln im Hier und Jetzt experimentell umsetzen, gestalten oder andeuten.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Unrecht gilt es immer zu bekämpfen. Ruth Weiss im Gespräch über Politisierung, Jüdischsein zwischen Deutschland und Südafrika und Widersprüche der Befreiungsbewegungen (Ruth Weiss, Daniel Bendix, Reinhart Kößler)
Im Interview mit Daniel Bendix and Reinhart Kößler anlässlich ihres 100. Geburtstag am 26.7.2024 berichtet die Journalistin, Romanautorin und Anti-Apartheid-Aktivistin Ruth Weiss von ihrer Politisierung in Südafrika nach der Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Sie kritisiert die Rolle von westlichen Staaten wie der BRD, deren wirtschaftliche Interessen lange Zeit zur Stabilität des Apartheid-Regimes beitrugen. Während Weiss sich angesichts der langfristigen politischen Entwicklungen im südlichen Afrika nach der Unabhängigkeit ernüchtert zeigt, sieht sie Hoffnung in einer gut ausgebildeten, neuen Generation, die gegen autoritäre Regime und wirtschaftliche Ausbeutung auf- und für Gerechtigkeit einsteht.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die amputierte Wiedereinbettung geistiger Eigentumsrechte an genetischen Ressourcen – das Fallbeispiel Brasilien (Anne Tittor, Eduardo Relly, Maria Backhouse und Leoni Schlender)
Im Jahr 2010 wurden nach langen Verhandlungen das Nagoya-Protokoll und mit ihm ein zentraler Mechanismus des gerechten Vorteilsausgleich (englisch: Access and Benefit Sharing – ABS) verabschiedet. Dieser soll der Biopiraterie – gemeint ist die Aneignung und Patentierung von Wissen und kultivierten Pflanzen durch Pharmazie- oder Agrarunternehmen – Einhalt gebieten, indem der Zugang zu genetischen Ressourcen geregelt und die lokalen Wissensträger:innen an den Gewinnen dieser Aneignung beteiligt werden. Im vorliegenden Beitrag argumentieren wir anknüpfend an eine eigentumssoziologische Interpretation von Karl Polanyi, dass dieser ABS-Mechanismus das Ergebnis jahrzehntelanger Aushandlungsprozesse um die gesellschaftliche Wiedereinbettung bzw. soziale Regulierung intellektueller Eigentumsrechte zwischen Marktkräften, Staaten des Globalen Südens und sozialen Bewegungen ist. Vor diesem Hintergrund gehen wir der Frage nach, inwieweit damit eine gesellschaftliche Wiedereinbettung bzw. soziale Regulierung dieser Eigentumsform gelingt. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass es sich um eine „amputierte“ Wiedereinbettung des privaten geistigen Eigentums handelt. Denn obwohl diese internationale Norm erstmals die Bedeutung des Indigenen und Traditionellen Wissens anerkennt, können wir keine soziale Regulierung intellektuellen Eigentums feststellen: Der Ausschluss der zugrunde liegenden privaten Eigentumsform und die damit verbundenen Inwertsetzungsprozesse werden von dem Mechanismus nicht angetastet, sondern bestärkt. Auf lokaler Ebene gelingt bisher nicht einmal die anvisierte monetäre Umverteilung über eine Gewinnbeteiligung. Gleichzeitig erscheint diese Form der Regulierung den meisten Akteuren alternativlos. Dies verdeutlichen wir anhand einer qualitativen Studie zu den gesellschaftlichen Aushandlungen um die Implementierung des ABS-Mechanismus in Brasilien.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„Rasse“ und „Rassismus“ in politikwissenschaftlichen Fachwörterbüchern (Floris Biskamp)
Der Beitrag untersucht, wie sich das Verständnis von Rasse und Rassismus in der deutschsprachigen Politikwissenschaft über die Jahrzehnte hinweg entwickelt hat. Dafür unterzieht er die entsprechenden Einträge in politikwissenschaftlichen Fachwörterbüchern einer qualitativen Inhaltsanalyse. Die Untersuchung zeigt, dass sich das Begriffsverständnis im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts finden sich offen rassistische Konzeptionen. Diese werden nach dem Ende des Nationalsozialismus zuerst durch Konzeptionen ersetzt, die von der Existenz distinkter Menschenrassen ausgehen und Rassismus als Abwertung oder Benachteiligung einiger Menschenrassen verstehen. Seit den 1970ern treten Konzeptionen hinzu, die die Idee von Menschenrassen zurückweisen und Rassismus als eine biologistische Ideologie verstehen, die Menschenrassen erfindet. Im 21. Jahrhundert schließlich kommen auch Konzeptionen auf, die, soziologisch und insbesondere poststrukturalistisch informiert, Rassismus als eine biologistische oder kulturalistische Differenzkonstruktion erfassen. Insgesamt zeigt sich, dass der Mainstream des Faches die in den Nachbardisziplinen geführte rassismuskritische Debatte nur zögerlich aufnimmt und auch Konzeptionen wirksam bleiben, die in der Rassismusdebatte gemeinhin als unhaltbar oder überholt betrachtet werden.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
PERIPHERIE – Politik • Ökonomie • Kultur
1-2025 (Heft 177-178): Gelebte Utopie
Zu diesem Heft. Gelebte Utopie
Schwerpunkt
Antje Daniel / Björn Wendt: Die Utopie lebt! Plädoyer für eine Blickerweiterung der soziologischen Zeitdiagnose und Gesellschaftstheorie (im Open Access verfügbar)
Alissa Starodub: Die Kunst des Überlebens auf einem mzerstörten Planeten. Neue Begriffe und Feldnotizen zur Ökologischen Solidarität
Olaf Kaltmeier: Das Oxymoron der anarchistischen Verfassung. Der Tod des Sozialen und die populare konstituierende Macht in Chile
Merlin Becskey: Die Rolle der Orthopraxis in der Entwicklung post-utopischer Kibbuz-Modelle
Miryam Frickel: No Future? Die Zukunft Siziliens
Alexander Neupert-Doppler: Vom Utopieverlust im Neoliberalismus zum Autoritarismus und zurück in die Zukunft
PERIPHERIE-Stichwort
Anja Habersang: Präfigurative Politik
Interview
Unrecht gilt es immer zu bekämpfen. Ruth Weiss im Gespräch über Politisierung, Jüdischsein zwischen Deutschland und Südafrika und Widersprüche der Befreiungsbewegungen (im Open Access verfügbar)
Weitere Beiträge
Anne Tittor / Eduardo Relly / Leoni Schlender / Maria Backhouse: Die amputierte Wiedereinbettung geistiger Eigentumsrechte an genetischen Ressourcen. Das Fallbeispiel Brasilien
Floris Biskamp: „Rasse“ und „Rassismus“ in politikwissenschaftlichen Fachwörterbüchern (Debatte)
Rezensionen
Nadine Pollvogt: Ashish Kothari, Ariel Salleh, Arturo Escobar, Federico Demaria & Alberto Acosta (Hg.): Pluriversum. Ein Lexikon des Guten Lebens für alle
Albert Denk: Friederike Habermann: Overcoming Exploitation and Externalisation. An Intersectional Theory of Hegemony and Transformation
Andreas Bohne: Linda Melvern: A People Betrayed. The Role of the West in Rwanda’s Genocide
María Fernanda Córdova Suxo: Sebastian Garbe: Solidarität mit Wallmapu. Der transnationale Widerstand der Mapuche
Reinhart Kößler: Adam Blackler: An Imperial Homeland. Forging German Identity in Southwest Africa
Gerhard Hauck: Lucile Dreidemy, Johannes Knierzinger, David Mayer & Clemens Pfeffer (Hg.): Stimmen des Antikolonialismus. Eine globalhistorische Spurensammlung 1615-1915
Reinhart Kößler: Martin Oppelt, Christina Pauls & Nicki K. Weber (Hg.): Postkoloniale Staatsverständnisse
Eleonora Roldán Mendívil: Jules Joanne Gleeson & Elle O’Rouke (Hg.): Transgender Marxism
Arnold Schölzel: Matin Baraki: Afghanistan. Revolution, Intervention, 40 Jahre Krieg
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): peripherie.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den PERIPHERIE-Alert anmelden.
Bibliography
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 0173-184X |
| eISSN | 2366-4185 |
| Volume | 45. Jahrgang 2025 |
| Edition | 1-2025 (Heft 177-178) |
| Date of publication | 28.08.2025 |
| Scope | 240 Seiten |
| Language | Deutsch |
| Format | 14,8 x 21 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Additional Content
Additional Content
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Authors
Autor*innen
Tags
Keywordsanarchistische Praxis, August 2025, Autoritarismus, Befreiungsbewegungen, Brasilien, Chile, Germany, Dystopie, Epistemologien, Fachwörterbücher, geistiges Eigentum, Gemein-Werdung, gesellschaftliche Wiedereinbettung, indigenes Wissen, intentionale Gemeinschaft, Jüdischsein, Kibbuz-Sozialismus, Klimakrise, kollektive Selbstverwaltung, Mafia, Nagoya-Protokoll, Neoliberalismus, Nicht-Bewegungen, Orthopraxis, Phantasie, Polanyi, politische Repräsentation, Politisierung, Post-Utopie, Posthumanismus, präfigurative Politik, Rasse, Rassismus, Sizilien, soziale Bewegungen, soziale Transformation, Südafrika, Utopie, Verfassung, Zukunft, zukunftsgerichtete Praktiken, ökologische Klasse, ökologische Solidarität
Abstracts
Abstracts
Die Utopie lebt! Plädoyer für eine Blickerweiterung der soziologischen Zeitdiagnose und Gesellschaftstheorie (Antje Daniel & Björn Wendt)
Häufig wird die Gegenwart in gesellschaftstheoretischen und zeitdiagnostischen Debatten als utopielos beschrieben. Furchtbilder, Niedergangserwartungen sowie apokalyptische und rückwärtsgewandte Erzählungen dominierten die Imaginationen von Zukunft. Wir nehmen diese zeitdiagnostische Beschreibung zum Ausgangspunkt, um zu zeigen, dass es trotz dieser Tendenzen falsch ist, die Gegenwart als ein utopieloses Zeitalter zu bestimmen. Diese, aber auch andere verbreitete (Fehl-)Annahmen zur Utopie unterziehen wir einer kritischen Prüfung. Gegen die These vom Ende der Utopie sowie gegen die Fassung von Utopien als ein spezifisches Genre fiktionaler Literatur, als fortschrittlich-emanzipatorische Projekte und als europäisches Phänomen argumentieren wir für einen mehrdimensionalen, elastischen Utopie-Begriff und die Aufwertung der Utopie als Gegenstandsbereich soziologischer Forschung. Eine Soziologie der Utopie hat zum Ziel, als wünschenswert imaginierte Sozialverhältnisse und variierende Vorstellungen des guten Lebens differenziert zu analysieren sowie ihre Verankerung in der sozialen Praxis und Bedeutung für Veränderungsprozesse in Gegenwartsgesellschaften auszuloten.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die Kunst des Überlebens auf einem zerstörten Planeten. Neue Begriffe und Feldnotizen zur Ökologischen Solidarität (Alissa Starodub)
Dieser Beitrag erkundet, wie Utopien angesichts der düsteren Prognosen der Klimakrise in der Gegenwart durch zukunftsgerichtete Praktiken verankert sind. Mit einer akteurszentrierten Betrachtungsweise untersucht er diese bei gewöhnlichen Menschen in ländlichen Gebieten, in sozialen Nicht-Bewegungen, wo im Streben nach einer alternativen Zukunft Praktiken der Überlebenskunst auf einem zerstörten Planeten entstehen. Aus der modernen posthumanistischen Theorie schöpfend, macht er die Begriffe der Ökologischen Solidarität und der Ökologischen Klasse für die Protest- und Solidaritätsforschung fruchtbar und illustriert sie mit einer Collage aus empirischem Material. Dabei zeigt er neue Formen des grenzenlosen Denkens und Handelns gesellschaftlicher Akteure auf, deren Gemeinsamkeiten in einer Praxis der Vergemeinschaftung und Gemein-Werdung liegen und eine gesellschaftspolitische Vision grenzenloser Solidarität als Multispezies-Solidarität in das Hier und Jetzt projizieren. Er schlägt vor, die neuen ontologischen Ansätze, welche diesen Suchbewegungen nach einer alternativen Zukunft zugrunde liegen, theoretisch herauszuarbeiten und meta-theoretisch zu unterfüttern, um sie für eine breite Auseinandersetzung mit zukunftsgerichteten Praktiken nutzen zu können.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Das Oxymoron der anarchistischen Verfassung. Der Tod des Sozialen und die populare konstituierende Macht in Chile (Olaf Kaltmeier)
Dieser Artikel analysiert den Verfassungsentwurf, der von der Verfassungsgebenden Versammlung in Chile zwischen 2021 und 2022 ausgearbeitet wurde, daraufhin, wie die vielfältigen und pluralen Belange unterschiedlicher Sozialer Bewegungen, die mit den Massenprotesten 2018 gegen die neoliberale Verfasstheit Chiles protestierten, in eine neue libertäre Form der politischen Repräsentation überführt werden können. Historisch arbeitet der Beitrag die stark autoritäre Verfassungstradition in Chile auf, die in der von der Militärdiktatur 1980 erlassenen Verfassung kulmuniert. Während diese popularen Anliegen unterdrückt wurden, was letztlich den Tod des Sozialen bewirkte, sorgt – so eine zentrale These dieses Beitrags – der Verfassungsgebende Konvent für eine Wiederbelegung des Sozialen, indem gerade die unterschiedlichen Anliegen von Bewegungen in den Verfassungstext eingeschrieben werden. Mit Rückgriff auf die politische Philosophie untersucht der Beitrag sowohl die Spannungen, die das paradoxe Projekt einer popularen anarchistische Verfassung hervorruft, als auch die Perspektiven für emanzipatorische Prozesse.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Rolle der Orthopraxis in der Entwicklung post-utopischer Kibbuz-Modelle (Merlin Becskey)
Dieser Artikel untersucht den Kibbuz Samar als ein seltenes Beispiel einer post-utopischen, egalitären Gemeinschaft, die zentrale Prinzipien des demokratischen Kibbuz-Sozialismus bewahrt und anarchistisch inspirierte Selbstorganisationspraktiken integriert. Basierend auf ethnografischer Feldforschung stellt er das Konzept der Orthopraxis – eine praxisorientierte Alternative zur ideologischen Orthodoxie – und zeigt, wie Samar hegemoniale neoliberale Logiken sowie bürokratischen Realismus unterläuft. Trotz wachsender interner Spannungen und externer Transformationsdrucke bleibt Samar ein Ort kollektiver Aushandlung, flexibler Kooperation und solidarischen Wirtschaftens – als gelebtes Gegenmodell zur kapitalistischen Realität.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
No Future? Die Zunkunft Siziliens (Miryam Frickel)
Der Beitrag untersucht, wie in Palermo auf Sizilien alternative Zukunftsvorstellungen entstehen, die dominante Erzählungen über die Mafia und Entwicklung infrage stellen. Anhand der Analysekategorie „Situierter Revisionen“ zeigt er empirisch auf, wie lokale Akteur:innen Machtverhältnisse verhandeln, offizielle Narrative umdeuten und eigene Perspektiven auf gesellschaftlichen Wandel formulieren.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Vom Utopieverlust im Neoliberalismus zum Autoritarismus und zurück in die Zukunft (Alexander Neupert-Doppler)
Wie hängen der Utopieverlust unserer Zeit und der Aufstieg des rechten Autoritarismus zusammen? Es ist der Erfolg des Neoliberalismus in den vergangenen Jahrzehnten, der gegen die utopische Kernidee der Gestaltbarkeit von Gesellschaft die Alternativlosigkeit des Marktes setzte. Gegenüber den Menschen folgt daraus eine Anrufung zur Selbstverantwortung, die sich gerade in Krisenzeiten als Überforderung erweist. Aufbauend auf dieser Vereinzelung ist der Rechtspopulismus erfolgreich, indem er nationale Zugehörigkeit als Entlastung verspricht. Die Erzählung von allmächtigen Verschwörungen ist dabei psychoanalytisch auch aus Erfahrungen eigener, verdrängter Ohnmacht zu erklären. Was geblieben ist, sind Dystopien einer drohenden Zukunft, an die angeknüpft werden kann, um der politischen Phantasie wieder Zugang zu utopischen Perspektiven zu verschaffen.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
PERIPHERIE-Stichwort: „Präfigurative Politik“ (Anja Habersang)
Das PERIPHERIE-Stichwort führt in die Funktionsweise präfigurativer Politik ein. Diese Politik fragt danach, wie Menschen die von ihnen angestrebten Zukünfte, utopischen Visionen und Vorstellungen von alternativen Gesellschaften durch ihr gegenwärtiges Handeln im Hier und Jetzt experimentell umsetzen, gestalten oder andeuten.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Unrecht gilt es immer zu bekämpfen. Ruth Weiss im Gespräch über Politisierung, Jüdischsein zwischen Deutschland und Südafrika und Widersprüche der Befreiungsbewegungen (Ruth Weiss, Daniel Bendix, Reinhart Kößler)
Im Interview mit Daniel Bendix and Reinhart Kößler anlässlich ihres 100. Geburtstag am 26.7.2024 berichtet die Journalistin, Romanautorin und Anti-Apartheid-Aktivistin Ruth Weiss von ihrer Politisierung in Südafrika nach der Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Sie kritisiert die Rolle von westlichen Staaten wie der BRD, deren wirtschaftliche Interessen lange Zeit zur Stabilität des Apartheid-Regimes beitrugen. Während Weiss sich angesichts der langfristigen politischen Entwicklungen im südlichen Afrika nach der Unabhängigkeit ernüchtert zeigt, sieht sie Hoffnung in einer gut ausgebildeten, neuen Generation, die gegen autoritäre Regime und wirtschaftliche Ausbeutung auf- und für Gerechtigkeit einsteht.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die amputierte Wiedereinbettung geistiger Eigentumsrechte an genetischen Ressourcen – das Fallbeispiel Brasilien (Anne Tittor, Eduardo Relly, Maria Backhouse und Leoni Schlender)
Im Jahr 2010 wurden nach langen Verhandlungen das Nagoya-Protokoll und mit ihm ein zentraler Mechanismus des gerechten Vorteilsausgleich (englisch: Access and Benefit Sharing – ABS) verabschiedet. Dieser soll der Biopiraterie – gemeint ist die Aneignung und Patentierung von Wissen und kultivierten Pflanzen durch Pharmazie- oder Agrarunternehmen – Einhalt gebieten, indem der Zugang zu genetischen Ressourcen geregelt und die lokalen Wissensträger:innen an den Gewinnen dieser Aneignung beteiligt werden. Im vorliegenden Beitrag argumentieren wir anknüpfend an eine eigentumssoziologische Interpretation von Karl Polanyi, dass dieser ABS-Mechanismus das Ergebnis jahrzehntelanger Aushandlungsprozesse um die gesellschaftliche Wiedereinbettung bzw. soziale Regulierung intellektueller Eigentumsrechte zwischen Marktkräften, Staaten des Globalen Südens und sozialen Bewegungen ist. Vor diesem Hintergrund gehen wir der Frage nach, inwieweit damit eine gesellschaftliche Wiedereinbettung bzw. soziale Regulierung dieser Eigentumsform gelingt. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass es sich um eine „amputierte“ Wiedereinbettung des privaten geistigen Eigentums handelt. Denn obwohl diese internationale Norm erstmals die Bedeutung des Indigenen und Traditionellen Wissens anerkennt, können wir keine soziale Regulierung intellektuellen Eigentums feststellen: Der Ausschluss der zugrunde liegenden privaten Eigentumsform und die damit verbundenen Inwertsetzungsprozesse werden von dem Mechanismus nicht angetastet, sondern bestärkt. Auf lokaler Ebene gelingt bisher nicht einmal die anvisierte monetäre Umverteilung über eine Gewinnbeteiligung. Gleichzeitig erscheint diese Form der Regulierung den meisten Akteuren alternativlos. Dies verdeutlichen wir anhand einer qualitativen Studie zu den gesellschaftlichen Aushandlungen um die Implementierung des ABS-Mechanismus in Brasilien.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„Rasse“ und „Rassismus“ in politikwissenschaftlichen Fachwörterbüchern (Floris Biskamp)
Der Beitrag untersucht, wie sich das Verständnis von Rasse und Rassismus in der deutschsprachigen Politikwissenschaft über die Jahrzehnte hinweg entwickelt hat. Dafür unterzieht er die entsprechenden Einträge in politikwissenschaftlichen Fachwörterbüchern einer qualitativen Inhaltsanalyse. Die Untersuchung zeigt, dass sich das Begriffsverständnis im Laufe der Jahrzehnte verändert hat. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts finden sich offen rassistische Konzeptionen. Diese werden nach dem Ende des Nationalsozialismus zuerst durch Konzeptionen ersetzt, die von der Existenz distinkter Menschenrassen ausgehen und Rassismus als Abwertung oder Benachteiligung einiger Menschenrassen verstehen. Seit den 1970ern treten Konzeptionen hinzu, die die Idee von Menschenrassen zurückweisen und Rassismus als eine biologistische Ideologie verstehen, die Menschenrassen erfindet. Im 21. Jahrhundert schließlich kommen auch Konzeptionen auf, die, soziologisch und insbesondere poststrukturalistisch informiert, Rassismus als eine biologistische oder kulturalistische Differenzkonstruktion erfassen. Insgesamt zeigt sich, dass der Mainstream des Faches die in den Nachbardisziplinen geführte rassismuskritische Debatte nur zögerlich aufnimmt und auch Konzeptionen wirksam bleiben, die in der Rassismusdebatte gemeinhin als unhaltbar oder überholt betrachtet werden.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)





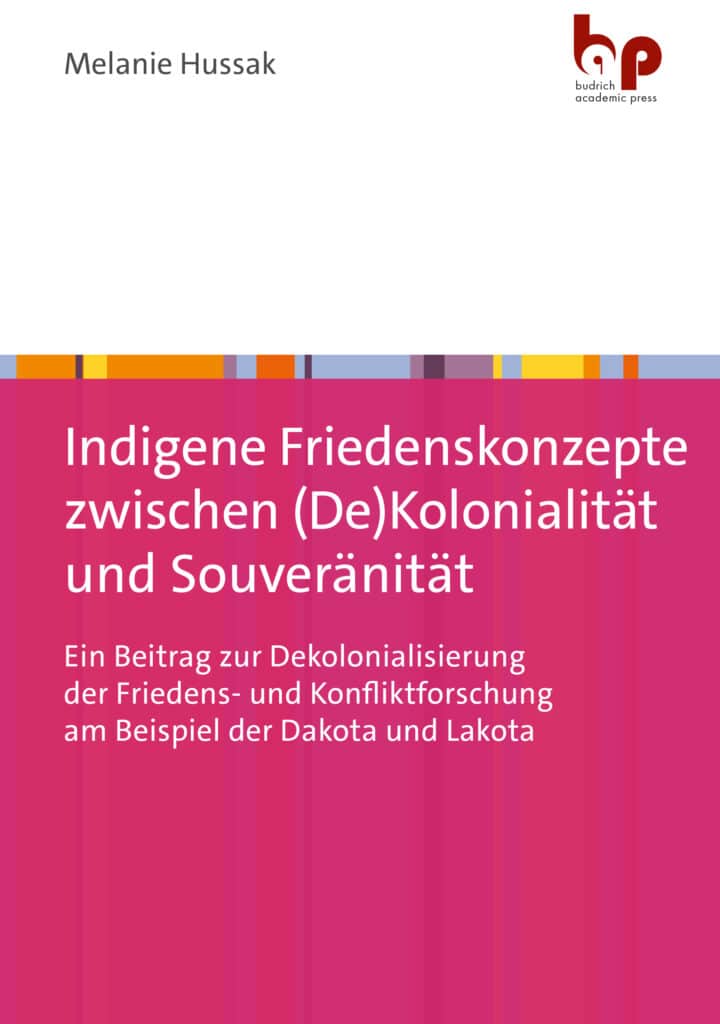
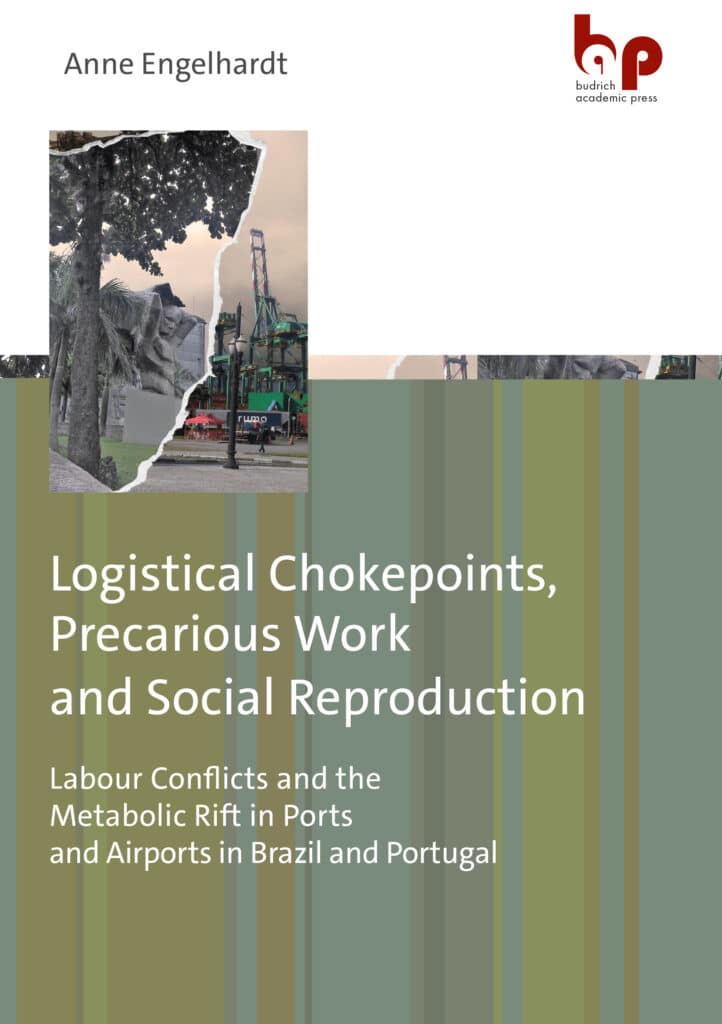
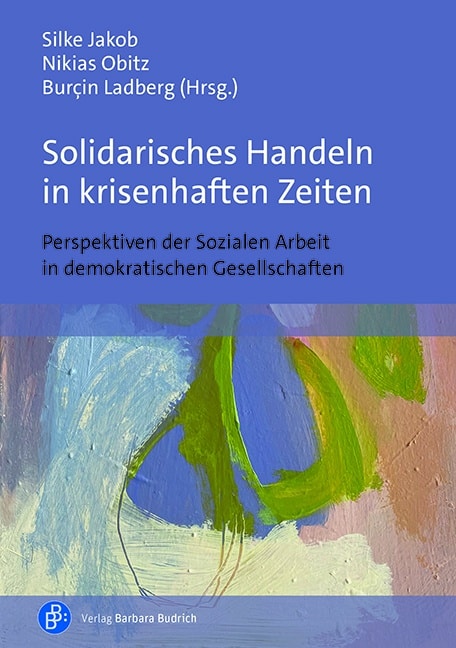

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.