Informationen zur Zeitschrift
Home » Publications » ZeHf 2-2024 | Freie Beiträge
ZeHf 2-2024 | Freie Beiträge
Erscheinungsdatum : 22.10.2025
35,00 €
Inhalt
ZeHf – Zeitschrift für empirische Hochschulforschung
2-2024: Freie Beiträge
Editorial
Robert Pelz / Franziska Schulze-Stocker / Johannes Winter / Wolfgang Haag: Optimierungspotentiale der Studienabbruchsvorhersage durch Frühwarnsysteme – Werden die „richtigen“ Studierenden gewarnt? (im Open Access verfügbar)
Katharina Lohberger / Edith Braun: Student Engagement in Zeiten digitaler Lehre (im Open Access verfügbar)
Stefanie Go / Kathrin Schelling: Welche Orientierungen prägen den ersten Eindruck Lehrender von einem KI-gestützten Hochschul-Assistenz-System? Explorative Annäherung über eine sinngenetische Typik
Ricarda Rübben: Beliefs von Professor*innen in der Lehrkräfte- und Mediziner*innen-(aus)bildung zur (Nicht)Bedeutsamkeit eigener berufspraktischer Erfahrungen für die Lehr- und Forschungstätigkeit
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zehf.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZeHf-Alert anmelden.
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 2367-3044 |
| eISSN | 2367-3052 |
| Volume | 8. Jahrgang 2024 |
| Edition | 2-2024 |
| Date of publication | 22.10.2025 |
| Scope | 88 Seiten |
| Language | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Additional Content
Autor*innen
Keywordsberufspraktische Erfahrungen, digitale Lehre, dokumentarische Methode, Frühwarnsystem, Hochschule, Hochschullehrende, Identifizierungsmerkmale, KI in der Hochschulbildung, Lehrkräftebildung, Mediziner*innenausbildung, Migrationshintergrund, Oktober 2025, Optimierung, Orientierungsrahmen, Partizipation, Schulpädagogik, Student Engagement, Studienabbruch, Studienverlauf, Studierende der ersten Generation, Technologieakzeptanz, technologiegestütztes Lernen mit Audio- und Videodateien
Abstracts
Optimierungspotentiale der Studienabbruchsvorhersage durch Frühwarnsysteme – Werden die „richtigen“ Studierenden gewarnt? (Robert Pelz, Franziska Schulze-Stocker, Johannes Winter, Wolfgang Haag)
Um Studierende bereits vor der Verfestigung von Problemlagen im Studienverlauf und somit weit vor einem potenziellen Studienabbruch unterstützen zu können, sind an einigen deutschen Hochschulen Frühwarnsysteme eingeführt worden. Dabei unterscheiden sich die Warnsysteme in der Art und Weise, wie sie konzipiert sind und wie sie die Studierenden erkennen, die möglichweise einen problematischen Studienverlauf haben könnten. Für den vorliegenden Beitrag dient das Frühwarnsystem der Technischen Universität Dresden als Beispiel dafür, wie durch Variation von Identifizierungsregeln eine Verbesserung der Erkennung problematischer Studienverläufe erfolgen kann. Es wird dargestellt, wie ein Weiterentwicklungsprozess eines aus der Praxis entstandenen Systems erfolgen kann und welche Daten dafür zur Verfügung stehen müssen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch die vorgestellten Optimierungsmethoden eine Verbesserung der Identifizierungsleistung des Frühwarnsystems erreicht werden kann, sodass im Testdatensatz sechs bis acht Prozentpunkte mehr Studierende korrekt bestimmt werden können. Schlüsselwörter: Frühwarnsystem, Studienabbruch, Studienverlauf, Optimierung, Identifizierungsmerkmale
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Student Engagement in Zeiten digitaler Lehre (Katharina Lohberger, Edith Braun)
Das Konzept „Student Engagement“ wurde als entscheidend für einen erfolgreichen Studienverlauf identifiziert. Das dürfte besonders für Studierende der ersten Generation oder Studierende mit Migrationshintergrund zutreffen, da sie über weniger Kenntnisse des deutschen Hochschulsystems verfügen und sich vorrangig an Kommiliton*innen oder Lehrende wenden können. Die pandemiebedingte Umstellung zur Online-Lehre führte zu einer Abnahme der Partizipation aller Studierenden. Der Beitrag untersucht, wie sich die Partizipation in dieser Zeit auf den Studienerfolg auswirkt und ob Studierende mit Migrationshintergrund sowie Studierende der ersten Generation ein höheres Risiko haben, nicht zu partizipieren. Auf Basis einer Studierendenbefragung (N=6.982) wurde ein Pfadmodell geschätzt. Die Ergebnisse zeigen: stärker involvierte Studierende kommen besser mit digitaler Lehre zurecht. Studierende mit Migrationshintergrund partizipieren in Zeiten der digitalen Lehre stärker, weisen jedoch weiterhin mehr Leistungsprobleme auf. Die Ergebnisse und Limitationen werden diskutiert. Schlüsselwörter: Hochschule, Student Engagement, Partizipation, digitale Lehre, Migrationshintergrund, Studierende der ersten Generation
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Welche Orientierungen prägen den ersten Eindruck Lehrender von einem KI-gestützten Hochschul-Assistenz-System? Explorative Annäherung über eine sinngenetische Typik (Stefanie Go, Kathrin Schelling)
Um neue Bildungstechnologien, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren, erfolgreich in den Lehr-/Lernprozessen der Hochschulbildung zu verankern, bedarf es der aktiven Mitwirkung der Lehrenden. Diese entscheiden sich allerdings nicht immer schon beim ersten Kontakt mit einer Anwendung klar für oder gegen diese: Zwischen Zustimmung und Ablehnung eröffnet sich ein Spektrum an Einstellungen und Überzeugungen, die es bei der Entwicklung und Implementierung KI-basierter Bildungstechnologien zu beachten gilt. Dieser Beitrag zeigt, wie auf Grundlage einer schriftlichen Expert*innenbefragung zum Hochschul-Assistenz-System „HAnS“ mittels der Dokumentarischen Methode fünf Orientierungsrahmen identifiziert wurden, anhand derer sich beschreiben lässt, wie sich Lehrende vor dem Hintergrund ihres persönlichen Bildungsverständnisses zu einer bislang unbekannten KI-Anwendung für die Hochschulbildung positionieren. Schlüsselwörter: KI in der Hochschulbildung, Dokumentarische Methode, Orientierungsrahmen, Technologieakzeptanz, technologiegestütztes Lernen mit Audio- und Videodateien
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Beliefs von Professor*innen in der Lehrkräfte- und Mediziner*innen-(aus)bildung zur (Nicht)Bedeutsamkeit eigener berufspraktischer Erfahrungen für die Lehr- und Forschungstätigkeit (Ricarda Rübben)
Während kein Zweifel daran besteht, dass professorale Hochschullehrende für ihre Tätigkeiten in Lehre und Forschung über wissenschaftliche Expertise verfügen sollten, ist die Antwort auf die Frage, inwiefern sie in professionsorientierten Studiengängen darüber hinaus zusätzlich auch eigene berufspraktische Erfahrungen vorweisen können sollten, deutlich weniger klar, teilweise auch Gegenstand heftiger Kontroversen. Der vorliegende Beitrag widmet sich der Frage, welche Relevanz Professor*innen der eigenen (fehlenden) berufspraktischen Erfahrung für ihre Lehr- und Forschungstätigkeit zuschreiben. Dazu werden Ergebnisse aus zwei Interviewstudien mit Professor*innen aus den Bereichen der Schulpädagogik und der medizinischen (Vor)Klinik anhand der zugeschriebenen Ausprägung und den inhaltlichen Dimensionen der Bedeutsamkeit für ihre Lehre und Forschung vergleichend dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass den (fehlenden) schulpraktischen bzw. klinischen Erfahrungen ein ähnliches – überwiegend hohes bis mittleres – Maß an Bedeutsamkeit insbesondere für die Lehr-, aber auch die Forschungstätigkeit zugeschrieben wird. Schlüsselwörter: Berufspraktische Erfahrungen, Lehrkräftebildung, Mediziner*innenausbildung, Hochschullehrende, Schulpädagogik
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
ZeHf – Zeitschrift für empirische Hochschulforschung
2-2024: Freie Beiträge
Editorial
Robert Pelz / Franziska Schulze-Stocker / Johannes Winter / Wolfgang Haag: Optimierungspotentiale der Studienabbruchsvorhersage durch Frühwarnsysteme – Werden die „richtigen“ Studierenden gewarnt? (im Open Access verfügbar)
Katharina Lohberger / Edith Braun: Student Engagement in Zeiten digitaler Lehre (im Open Access verfügbar)
Stefanie Go / Kathrin Schelling: Welche Orientierungen prägen den ersten Eindruck Lehrender von einem KI-gestützten Hochschul-Assistenz-System? Explorative Annäherung über eine sinngenetische Typik
Ricarda Rübben: Beliefs von Professor*innen in der Lehrkräfte- und Mediziner*innen-(aus)bildung zur (Nicht)Bedeutsamkeit eigener berufspraktischer Erfahrungen für die Lehr- und Forschungstätigkeit
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zehf.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZeHf-Alert anmelden.
Bibliography
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 2367-3044 |
| eISSN | 2367-3052 |
| Volume | 8. Jahrgang 2024 |
| Edition | 2-2024 |
| Date of publication | 22.10.2025 |
| Scope | 88 Seiten |
| Language | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Additional Content
Additional Content
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Authors
Autor*innen
Tags
Keywordsberufspraktische Erfahrungen, digitale Lehre, dokumentarische Methode, Frühwarnsystem, Hochschule, Hochschullehrende, Identifizierungsmerkmale, KI in der Hochschulbildung, Lehrkräftebildung, Mediziner*innenausbildung, Migrationshintergrund, Oktober 2025, Optimierung, Orientierungsrahmen, Partizipation, Schulpädagogik, Student Engagement, Studienabbruch, Studienverlauf, Studierende der ersten Generation, Technologieakzeptanz, technologiegestütztes Lernen mit Audio- und Videodateien
Abstracts
Abstracts
Optimierungspotentiale der Studienabbruchsvorhersage durch Frühwarnsysteme – Werden die „richtigen“ Studierenden gewarnt? (Robert Pelz, Franziska Schulze-Stocker, Johannes Winter, Wolfgang Haag)
Um Studierende bereits vor der Verfestigung von Problemlagen im Studienverlauf und somit weit vor einem potenziellen Studienabbruch unterstützen zu können, sind an einigen deutschen Hochschulen Frühwarnsysteme eingeführt worden. Dabei unterscheiden sich die Warnsysteme in der Art und Weise, wie sie konzipiert sind und wie sie die Studierenden erkennen, die möglichweise einen problematischen Studienverlauf haben könnten. Für den vorliegenden Beitrag dient das Frühwarnsystem der Technischen Universität Dresden als Beispiel dafür, wie durch Variation von Identifizierungsregeln eine Verbesserung der Erkennung problematischer Studienverläufe erfolgen kann. Es wird dargestellt, wie ein Weiterentwicklungsprozess eines aus der Praxis entstandenen Systems erfolgen kann und welche Daten dafür zur Verfügung stehen müssen. Die Ergebnisse zeigen, dass durch die vorgestellten Optimierungsmethoden eine Verbesserung der Identifizierungsleistung des Frühwarnsystems erreicht werden kann, sodass im Testdatensatz sechs bis acht Prozentpunkte mehr Studierende korrekt bestimmt werden können. Schlüsselwörter: Frühwarnsystem, Studienabbruch, Studienverlauf, Optimierung, Identifizierungsmerkmale
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Student Engagement in Zeiten digitaler Lehre (Katharina Lohberger, Edith Braun)
Das Konzept „Student Engagement“ wurde als entscheidend für einen erfolgreichen Studienverlauf identifiziert. Das dürfte besonders für Studierende der ersten Generation oder Studierende mit Migrationshintergrund zutreffen, da sie über weniger Kenntnisse des deutschen Hochschulsystems verfügen und sich vorrangig an Kommiliton*innen oder Lehrende wenden können. Die pandemiebedingte Umstellung zur Online-Lehre führte zu einer Abnahme der Partizipation aller Studierenden. Der Beitrag untersucht, wie sich die Partizipation in dieser Zeit auf den Studienerfolg auswirkt und ob Studierende mit Migrationshintergrund sowie Studierende der ersten Generation ein höheres Risiko haben, nicht zu partizipieren. Auf Basis einer Studierendenbefragung (N=6.982) wurde ein Pfadmodell geschätzt. Die Ergebnisse zeigen: stärker involvierte Studierende kommen besser mit digitaler Lehre zurecht. Studierende mit Migrationshintergrund partizipieren in Zeiten der digitalen Lehre stärker, weisen jedoch weiterhin mehr Leistungsprobleme auf. Die Ergebnisse und Limitationen werden diskutiert. Schlüsselwörter: Hochschule, Student Engagement, Partizipation, digitale Lehre, Migrationshintergrund, Studierende der ersten Generation
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Welche Orientierungen prägen den ersten Eindruck Lehrender von einem KI-gestützten Hochschul-Assistenz-System? Explorative Annäherung über eine sinngenetische Typik (Stefanie Go, Kathrin Schelling)
Um neue Bildungstechnologien, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren, erfolgreich in den Lehr-/Lernprozessen der Hochschulbildung zu verankern, bedarf es der aktiven Mitwirkung der Lehrenden. Diese entscheiden sich allerdings nicht immer schon beim ersten Kontakt mit einer Anwendung klar für oder gegen diese: Zwischen Zustimmung und Ablehnung eröffnet sich ein Spektrum an Einstellungen und Überzeugungen, die es bei der Entwicklung und Implementierung KI-basierter Bildungstechnologien zu beachten gilt. Dieser Beitrag zeigt, wie auf Grundlage einer schriftlichen Expert*innenbefragung zum Hochschul-Assistenz-System „HAnS“ mittels der Dokumentarischen Methode fünf Orientierungsrahmen identifiziert wurden, anhand derer sich beschreiben lässt, wie sich Lehrende vor dem Hintergrund ihres persönlichen Bildungsverständnisses zu einer bislang unbekannten KI-Anwendung für die Hochschulbildung positionieren. Schlüsselwörter: KI in der Hochschulbildung, Dokumentarische Methode, Orientierungsrahmen, Technologieakzeptanz, technologiegestütztes Lernen mit Audio- und Videodateien
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Beliefs von Professor*innen in der Lehrkräfte- und Mediziner*innen-(aus)bildung zur (Nicht)Bedeutsamkeit eigener berufspraktischer Erfahrungen für die Lehr- und Forschungstätigkeit (Ricarda Rübben)
Während kein Zweifel daran besteht, dass professorale Hochschullehrende für ihre Tätigkeiten in Lehre und Forschung über wissenschaftliche Expertise verfügen sollten, ist die Antwort auf die Frage, inwiefern sie in professionsorientierten Studiengängen darüber hinaus zusätzlich auch eigene berufspraktische Erfahrungen vorweisen können sollten, deutlich weniger klar, teilweise auch Gegenstand heftiger Kontroversen. Der vorliegende Beitrag widmet sich der Frage, welche Relevanz Professor*innen der eigenen (fehlenden) berufspraktischen Erfahrung für ihre Lehr- und Forschungstätigkeit zuschreiben. Dazu werden Ergebnisse aus zwei Interviewstudien mit Professor*innen aus den Bereichen der Schulpädagogik und der medizinischen (Vor)Klinik anhand der zugeschriebenen Ausprägung und den inhaltlichen Dimensionen der Bedeutsamkeit für ihre Lehre und Forschung vergleichend dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass den (fehlenden) schulpraktischen bzw. klinischen Erfahrungen ein ähnliches – überwiegend hohes bis mittleres – Maß an Bedeutsamkeit insbesondere für die Lehr-, aber auch die Forschungstätigkeit zugeschrieben wird. Schlüsselwörter: Berufspraktische Erfahrungen, Lehrkräftebildung, Mediziner*innenausbildung, Hochschullehrende, Schulpädagogik
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)


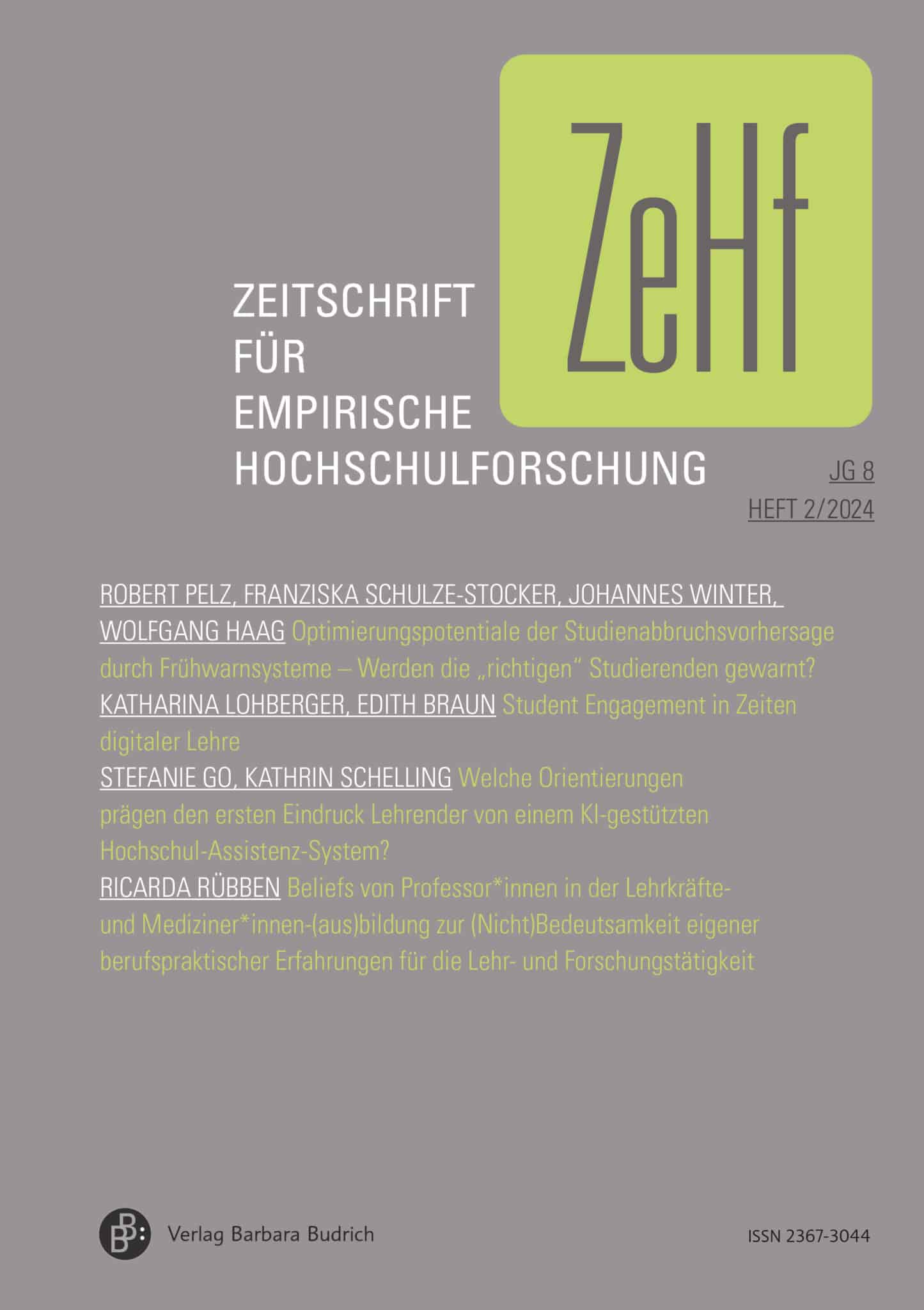

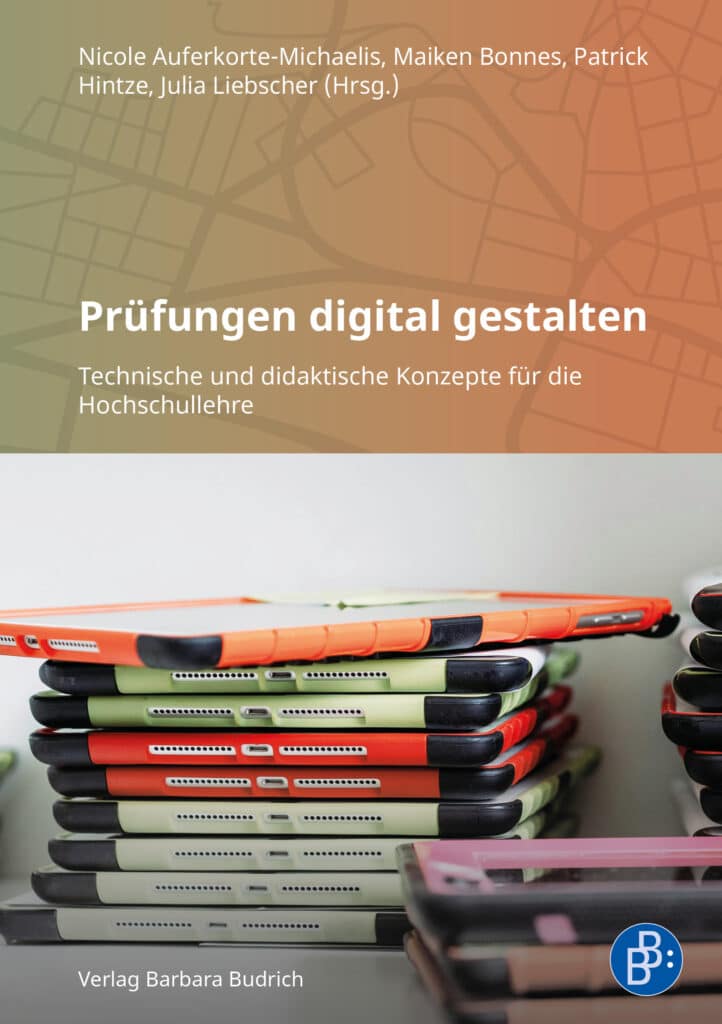




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.