Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » ZeM 1+2-2024 | Method(ologi)en erziehungswissenschaftlicher Migrationsforschung / Jahrestagung „Transformation(en) im Fokus der SIIVE“
ZeM 1+2-2024 | Method(ologi)en erziehungswissenschaftlicher Migrationsforschung / Jahrestagung „Transformation(en) im Fokus der SIIVE“
Erscheinungsdatum : 16.01.2025
59,80 € inkl. MwSt.
- Inhalt
- Bibliografie
- Produktsicherheit
- Zusatzmaterial
- Bewertungen (0)
- Autor*innen
- Schlagwörter
- Abstracts
Inhalt
Zeitschrift für erziehungswissenschaftliche Migrationsforschung (ZeM)
1+2-2024: Method(ologi)en erziehungswissenschaftlicher Migrationsforschung / Jahrestagung „Transformation(en) im Fokus der SIIVE“
Donja Amirpur / Ulrike Hormel / Claudia Machold / Patricia Stošić: Editorial zur Doppelausgabe
Themenschwerpunkt 1: Method(ologi)en erziehungswissenschaftlicher Migrationsforschung. Zugänge, Debatten und Forschungspraxis
Gastbeitrag
Karolina Barglowski / Lisa Bonfert / Paula Wallmeyer: Den Feldzugang reflexiv gestalten: Care-Ethik in der qualitativen (Migrations‐)Forschung
Beiträge im Themenschwerpunkt
Cristina Diz Muñoz: Sichtbarkeitsregime im Kontext schulischer Segregation. Forschungsmethodologische Reflexionen am Beispiel einer videografischen Studie
Jonas Manuel Steiger: Erfassung und Rekonstruktion schüler:innenbezogener (impliziter) Kognitionen von Lehrpersonen mittels Repertory Grid Technik (im Open Access verfügbar)
Themenschwerpunkt 2: Jahrestagung „Transformation(en) im Fokus der SIIVE. Transformationsprozesse erforschen, reflektieren, begleiten“ am 09./10.03.2023 an der Freien Universität Berlin
Gastbeitrag
Waltraud Meints-Stender: Solidarität und Transformation in der Migrationsgesellschaft
Beiträge im Themenschwerpunkt
Ellen Kollender / Dorothee Schwendowius: Aktuelle Fluchtmigrationen als Anlass für diskriminierungskritischen schulischen Wandel? Empirische Analysen und Reflexion von Transformationserwartungen (im Open Access verfügbar)
Aysun Doğmuş / Anja Steinbach: Krisenkonstellationen schulischer Transformation – Verunmöglichungen des Sprechens über Rassismus im Spannungsfeld institutionalisierter Routinen und rassismuskritischer Professionalisierung
Janne Braband: Religiöse Vielfalt als Herausforderung für die Schule – Schule als Herausforderung für ‚religiös Andere‘? Erfahrungen und religionspädagogische Überlegungen nicht-christlicher Religionslehrkräfte im Religionsunterricht für alle in Hamburg
Themenungebundene Beiträge
Bettina Fritzsche / Melanie Kuhn / Georg Rißler: Zwischen förderbedürftiger Adressat:innenschaft und politischer Akteur:innenschaft. Adressierungsweisen migrantisierter Eltern in Dokumenten zur schulischen Gremienarbeit
Sylvia Kesper-Biermann / Mira Grünwald: Sichtweisen auf Migration und Zugehörigkeit in Deutschland. Eine Comicanalyse der Graphic Novel Madgermanes
Nora Friederike Hoffmann: Professionelles Handeln in Integrationskursen? Teilnehmer:innenerfahrungen zwischen Macht und Willkür
Rezensionen
Magnus Frank: Stender, Wolfram (2023): Rassismuskritik. Eine Einführung. Reihe „Soziale Arbeit in der Gesellschaft“. Stuttgart: W. Kohlhammer
Carlotta Voß / Markus Rieger-Ladich: Akbaba, Yalız/Heinemann, Alisha M.B. (Hrsg.) (2023): Erziehungswissenschaften dekolonisieren. Theoretische Debatten und praxisorientierte Impulse. Weinheim-Basel: Beltz Juventa
Vanessa Ohm: Doğmuş, Aysun (2022): Professionalisierung in Migrationsverhältnissen – Eine rassismuskritische Perspektive auf das Referendariat angehender Lehrer*innen. Wiesbaden: Springer VS
Katharina Schitow: Jording, Judith (2022): Flucht, Migration und kommunale Schulsysteme. Differenzierungspraxen und Partizipationsbedingungen in der Grundschule. Bielefeld: transcript Verlag
Florian Weitkämper: Machold, Claudia/Wienand, Carmen (2021): Die Herstellung von Differenz in der Grundschule. Eine Langzeitethnographie. Weinheim: Beltz Juventa
Tagungsberichte
Carmen Yong-Ae Wienand / Marius Mader: Order(s) of Difference in Childhood and Education. International Conference. 19.-21.09.2023, Goethe University Frankfurt/Main
Jocelyn Jasmin Dechêne / Laura Meyer-Stolte: Late Summer School “Methodologie rassismuskritischer Forschung”. 07.-09.12.2023, Universität Bielefeld
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zem.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZeM-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 2701-2476 |
| eISSN | 2701-2484 |
| Jahrgang | 3. Jahrgang 2024 |
| Ausgabe | 1+2-2024 |
| Erscheinungsdatum | 16.01.2025 |
| Umfang | 204 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Zusatzmaterial
Autor*innen
SchlagwörterAdressierungsanalyse, antimuslimischer Rassismus, Care-Ethik, Comics, Differenzkategorie Religion, Diskriminierung, dokumentarische Methode, Dokumentenanalyse, Feldzugang, Flucht, Gatekeeper:innen, Gleichheit und Differenz, hegemoniale Blickfelder, institutioneller Wandel, Integration in Deutschland, Integrationsdiskurs, Integrationskurs, interreligiös-dialogisches Lernen, Januar 2025, Krise, Kritische Migrationsforschung, Migrantenorganisationen, migrantisierte Eltern, Migration, Migrationsgesellschaft, othering, Othering-Prozesse in Schule und Unterricht, Partizipation, Positionalität, Professionalisierung, Professionalität, Rassismuskritik, Reifizierung, Religionsunterricht für alle (RUfa), religiöse Vielfalt, Religiöses Othering, Repertory Grid Technik, Repräsentationskritik, Schulentwicklung, Schulgesetze, schulische Gremienarbeit, schulische Separationspraktiken, Schüler:innen mit Migrationshintergrund, schüler:innenbezogene Kognitionen, sensus communis materialis, Sichtbarkeitsordnungen, Solidarität, soziale Ungleichheiten, Sprachförderung, Subjektivierungsanalyse, Transformation, Ukraine, Ungleichheit, Verbundenheit, Visuelle Ethnografie
Abstracts
Den Feldzugang reflexiv gestalten: Care-Ethik in der qualitativen (Migrations‐)Forschung (Karolina Barglowski, Lisa Bonfert, Paula Wallmeyer)
Dieser Artikel beleuchtet ethische Herausforderungen beim Zugang zu Forschungsfeldern in der Migrationsforschung und in der Interaktion mit den Teilnehmenden anhand eines empirischen Forschungsprojekts. Vor dem Hintergrund einer reflexiven Migrationsforschung diskutieren und illustrieren wir methodologische Herausforderungen und Möglichkeiten zur Etablierung ethischer Forschungspraktiken am Beispiel des Projekts Migrantenorganisationen und die Koproduktion sozialer Sicherung (MIKOSS). Ausgehend von einer Care-Ethik argumentieren wir für Forschungsansätze, die das Wohlergehen der Teilnehmenden und der Forschenden in den Mittelpunkt stellen. Unsere Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit einer reflexiven Positionalität, die Machtasymmetrien adressiert und den Respekt für die Erfahrungen von Menschen, die als Migrant:innen konstruiert werden, stärkt. Abschließend diskutieren wir, wie eine Care-Ethik eine kritische Analyse von Machtverhältnissen unterstützen und Reifizierungen in der Migrationsforschung abbauen kann. Schlüsselwörter: Care-Ethik, Kritische Migrationsforschung, Feldzugang, Positionalität, Migrantenorganisationen, Othering, Gatekeeper:innen
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Sichtbarkeitsregime im Kontext schulischer Segregation. Forschungsmethodologische Reflexionen am Beispiel einer videografischen Studie (Cristina Diz Muñoz)
Der Beitrag untersucht Sichtbarkeitsregime aus einer visuell-ethnografischen und subjektivierungsanalytischen Perspektive am Beispiel einer videografischen Forschungsstudie zu schulischen Segregationspraktiken. Im Anschluss an Judith Butlers Deutung des Intelligibel-Werdens als das Ergebnis einer bestimmten Sichtbarmachung (vgl. Butler 2020, 1997a, 1997b) fragt er nach Formen der Erkennbarkeit, die mit Anerkennungsprozessen zusammenhängen und reflektiert, wie Machtverhältnisse Möglichkeiten des Sichtbar-Werdens bedingen. Auf der Basis der empirischen Analysemigrantisierter Subjektpositionen diskutiert er sodann das Spannungsverhältnis zwischen Forschungsmethode und Forschungsgegenstand, indem er anhand postkolonial inspirierter Ansätze methodologische Herausforderungen im Kontext einer kritischen videobasierten Migrationsforschung aufgreift. Abschließend lässt sich Videografie als Methodologie des (An‐)Blickens und des Zeigens einerseits machttheoretisch befragen und andererseits erziehungswissenschaftlich reflektieren. Schlüsselwörter: Schulische Separationspraktiken, Sichtbarkeitsordnungen, hegemoniale Blickfelder, Othering-Prozesse in Schule und Unterricht, Visuelle Ethnografie, Subjektivierungsanalyse
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Erfassung und Rekonstruktion schüler:innenbezogener (impliziter) Kognitionen von Lehrpersonen mittels Repertory Grid Technik (Jonas Manuel Steiger)
Schüler:innenbezogene Kognitionen von Lehrpersonen spielen eine zentrale Rolle hinsichtlich des Lehrer:innenhandelns und können einen Einfluss auf den Bildungserfolg der Schüler:innen haben. Die Erfassung und Rekonstruktion dieser Kognitionen scheinen an keine verbindliche Methodik gebunden zu sein. Allerdings gilt es – insbesondere im Kontext migrationsbezogener Schüler:innenvielfalt – die methodologischen Fragen nach der Reifizierung, nach möglichen Antwortverzerrungen aufgrund der sozialen Erwünschtheit, aber auch nach der Eignung der Methode zur Untersuchung impliziter Kognitionen zu berücksichtigen. Dieser Beitrag stellt vor diesem Hintergrund eine dafür als geeignet erachtete Anwendungsform der Repertory Grid Technik exemplarisch vor. Schlüsselwörter: Repertory Grid Technik, schüler:innenbezogene Kognitionen, Reifizierung, Schüler:innen mit Migrationshintergrund
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Solidarität und Transformation in der Migrationsgesellschaft (Waltraud Meints-Stender)
Der Beitrag beginnt mit Reflexionen zu Migration und dem Begriff der Migrationsgesellschaft, um dann die Solidaritätsbegriffe von Rahel Jaeggi und Hannah Arendt als Prozesskategorie in den Fokus zu nehmen. Im Zentrum des Beitrages steht dabei die Frage, was diese Solidaritätsbegriffe kennzeichnet und welche Bedeutung das Verhältnis von Gleichheit und Differenz auf die Pluralität der Perspektiven und die Wirklichkeit der Welt hat, um abschließend diese Solidaritätsbegriffe mit einer Praxis des sensus communis materialis zu verknüpfen, der gesellschaftspolitische Erfahrungen zugänglich macht und emanzipatorische Transformationsprozesse ermöglicht. Schlüsselwörter: Migrationsgesellschaft, Solidarität, Transformation, Verbundenheit, Gleichheit und Differenz, sensus communis materialis
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Aktuelle Fluchtmigrationen als Anlass für diskriminierungskritischen schulischen Wandel? Empirische Analysen und Reflexion von Transformationserwartungen (Ellen Kollender, Dorothee Schwendowius)
Angesichts der Fluchtbewegungen der letzten Jahre, wie aus Syrien und der Ukraine, eröffnen sich Fragen nach Kontinuitäten sowie (kollektiven) Lern- und Veränderungsprozessen in Schulen hinsichtlich der Begleitung transnationaler Bildungswege. Der Beitrag geht diesen Fragen basierend auf Interviewanalysen aus einem qualitativ-explorativen Forschungsprojekt nach. Vor dem Hintergrund der Reflexion eigener Transformationserwartungen, die durch die Perspektive diskriminierungskritischer Schulentwicklung angeregt sind, werden Praktiken der Begleitung geflüchteter Schüler:innen rekonstruiert und auf ihre Bedeutung für eine diskriminierungskritische schulische Transformation befragt. Es wird gezeigt, dass institutionelle Spielräume in einigen Schulen zwar für kritische Reflexionen und Praktiken genutzt werden, um (potenziellen) Ausschlüssen im Kontext von Flucht entgegenzuwirken. Diese Interventionen deuten jedoch weniger auf eine Transformation im Sinne einer umfassenden diskriminierungskritischen Veränderung von Schule, denn auf ein Navigieren an den Rändern des institutionell Geregelten, das sich als ambivalent erweist. Schlüsselwörter: Transformation, Schulentwicklung, Flucht, Ukraine, Diskriminierung, institutioneller Wandel
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Krisenkonstellationen schulischer Transformation – Verunmöglichungen des Sprechens über Rassismus im Spannungsfeld institutionalisierter Routinen und rassismuskritischer Professionalisierung (Aysun Doğmuş, Anja Steinbach)
Mit dem Beitrag rücken wir das Spannungsfeld rassismuskritischer Professionalisierung in den Mittelpunkt, das sich in der Auseinandersetzung von Lehrer:innen mit institutionalisierten Routinen an Schulen während ihrer Teilnahme an einer Fortbildung entfalten kann. Anhand empirischer Analysen aus zwei qualitativ-rekonstruktiven Studien werden Verunmöglichungen des Sprechens über Rassismus nachgezeichnet. Dieses Spannungsfeld der Verunmöglichungen diskutieren wir als Verweis auf eine doppelte Krise, da die Krise das Deuten und Handeln der Lehrer:innen und institutionalisierte Routinen, somit auch die symbolische Ordnung der Schule, berührt. Es werden exemplarisch folgende drei Krisenkonstellationen skizziert: Die (läutenden) Alarmglocken, die Außendarstellung des (schulischen) Selbst und der Rassist im (selben) Boot. Auf dieser Grundlage wird das Potenzial der Krisenkonstellationen für schulische Transformation im Blickwinkel umkämpfter Transition ausgelotet und die empirisch-analytische Konzeptualisierung der Wechselseitigkeit von rassismuskritischer Professionalisierung und Schulentwicklung mit Impulsen für die Diskussion um Bildungserfordernisse der Migrationsgesellschaft geschärft. Schlüsselwörter: Rassismuskritik, Professionalisierung, Schulentwicklung, Krise, Transformation
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Religiöse Vielfalt als Herausforderung für die Schule – Schule als Herausforderung für ‚religiös Andere‘? Erfahrungen und religionspädagogische Überlegungen nicht-christlicher Religionslehrkräfte im Religionsunterricht für alle in Hamburg (Janne Braband)
Der Artikel thematisiert den Umgang mit Religion und religiöser Vielfalt im schulischen Kontext als Transformationsanforderung, die nicht zuletzt auch den Religionsunterricht betrifft. Während dort versucht wird, mit interreligiös-dialogischem Lernen auf die wachsende Heterogenität einzugehen, zeigen Studien aus einer macht- und differenzanalytischen Perspektive, wie im schulischen Kontext (zugeschriebene) Religionszugehörigkeit neben Merkmalen wie Sprache, Hautfarbe, Herkunft als wirkmächtige Differenzkategorie (re)konstruiert wird. Der Beitrag zeigt vor diesem Hintergrund, wie auch nichtchristliche Religionslehrkräfte Positionierungen als ‚religiös Andere‘ erleben, und beleuchtet ihre religionspädagogischen Überlegungen zum Umgang mit religiöser Vielfalt im Hamburger Religionsunterricht für alle (RUfa). In einer exemplarischen und explorativen Herangehensweise werden dazu Ergebnisse aus drei Expert:inneninterviews mit Religionslehrkräften vorgestellt, die u. a. Hinweise darauf geben, wie religiöse Bezüge in der Schule jenseits von dominanten Zuschreibungs- und Ausgrenzungspraxen aufgegriffen werden können. Schlüsselwörter: Religiöse Vielfalt, Differenzkategorie Religion, Religiöses Othering, interreligiös-dialogisches Lernen, Religionsunterricht für alle (RUfa), antimuslimischer Rassismus
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Zwischen förderbedürftiger Adressat:innenschaft und politischer Akteur:innenschaft. Adressierungsweisen migrantisierter Eltern in Dokumenten zur schulischen Gremienarbeit (Bettina Fritzsche, Melanie Kuhn, Georg Rißler)
Wie Eltern im Kontext postwohlfahrtsstaatlicher neoliberaler Logiken des Forderns und Förderns in Dokumenten zur schulischen Gremienarbeit adressiert und im Dienste schulischer Interessen funktionalisiert werden, ist Erkenntnisinteresse einer adressierungstheoretisch fundierten Dokumentenanalyse von Schulgesetzen und ministerialen Informationsbroschüren zur schulischen Elternvertretungsarbeit. In einer bundeslandvergleichenden Optik lassen sich ungleichheitsrelevante Subjektivierungsweisen migrantisierter Eltern rekonstruieren, die sich zwischen einer Adressierung als passive förderbedürftige Objekte von Elternbeiratsarbeit und einer Autorisierung als eigenständige schulpolitische Akteur:innen aufspannen. Schlüsselwörter: Schulische Gremienarbeit, migrantisierte Eltern, Ungleichheit, Schulgesetze, Partizipation, Dokumentenanalyse, Adressierungsanalyse
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Sichtweisen auf Migration und Zugehörigkeit in Deutschland. Eine Comicanalyse der Graphic Novel Madgermanes (Sylvia Kesper-Biermann, Mira Grünwald)
Der Beitrag untersucht die Darstellung von Migration in Comics im Kontext des deutschen Integrationsdiskurses. Der Fokus liegt auf der Analyse der Graphic Novel Madgermanes von Birgit Weyhe, die sich mit den Erfahrungen mosambikanischer Vertragsarbeiter:innen in der DDR auseinandersetzt. Mithilfe von Ansätzen der Repräsentationskritik und der Subjektivierungstheorie wird gezeigt, inwiefern Comics wertschätzende Darstellungen von Migration ermöglichen und so dazu beitragen können, hegemoniale Integrationsnarrative zu unterwandern und differenziertere Sichtweisen auf Migration und Zugehörigkeit zu fördern. Abschließend wird ein Ausblick darauf gegeben, wie Comics in Bildungskontexten genutzt werden können, um die Sprachförderung von Zugewanderten zu unterstützen und zugleich eine kritischere Auseinandersetzung mit den Integrationspraktiken zu fördern. Schlüsselwörter: Comics, Migration, Integration in Deutschland, Sprachförderung, Repräsentationskritik, Integrationsdiskurs
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Professionelles Handeln in Integrationskursen? Teilnehmer:innenerfahrungen zwischen Macht und Willkür (Nora Friederike Hoffmann)
Die in diesem Beitrag vorgenommenen empirischen Analysen machen Integrationskurse als Räume erkennbar, in denen Zugehörigkeitsordnungen abgebildet, prozessiert und reproduziert werden. Dies geschieht – so zeigen die dokumentarischen Interpretationen von Interviews mit Teilnehmer:innen an Integrationskursen – insbesondere vor dem Hintergrund von Identitätsnormen, mit denen die Teilnehmer:innen sich in der Interaktion mit den Lehrpersonen im Kurs konfrontiert sehen. Auf diesem Wege stellen sich organisationale und gesellschaftliche Machtbeziehungen her, die nicht über unmittelbare Disziplinierung funktionieren, sondern ihren Ausdruck darin finden, dass sie Individuen spezifischen Wissensordnungen unterwerfen. Im Beitrag wird dafür plädiert, die Erfahrungen der Klient:innen in der Auseinandersetzung um ein professionelles Handeln stärker zu fokussieren, da es auch deren Perspektiven sind, die Herrschaftsstrukturen sichtbar machen. Schlagwörter: Integrationskurs, soziale Ungleichheiten, Migration, Professionalität, Dokumentarische Methode
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
Zeitschrift für erziehungswissenschaftliche Migrationsforschung (ZeM)
1+2-2024: Method(ologi)en erziehungswissenschaftlicher Migrationsforschung / Jahrestagung „Transformation(en) im Fokus der SIIVE“
Donja Amirpur / Ulrike Hormel / Claudia Machold / Patricia Stošić: Editorial zur Doppelausgabe
Themenschwerpunkt 1: Method(ologi)en erziehungswissenschaftlicher Migrationsforschung. Zugänge, Debatten und Forschungspraxis
Gastbeitrag
Karolina Barglowski / Lisa Bonfert / Paula Wallmeyer: Den Feldzugang reflexiv gestalten: Care-Ethik in der qualitativen (Migrations‐)Forschung
Beiträge im Themenschwerpunkt
Cristina Diz Muñoz: Sichtbarkeitsregime im Kontext schulischer Segregation. Forschungsmethodologische Reflexionen am Beispiel einer videografischen Studie
Jonas Manuel Steiger: Erfassung und Rekonstruktion schüler:innenbezogener (impliziter) Kognitionen von Lehrpersonen mittels Repertory Grid Technik (im Open Access verfügbar)
Themenschwerpunkt 2: Jahrestagung „Transformation(en) im Fokus der SIIVE. Transformationsprozesse erforschen, reflektieren, begleiten“ am 09./10.03.2023 an der Freien Universität Berlin
Gastbeitrag
Waltraud Meints-Stender: Solidarität und Transformation in der Migrationsgesellschaft
Beiträge im Themenschwerpunkt
Ellen Kollender / Dorothee Schwendowius: Aktuelle Fluchtmigrationen als Anlass für diskriminierungskritischen schulischen Wandel? Empirische Analysen und Reflexion von Transformationserwartungen (im Open Access verfügbar)
Aysun Doğmuş / Anja Steinbach: Krisenkonstellationen schulischer Transformation – Verunmöglichungen des Sprechens über Rassismus im Spannungsfeld institutionalisierter Routinen und rassismuskritischer Professionalisierung
Janne Braband: Religiöse Vielfalt als Herausforderung für die Schule – Schule als Herausforderung für ‚religiös Andere‘? Erfahrungen und religionspädagogische Überlegungen nicht-christlicher Religionslehrkräfte im Religionsunterricht für alle in Hamburg
Themenungebundene Beiträge
Bettina Fritzsche / Melanie Kuhn / Georg Rißler: Zwischen förderbedürftiger Adressat:innenschaft und politischer Akteur:innenschaft. Adressierungsweisen migrantisierter Eltern in Dokumenten zur schulischen Gremienarbeit
Sylvia Kesper-Biermann / Mira Grünwald: Sichtweisen auf Migration und Zugehörigkeit in Deutschland. Eine Comicanalyse der Graphic Novel Madgermanes
Nora Friederike Hoffmann: Professionelles Handeln in Integrationskursen? Teilnehmer:innenerfahrungen zwischen Macht und Willkür
Rezensionen
Magnus Frank: Stender, Wolfram (2023): Rassismuskritik. Eine Einführung. Reihe „Soziale Arbeit in der Gesellschaft“. Stuttgart: W. Kohlhammer
Carlotta Voß / Markus Rieger-Ladich: Akbaba, Yalız/Heinemann, Alisha M.B. (Hrsg.) (2023): Erziehungswissenschaften dekolonisieren. Theoretische Debatten und praxisorientierte Impulse. Weinheim-Basel: Beltz Juventa
Vanessa Ohm: Doğmuş, Aysun (2022): Professionalisierung in Migrationsverhältnissen – Eine rassismuskritische Perspektive auf das Referendariat angehender Lehrer*innen. Wiesbaden: Springer VS
Katharina Schitow: Jording, Judith (2022): Flucht, Migration und kommunale Schulsysteme. Differenzierungspraxen und Partizipationsbedingungen in der Grundschule. Bielefeld: transcript Verlag
Florian Weitkämper: Machold, Claudia/Wienand, Carmen (2021): Die Herstellung von Differenz in der Grundschule. Eine Langzeitethnographie. Weinheim: Beltz Juventa
Tagungsberichte
Carmen Yong-Ae Wienand / Marius Mader: Order(s) of Difference in Childhood and Education. International Conference. 19.-21.09.2023, Goethe University Frankfurt/Main
Jocelyn Jasmin Dechêne / Laura Meyer-Stolte: Late Summer School “Methodologie rassismuskritischer Forschung”. 07.-09.12.2023, Universität Bielefeld
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zem.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZeM-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 2701-2476 |
| eISSN | 2701-2484 |
| Jahrgang | 3. Jahrgang 2024 |
| Ausgabe | 1+2-2024 |
| Erscheinungsdatum | 16.01.2025 |
| Umfang | 204 Seiten |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Zusatzmaterial
Zusatzmaterial
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterAdressierungsanalyse, antimuslimischer Rassismus, Care-Ethik, Comics, Differenzkategorie Religion, Diskriminierung, dokumentarische Methode, Dokumentenanalyse, Feldzugang, Flucht, Gatekeeper:innen, Gleichheit und Differenz, hegemoniale Blickfelder, institutioneller Wandel, Integration in Deutschland, Integrationsdiskurs, Integrationskurs, interreligiös-dialogisches Lernen, Januar 2025, Krise, Kritische Migrationsforschung, Migrantenorganisationen, migrantisierte Eltern, Migration, Migrationsgesellschaft, othering, Othering-Prozesse in Schule und Unterricht, Partizipation, Positionalität, Professionalisierung, Professionalität, Rassismuskritik, Reifizierung, Religionsunterricht für alle (RUfa), religiöse Vielfalt, Religiöses Othering, Repertory Grid Technik, Repräsentationskritik, Schulentwicklung, Schulgesetze, schulische Gremienarbeit, schulische Separationspraktiken, Schüler:innen mit Migrationshintergrund, schüler:innenbezogene Kognitionen, sensus communis materialis, Sichtbarkeitsordnungen, Solidarität, soziale Ungleichheiten, Sprachförderung, Subjektivierungsanalyse, Transformation, Ukraine, Ungleichheit, Verbundenheit, Visuelle Ethnografie
Abstracts
Abstracts
Den Feldzugang reflexiv gestalten: Care-Ethik in der qualitativen (Migrations‐)Forschung (Karolina Barglowski, Lisa Bonfert, Paula Wallmeyer)
Dieser Artikel beleuchtet ethische Herausforderungen beim Zugang zu Forschungsfeldern in der Migrationsforschung und in der Interaktion mit den Teilnehmenden anhand eines empirischen Forschungsprojekts. Vor dem Hintergrund einer reflexiven Migrationsforschung diskutieren und illustrieren wir methodologische Herausforderungen und Möglichkeiten zur Etablierung ethischer Forschungspraktiken am Beispiel des Projekts Migrantenorganisationen und die Koproduktion sozialer Sicherung (MIKOSS). Ausgehend von einer Care-Ethik argumentieren wir für Forschungsansätze, die das Wohlergehen der Teilnehmenden und der Forschenden in den Mittelpunkt stellen. Unsere Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit einer reflexiven Positionalität, die Machtasymmetrien adressiert und den Respekt für die Erfahrungen von Menschen, die als Migrant:innen konstruiert werden, stärkt. Abschließend diskutieren wir, wie eine Care-Ethik eine kritische Analyse von Machtverhältnissen unterstützen und Reifizierungen in der Migrationsforschung abbauen kann. Schlüsselwörter: Care-Ethik, Kritische Migrationsforschung, Feldzugang, Positionalität, Migrantenorganisationen, Othering, Gatekeeper:innen
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Sichtbarkeitsregime im Kontext schulischer Segregation. Forschungsmethodologische Reflexionen am Beispiel einer videografischen Studie (Cristina Diz Muñoz)
Der Beitrag untersucht Sichtbarkeitsregime aus einer visuell-ethnografischen und subjektivierungsanalytischen Perspektive am Beispiel einer videografischen Forschungsstudie zu schulischen Segregationspraktiken. Im Anschluss an Judith Butlers Deutung des Intelligibel-Werdens als das Ergebnis einer bestimmten Sichtbarmachung (vgl. Butler 2020, 1997a, 1997b) fragt er nach Formen der Erkennbarkeit, die mit Anerkennungsprozessen zusammenhängen und reflektiert, wie Machtverhältnisse Möglichkeiten des Sichtbar-Werdens bedingen. Auf der Basis der empirischen Analysemigrantisierter Subjektpositionen diskutiert er sodann das Spannungsverhältnis zwischen Forschungsmethode und Forschungsgegenstand, indem er anhand postkolonial inspirierter Ansätze methodologische Herausforderungen im Kontext einer kritischen videobasierten Migrationsforschung aufgreift. Abschließend lässt sich Videografie als Methodologie des (An‐)Blickens und des Zeigens einerseits machttheoretisch befragen und andererseits erziehungswissenschaftlich reflektieren. Schlüsselwörter: Schulische Separationspraktiken, Sichtbarkeitsordnungen, hegemoniale Blickfelder, Othering-Prozesse in Schule und Unterricht, Visuelle Ethnografie, Subjektivierungsanalyse
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Erfassung und Rekonstruktion schüler:innenbezogener (impliziter) Kognitionen von Lehrpersonen mittels Repertory Grid Technik (Jonas Manuel Steiger)
Schüler:innenbezogene Kognitionen von Lehrpersonen spielen eine zentrale Rolle hinsichtlich des Lehrer:innenhandelns und können einen Einfluss auf den Bildungserfolg der Schüler:innen haben. Die Erfassung und Rekonstruktion dieser Kognitionen scheinen an keine verbindliche Methodik gebunden zu sein. Allerdings gilt es – insbesondere im Kontext migrationsbezogener Schüler:innenvielfalt – die methodologischen Fragen nach der Reifizierung, nach möglichen Antwortverzerrungen aufgrund der sozialen Erwünschtheit, aber auch nach der Eignung der Methode zur Untersuchung impliziter Kognitionen zu berücksichtigen. Dieser Beitrag stellt vor diesem Hintergrund eine dafür als geeignet erachtete Anwendungsform der Repertory Grid Technik exemplarisch vor. Schlüsselwörter: Repertory Grid Technik, schüler:innenbezogene Kognitionen, Reifizierung, Schüler:innen mit Migrationshintergrund
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Solidarität und Transformation in der Migrationsgesellschaft (Waltraud Meints-Stender)
Der Beitrag beginnt mit Reflexionen zu Migration und dem Begriff der Migrationsgesellschaft, um dann die Solidaritätsbegriffe von Rahel Jaeggi und Hannah Arendt als Prozesskategorie in den Fokus zu nehmen. Im Zentrum des Beitrages steht dabei die Frage, was diese Solidaritätsbegriffe kennzeichnet und welche Bedeutung das Verhältnis von Gleichheit und Differenz auf die Pluralität der Perspektiven und die Wirklichkeit der Welt hat, um abschließend diese Solidaritätsbegriffe mit einer Praxis des sensus communis materialis zu verknüpfen, der gesellschaftspolitische Erfahrungen zugänglich macht und emanzipatorische Transformationsprozesse ermöglicht. Schlüsselwörter: Migrationsgesellschaft, Solidarität, Transformation, Verbundenheit, Gleichheit und Differenz, sensus communis materialis
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Aktuelle Fluchtmigrationen als Anlass für diskriminierungskritischen schulischen Wandel? Empirische Analysen und Reflexion von Transformationserwartungen (Ellen Kollender, Dorothee Schwendowius)
Angesichts der Fluchtbewegungen der letzten Jahre, wie aus Syrien und der Ukraine, eröffnen sich Fragen nach Kontinuitäten sowie (kollektiven) Lern- und Veränderungsprozessen in Schulen hinsichtlich der Begleitung transnationaler Bildungswege. Der Beitrag geht diesen Fragen basierend auf Interviewanalysen aus einem qualitativ-explorativen Forschungsprojekt nach. Vor dem Hintergrund der Reflexion eigener Transformationserwartungen, die durch die Perspektive diskriminierungskritischer Schulentwicklung angeregt sind, werden Praktiken der Begleitung geflüchteter Schüler:innen rekonstruiert und auf ihre Bedeutung für eine diskriminierungskritische schulische Transformation befragt. Es wird gezeigt, dass institutionelle Spielräume in einigen Schulen zwar für kritische Reflexionen und Praktiken genutzt werden, um (potenziellen) Ausschlüssen im Kontext von Flucht entgegenzuwirken. Diese Interventionen deuten jedoch weniger auf eine Transformation im Sinne einer umfassenden diskriminierungskritischen Veränderung von Schule, denn auf ein Navigieren an den Rändern des institutionell Geregelten, das sich als ambivalent erweist. Schlüsselwörter: Transformation, Schulentwicklung, Flucht, Ukraine, Diskriminierung, institutioneller Wandel
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Krisenkonstellationen schulischer Transformation – Verunmöglichungen des Sprechens über Rassismus im Spannungsfeld institutionalisierter Routinen und rassismuskritischer Professionalisierung (Aysun Doğmuş, Anja Steinbach)
Mit dem Beitrag rücken wir das Spannungsfeld rassismuskritischer Professionalisierung in den Mittelpunkt, das sich in der Auseinandersetzung von Lehrer:innen mit institutionalisierten Routinen an Schulen während ihrer Teilnahme an einer Fortbildung entfalten kann. Anhand empirischer Analysen aus zwei qualitativ-rekonstruktiven Studien werden Verunmöglichungen des Sprechens über Rassismus nachgezeichnet. Dieses Spannungsfeld der Verunmöglichungen diskutieren wir als Verweis auf eine doppelte Krise, da die Krise das Deuten und Handeln der Lehrer:innen und institutionalisierte Routinen, somit auch die symbolische Ordnung der Schule, berührt. Es werden exemplarisch folgende drei Krisenkonstellationen skizziert: Die (läutenden) Alarmglocken, die Außendarstellung des (schulischen) Selbst und der Rassist im (selben) Boot. Auf dieser Grundlage wird das Potenzial der Krisenkonstellationen für schulische Transformation im Blickwinkel umkämpfter Transition ausgelotet und die empirisch-analytische Konzeptualisierung der Wechselseitigkeit von rassismuskritischer Professionalisierung und Schulentwicklung mit Impulsen für die Diskussion um Bildungserfordernisse der Migrationsgesellschaft geschärft. Schlüsselwörter: Rassismuskritik, Professionalisierung, Schulentwicklung, Krise, Transformation
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Religiöse Vielfalt als Herausforderung für die Schule – Schule als Herausforderung für ‚religiös Andere‘? Erfahrungen und religionspädagogische Überlegungen nicht-christlicher Religionslehrkräfte im Religionsunterricht für alle in Hamburg (Janne Braband)
Der Artikel thematisiert den Umgang mit Religion und religiöser Vielfalt im schulischen Kontext als Transformationsanforderung, die nicht zuletzt auch den Religionsunterricht betrifft. Während dort versucht wird, mit interreligiös-dialogischem Lernen auf die wachsende Heterogenität einzugehen, zeigen Studien aus einer macht- und differenzanalytischen Perspektive, wie im schulischen Kontext (zugeschriebene) Religionszugehörigkeit neben Merkmalen wie Sprache, Hautfarbe, Herkunft als wirkmächtige Differenzkategorie (re)konstruiert wird. Der Beitrag zeigt vor diesem Hintergrund, wie auch nichtchristliche Religionslehrkräfte Positionierungen als ‚religiös Andere‘ erleben, und beleuchtet ihre religionspädagogischen Überlegungen zum Umgang mit religiöser Vielfalt im Hamburger Religionsunterricht für alle (RUfa). In einer exemplarischen und explorativen Herangehensweise werden dazu Ergebnisse aus drei Expert:inneninterviews mit Religionslehrkräften vorgestellt, die u. a. Hinweise darauf geben, wie religiöse Bezüge in der Schule jenseits von dominanten Zuschreibungs- und Ausgrenzungspraxen aufgegriffen werden können. Schlüsselwörter: Religiöse Vielfalt, Differenzkategorie Religion, Religiöses Othering, interreligiös-dialogisches Lernen, Religionsunterricht für alle (RUfa), antimuslimischer Rassismus
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Zwischen förderbedürftiger Adressat:innenschaft und politischer Akteur:innenschaft. Adressierungsweisen migrantisierter Eltern in Dokumenten zur schulischen Gremienarbeit (Bettina Fritzsche, Melanie Kuhn, Georg Rißler)
Wie Eltern im Kontext postwohlfahrtsstaatlicher neoliberaler Logiken des Forderns und Förderns in Dokumenten zur schulischen Gremienarbeit adressiert und im Dienste schulischer Interessen funktionalisiert werden, ist Erkenntnisinteresse einer adressierungstheoretisch fundierten Dokumentenanalyse von Schulgesetzen und ministerialen Informationsbroschüren zur schulischen Elternvertretungsarbeit. In einer bundeslandvergleichenden Optik lassen sich ungleichheitsrelevante Subjektivierungsweisen migrantisierter Eltern rekonstruieren, die sich zwischen einer Adressierung als passive förderbedürftige Objekte von Elternbeiratsarbeit und einer Autorisierung als eigenständige schulpolitische Akteur:innen aufspannen. Schlüsselwörter: Schulische Gremienarbeit, migrantisierte Eltern, Ungleichheit, Schulgesetze, Partizipation, Dokumentenanalyse, Adressierungsanalyse
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Sichtweisen auf Migration und Zugehörigkeit in Deutschland. Eine Comicanalyse der Graphic Novel Madgermanes (Sylvia Kesper-Biermann, Mira Grünwald)
Der Beitrag untersucht die Darstellung von Migration in Comics im Kontext des deutschen Integrationsdiskurses. Der Fokus liegt auf der Analyse der Graphic Novel Madgermanes von Birgit Weyhe, die sich mit den Erfahrungen mosambikanischer Vertragsarbeiter:innen in der DDR auseinandersetzt. Mithilfe von Ansätzen der Repräsentationskritik und der Subjektivierungstheorie wird gezeigt, inwiefern Comics wertschätzende Darstellungen von Migration ermöglichen und so dazu beitragen können, hegemoniale Integrationsnarrative zu unterwandern und differenziertere Sichtweisen auf Migration und Zugehörigkeit zu fördern. Abschließend wird ein Ausblick darauf gegeben, wie Comics in Bildungskontexten genutzt werden können, um die Sprachförderung von Zugewanderten zu unterstützen und zugleich eine kritischere Auseinandersetzung mit den Integrationspraktiken zu fördern. Schlüsselwörter: Comics, Migration, Integration in Deutschland, Sprachförderung, Repräsentationskritik, Integrationsdiskurs
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Professionelles Handeln in Integrationskursen? Teilnehmer:innenerfahrungen zwischen Macht und Willkür (Nora Friederike Hoffmann)
Die in diesem Beitrag vorgenommenen empirischen Analysen machen Integrationskurse als Räume erkennbar, in denen Zugehörigkeitsordnungen abgebildet, prozessiert und reproduziert werden. Dies geschieht – so zeigen die dokumentarischen Interpretationen von Interviews mit Teilnehmer:innen an Integrationskursen – insbesondere vor dem Hintergrund von Identitätsnormen, mit denen die Teilnehmer:innen sich in der Interaktion mit den Lehrpersonen im Kurs konfrontiert sehen. Auf diesem Wege stellen sich organisationale und gesellschaftliche Machtbeziehungen her, die nicht über unmittelbare Disziplinierung funktionieren, sondern ihren Ausdruck darin finden, dass sie Individuen spezifischen Wissensordnungen unterwerfen. Im Beitrag wird dafür plädiert, die Erfahrungen der Klient:innen in der Auseinandersetzung um ein professionelles Handeln stärker zu fokussieren, da es auch deren Perspektiven sind, die Herrschaftsstrukturen sichtbar machen. Schlagwörter: Integrationskurs, soziale Ungleichheiten, Migration, Professionalität, Dokumentarische Methode
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Verlag Barbara Budrich
- +49 (0)2171.79491-50
- info@budrich.de
-
Stauffenbergstr. 7
51379 Leverkusen
Deutschland


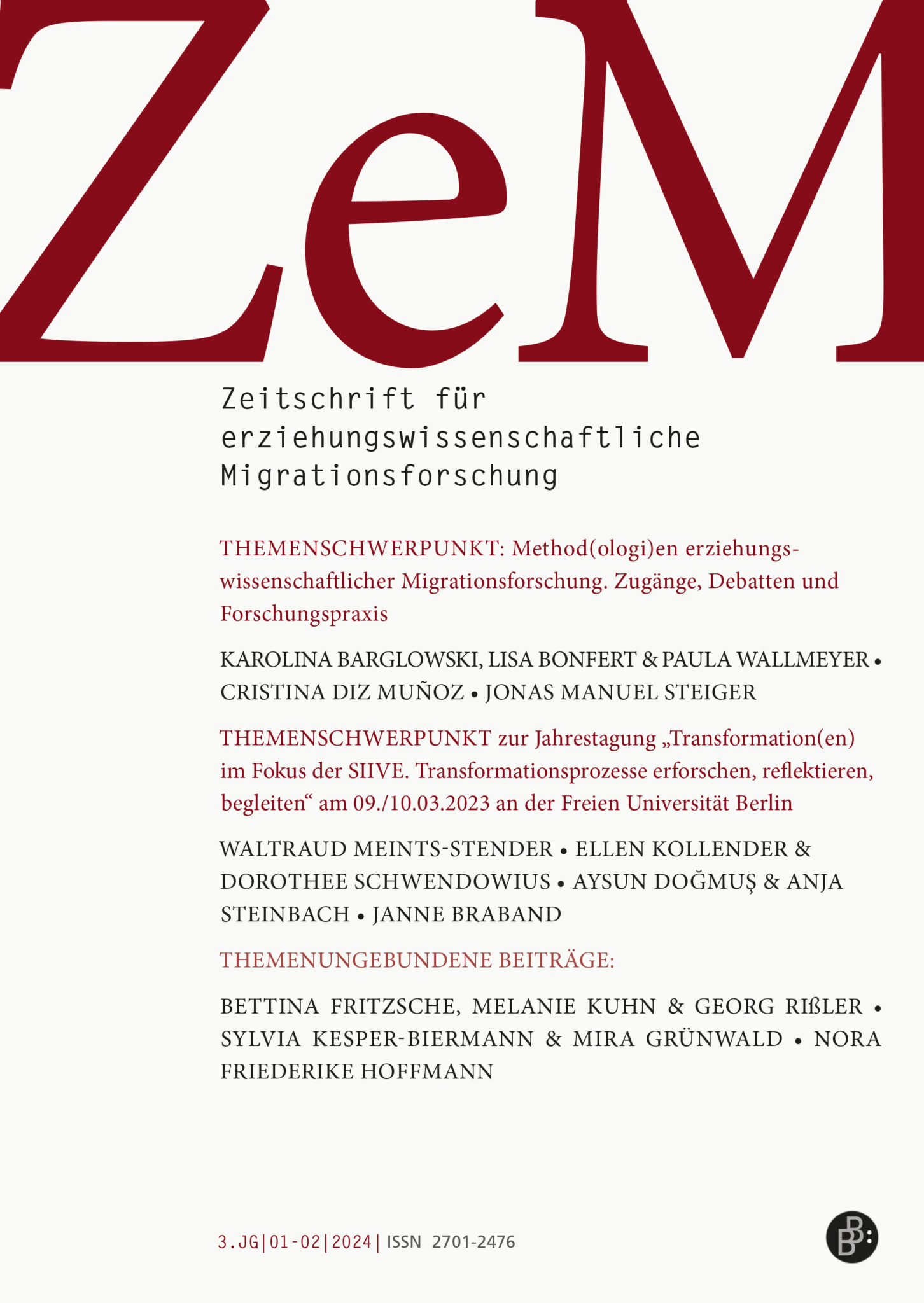



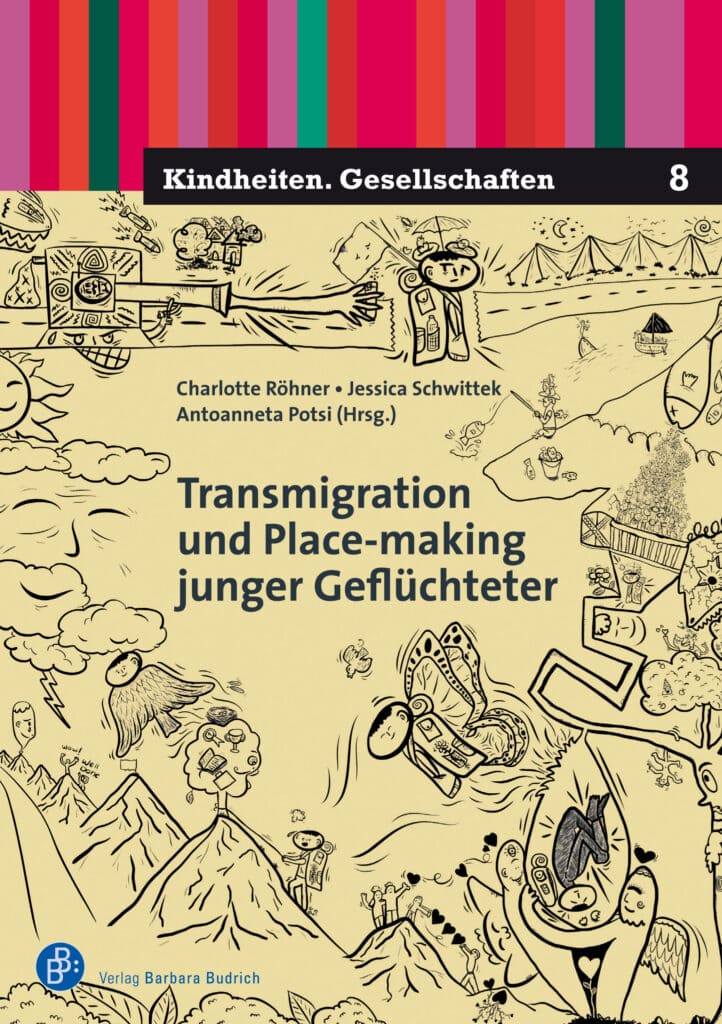
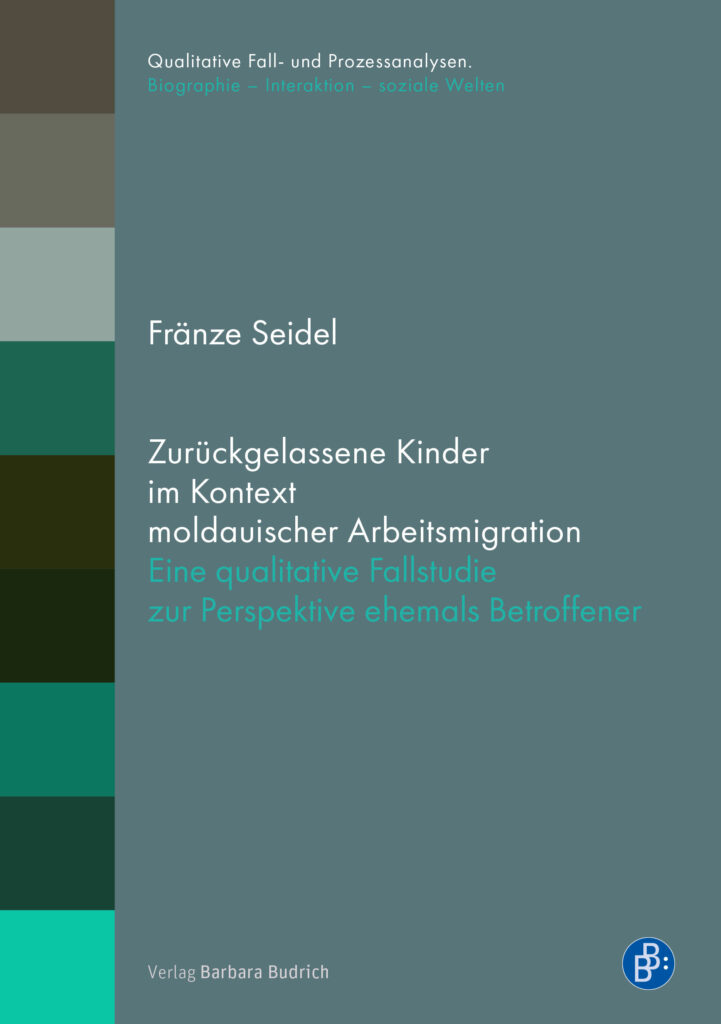
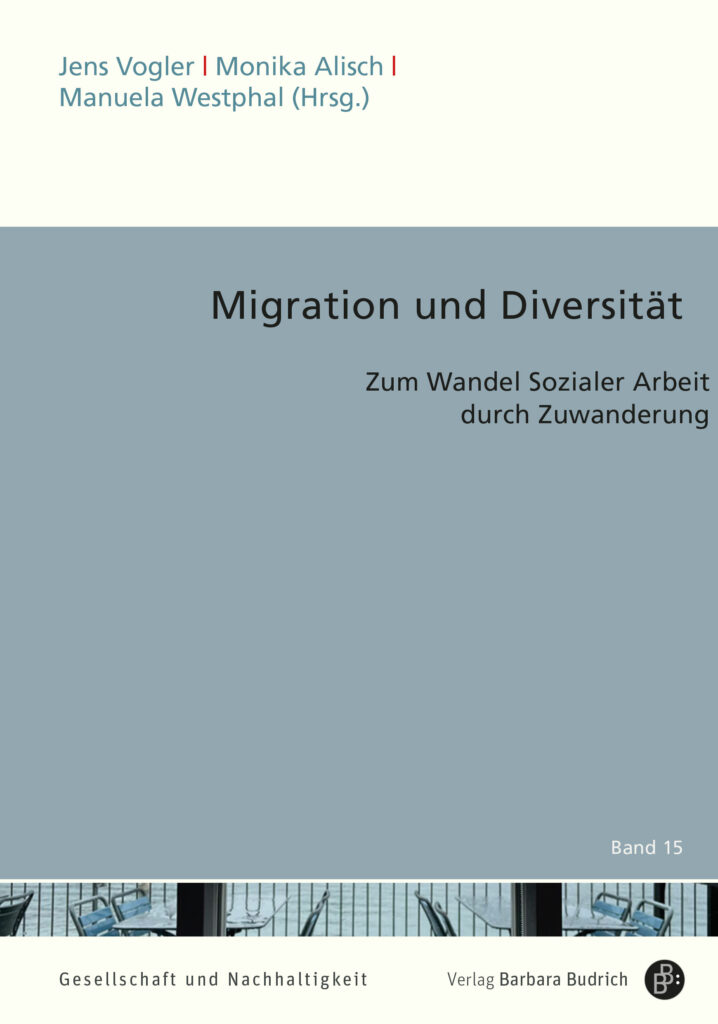

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.