Informationen zur Zeitschrift
Startseite » Programm » BIOS 2-2016 | Biographie und Geschichte in der Bildungsforschung
BIOS 2-2016 | Biographie und Geschichte in der Bildungsforschung
Erscheinungsdatum : 10.08.2018
0,00 € - 34,00 €
Inhalt
BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen
2-2016: Biographie und Geschichte in der Bildungsforschung
hrsg. von: Ruprecht Mattig, Ingrid Miethe & Ulrike Mietzner
Ruprecht Mattig / Ingrid Miethe / Ulrike Mietzner: Biographie und Geschichte in der Bildungsforschung. Einleitung
Susanne Spieker: John Lockes gentry education im Hinblick auf sein Engagement für die Kolonisierung Nordamerikas
Miriam Mathias: Zwischen einem gescheiterten und einem vollendeten Lebensentwurf. Über die biographische (Re-)Konstruktion des Lebens der Fürstin Louise von Anhalt-Dessau
Carola Groppe: Die preußischen Reformer. Konzept und Fragestellungen einer kollektivbiographischen Analyse
Andreas Hoffmann-Ocon / Norbert Grube: „Lehrer auf Abwegen“. Bildungshistorische Annäherungen an ‚gebrochene‘ und ‚eigensinnige‘ Berufsbiographien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Bettina Dausien / Gerhard Kluchert: „Mein Bildungsgang“ – Biographische Muster der Selbstkonstruktion im historischen Vergleich. Beispiele und Argumente für eine historisch-empirische Forschungsperspektive
Elke Kleinau / Rafaela Schmid: „Ich bin nicht ehemaliges Besatzungskind, sondern ich bin es immer noch“. Brüche und Inkonsistenzen in Erzählungen von ‚professionellen‘ Zeitzeug_innen
Ulrich Leitner: Ego-Dokumente als Quellen historischer Bildungsforschung. Zur Rekonstruktion von Bildungsbiographien ehemaliger weiblicher Heimkinder der Fürsorgeregion Tirol und Vorarlberg
Hans-Rüdiger Müller: Zur historischen Rekonstruktion von Erziehungspraktiken in Elternbiographien
Dorle Klika: Autobiographien als Kinder ihrer Zeit
Morvarid Dehnavi: Zur Verbindung von Biographie- und Kontextanalyse in der zeithistorischen Bildungsforschung
Ingrid Miethe: Biographieforschung und Ego-Dokumente. Ein Analysevorschlag zur Fallrekonstruktion
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): bios.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den BIOS-Alert anmelden.
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 0933-5315 |
| eISSN | 2196-243X |
| Jahrgang | 29. Jahrgang 2016 |
| Ausgabe | 2 |
| Erscheinungsdatum | 10.08.2018 |
| Umfang | 156 |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Autor*innen
SchlagwörterAutobiographie, Berufsbiographien, Besatzungszeit, Bildung, Bildungsbiographie, Bildungsforschung, Biographie, Bundesrepublik Deutschland, Elternbiographie, Erziehung, Fürstin Louise von Anhalt-Dessau, Geschichte, Heimkinder, John Locke, Kolonisierung, Nachkriegszeit, Nordamerika, Preußen, Reformen, Selbstkonstruktion, Tirol, Vorarlberg, Österreich
Abstracts
John Lockes gentry education im Hinblick auf sein Engagement für die Kolonisierung Nordamerikas (Susanne Spieker)
In diesem Artikel wird die Verflechtung von Biographie und Werk des Engländers John Locke (1632-1704) in den Blick genommen. Erschlossen wird die Bedeutung seines Engagements in der europäischen Expansion, vor allem für die Siedlungskolonisation in Nordamerika und für sein Nachdenken über die Erziehung der gentry. Der Bezug auf seine hinterlassenen Korrespondenzen ermöglicht es, sein soziales Netzwerk zu rekonstruieren und die Zeiträume der zeitgleichen Auseinandersetzung mit Fragen des menschlichen Verstands, des Rechts der Engländer auf die Kolonisierung Amerikas und der Erziehung der zukünftigen Generation aufzuzeigen. Hinweise auf die Bedeutung des kolonialen Kontextes finden sich in allen seinen Hauptschriften, am besten sind sie für seine Two Treatises of Government (1689) erforscht. Bezüge auf die indigene Bevölkerung der Amerikas finden sich auch in seiner Erziehungsschrift. Diesen Verweisen und ihrer Bedeutung für seine Erziehung der gentry wird in diesem Artikel nachgegangen.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Zwischen einem gescheiterten und einem vollendeten Lebensentwurf. Über die biographische (Re-)Konstruktion des Lebens der Fürstin Louise von Anhalt-Dessau (Miriam Mathias)
Die Selbstzeugnisse der Fürstin Louise von Anhalt-Dessau erscheinen als lohnenswertes Material für empirische Forschung im Kontext des Beginns der Biographisierung des bürgerlichen und adeligen Lebens und dem Aufkommen emanzipatorischer Bestrebungen sowie neuer weiblicher Handlungsspielräume. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es publizierte biographische Darstellungen von Louise. In ihnen wird ein dem Stereotyp der adligen Frau entsprechendes Bild generiert, in dem die Fürstin als eine Gescheiterte charakterisiert wird, die im Schatten des gelobten aufklärerischen Wirkens des Fürsten stand und sich aus der Realität ihrer Ehe in Melancholie und Schwärmerei flüchtete. Diesem Konstrukt eines gescheiterten Lebensentwurfs wird in jüngeren Publikationen bewusst ein anderes Bild gegenübergestellt: das eines vollendeten Lebensentwurfs. In ihm werden ihre Kontakte mit Bürgerlichen, ihre Abneigung gegenüber höfischen Festen und Pflichtkontakten, aber auch ihre Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern als bewusste Umsetzung aufklärerischer Ideale interpretiert. In dem Beitrag wird deutlich, dass die bisherigen Arbeiten oftmals der Oberfläche verhaftet bleiben und entweder unreflektiert das Konstrukt der Gescheiterten fortführen oder aber gegen dieses Bild anschreiben. Die Schwäche der bisherigen Forschungsarbeiten scheint darin zu liegen, dass Louises Lebenswelt in ihren Bedeutungszusammenhängen nicht angemessen berücksichtigt wird. Für weitere Forschungsprojekte scheint daher erfolgversprechend zu sein, ein modernes Biographiekonzept, wie es von Bettina Dausien entwickelt wurde, für die Analysen historischer Selbstzeugnisse nutzbar zu machen.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die preußischen Reformer. Konzept und Fragestellungen einer kollektivbiographischen Analyse (Carola Groppe)
Der Beitrag stellt ein sozialisationshistorisches Projekt zu den preußischen Reformern vor. Im Unterschied zu den Reformen selbst sind die Reformer als Kollektiv bislang noch keiner Analyse unterzogen worden, ebenso wenig wie die Gruppe ihrer Gegner. Für das Projekt sind über 70 preußische Reformer und als Vergleichsgruppe knapp 40 Reformgegner mit ihren Lebensdaten bereits erfasst worden. Der Beitrag stellt die Zuordnungskriterien vor und entwickelt die zentrale Fragestellung der sozialisationshistorischen Kollektivbiographie: nämlich zu untersuchen, warum sich eine Reihe von Männern zu Reformen entschlossen und diese aktiv vorantrieben, andere dagegen gegen diese opponierten. Im Projekt wird deshalb nach Sozialisationserfahrungen und – instanzen gefragt; neben quantitativ-vergleichenden Auswertungen der Lebensläufe werden qualitative Analysen der Sozialisationsprozesse ausgewählter Reformer und Reformgegner und der ermittelten zentralen Sozialisationsinstanzen vorgenommen, z.B. Schulen, Universitäten oder Regierungsbehörden, aber auch Familien. Im Beitrag werden in diesem Zusammenhang Theorie, Methodik, Forschungsfragen und erste Ergebnisse und Thesen des Projekts vorgestellt.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Lehrer auf Abwegen“. Bildungshistorische Annäherungen an ‚gebrochene‘ und ‚eigensinnige‘ Berufsbiographien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Andreas Hoffmann-Ocon, Norbert Grube)
Lehrpersonen, die den Pfad einer normalen innerschulischen Karriere verliessen, werden mit ihren eigensinnigen biographischen Konfigurationen bildungsgeschichtlich wenig thematisiert. In diesem Beitrag hingegen werden zwei Fallbeispiele von ehemaligen Lehrpersonen in den Blick genommen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einem Zürcher Seminarort herkommend u.a. zu Akteuren der russischen Revolution und zu literarischen Erfolgsautoren avancierten. Wie diese im Wechselspiel mit außerschulischen Prägeorten und gesellschaftlichen Strömungen Freiheitsspielräume ausloteten, aber auch neue Zwänge zur Lebensgestaltung erfuhren, wird in einer historischen Annäherung untersucht, welche selbstreflexive und fiktionale Formen der Autobiographie aufnimmt. Die anhand von vielfältigem Quellenmaterial erschlossenen Suchbewegungen der Lehrer auf Abwegen werden in einem Zusammenhang mit der beruflichen Erstsozialisation gedeutet.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Mein Bildungsgang“ – Biographische Muster der Selbstkonstruktion im historischen Vergleich. Beispiele und Argumente für eine historisch-empirische Forschungsperspektive (Bettina Dausien, Gerhard Kluchert)
Der Beitrag behandelt die Frage, welche kulturellen Muster für die autobiographische Präsentation des eigenen Bildungsweges genutzt werden und wie diese im Zusammenhang mit historisch gesellschaftlichen Diskursen über Bildung interpretiert werden können. Dabei wird insbesondere untersucht, wie biographische Darstellungen des eigenen Bildungsweges im Rahmen von Bildungsinstitutionen hervorgebracht und eingeübt werden. Dies erfolgt zunächst aus der Perspektive der Historischen Bildungsforschung am Beispiel autobiographischer Dokumente aus den 1920/30er Jahren, anschließend aus der Perspektive der sozialwissenschaftlichen Biographieforschung anhand zeitgenössischer Materialien. Ziel ist es, systematische Überlegungen zur Konstruktion von Bildungsgeschichten anzuregen und exemplarisch zu zeigen, wie eine Verknüpfung zwischen Historischer Bildungsforschung und Biographieforschung aussehen könnte.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Ich bin nicht ehemaliges Besatzungskind, sondern ich bin es immer noch“. Brüche und Inkonsistenzen in Erzählungen von ‚professionellen‘ Zeitzeug_innen (Elke Kleinau, Rafaela Schmid)
Im Projekt „Besatzungskinder in Nachkriegsdeutschland – Bildungs- und Differenzerfahrungen“ werden biographische Interviews mit Betroffenen durchgeführt. Einige Interviewte haben mittlerweile den Status ‚professioneller‘ Zeitzeug_innen, die eine durch regelmäßige Wiederholungen eingeübte narrative Identität als ‚Besatzungskind‘ präsentieren. Diese Verfestigung narrativer Strategien lässt sich besonders deutlich bei denjenigen verfolgen, von denen – neben den im Projekt durchgeführten Interviews – noch andere autobiographische Zeugnisse vorliegen. In einer Analyse, die sich strikt an der Chronologie der vorliegenden Dokumente orientiert und den Inkonsistenzen und Brüchen in den verschiedenen biographischen Erzählungen eines Betroffenen nachgeht, wird die Genese und Verfestigung einer narrativen Identität als ‚Besatzungskind‘ herausgearbeitet.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Ego-Dokumente als Quellen historischer Bildungsforschung. Zur Rekonstruktion von Bildungsbiographien ehemaliger weiblicher Heimkinder der Fürsorgeregion Tirol und Vorarlberg (Ulrich Leitner)
Welche Möglichkeiten und Herausforderungen halten Ego-Dokumente für Historische BildungsforscherInnen bereit? Als Winfried Schulze den Begriff Ego-Dokument in den 1990er Jahren in die deutschsprachige Geschichtswissenschaft einbrachte und eine weite Definition desselben vorschlug, erntete er vielfache Kritik: Zum einen sei der Begriff des Selbstzeugnisses mit seiner Fokussierung auf explizit autobiographische Quellen dem des Ego-Dokuments vorzuziehen. Zum anderen erschwere die um unfreiwillig und zwangsweise entstandene Quellen erweiterte Definition Schulzes die historische Arbeit und führe zudem zu Fehlerwartungen bezüglich des in den Quellen anzutreffenden „Egos“. Der vorliegende Beitrag argumentiert dem gegenüber, dass das von Schulze vorgestellte Konzept des Ego-Dokuments als heuristische Linse dienen kann, um höchst unterschiedliche Quellen, in denen Spuren historischer Ichs zu erwarten sind, ordnen und näher in den Blick nehmen zu können. Dies trifft insbesondere für Untersuchungen deprivilegierter oder unter Bedingungen des Zwangs lebender Bevölkerungsgruppen zu. Anhand des Quellenbestandes zur historischen Fürsorgeerziehung der beiden österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg geht der Beitrag zunächst der Frage nach, wie und in welchen Quellensorten befürsorgte Kinder selbst sprechen, um sodann bildungsbiographisch relevante Informationen von Mädchen und jungen Frauen herauszufiltern, die Ende der 1950er und in den beginnenden 1960er Jahren in einem geschlossenen Tiroler Erziehungsheim untergebracht waren. Die in der Forschungsdiskussion rund um den Begriff des Ego-Dokuments eingemahnten methodischen Prämissen sensibilisieren im Umgang mit Quellen historischer Ichs, deren Analyse zu einer vielschichtigen Rekonstruktion von Vergangenheit beitragen kann.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Zur historischen Rekonstruktion von Erziehungspraktiken in Elternbiographien (Hans-Rüdiger Müller)
Vor dem Hintergrund einer Interviewstudie zur Familienerziehung im Generationenvergleich geht der Beitrag der Frage nach, wie anhand von biographischen Texten, die anhand von themenzentrierten Interviews generiert wurden, ein Zugang zu Erziehungspraktiken möglich ist. Während ein ethnographischer Zugang zu pädagogischen Praktiken in der Regel auf Beobachtungen und Beschreibungen beruht, um die Praxis im modus operandi zu erfassen, ist in narrativen und reflexiven Interviewäußerungen der Akteur die Erziehungspraxis nur indirekt repräsentiert. Dieses methodische Problem, auf das man unvermeidlich dann stößt, wenn die soziale Praxis (z.B. weil sie vergangen ist) nicht beobachtbar ist, verweist in gegenstandskonzeptioneller Hinsicht auf das Verhältnis von Wissen und Tun bzw. von Diskursen und Praktiken. In einem ersten Schritt wird daher versucht, das Verhältnis von Diskursanalyse und Praxistheorie zu klären und den wechselseitigen Zusammenhang beider Gegenstandsdimensionen herauszustellen. Darauf folgt ein Abschnitt zu methodischen Konsequenzen, die sich aus den gegenstandstheoretischen Erörterungen ergeben. Mit dem hier vorgestellten methodischen Ansatz wird ein Weg zur Analyse berichteter und kommentierter sozialer Praktiken vorgeschlagen, um eine Brücke zwischen praxistheoretischen Gegenstandsbestimmungen und diskurstheoretisch fundierten biographischen und historischen Analysen zu schlagen.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Autobiographien als Kinder ihrer Zeit (Dorle Klika)
Ausgehend vom gegenwärtigen Boom autobiographischen Schreibens, nimmt der Beitrag Begriffsklärungen vor (Ego-Dokumente, Autobiographie, Memoiren, Biographie) und referiert den Diskurs der Germanistik um Referenzialität, Authentizität, Fiktionalität und das Konzept ‚narrativer Wahrheit‘. Der historische Wandel autobiographischen Schreibens zur Pluralität autobiographischer Erzählstile wird am Beispiel der Autobiographien von Fanny Lewald und Christa Wolf verdeutlicht. Der Beitrag schießt mit einem Plädoyer für die Verwendung autobiographischer Texte als erziehungswissenschaftliches Quellenmaterial.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Zur Verbindung von Biographie- und Kontextanalyse in der zeithistorischen Bildungsforschung (Morvarid Dehnavi)
Der Beitrag stellt methodologische und methodische Überlegungen zur Verbindung von Biographie- und Kontextanalyse vor und diskutiert den Nutzen eines solchen Konzepts für sozialisationshistorische Fragen in der Historischen Bildungsforschung. Zunächst werden die in der Forschung sichtbaren Diskussionen um eine Verbindung der rein kultur- oder sozialgeschichtlichen Perspektive skizziert und aufgezeigt, welche Möglichkeit zur Anknüpfung an Sozialisationstheorien und zur Erweiterung des Quellen- und Methodenrepertoires dadurch eröffnet werden. Die Überlegungen zur Verbindung von Biographie- und Kontextanalyse werden anschließend am Beispiel einer abgeschlossenen Untersuchung zur politischen Sozialisation in den 1960er Jahren dargestellt. Dabei wird herausgearbeitet, inwiefern das Konzept der Dokumentarischen Methode bei der Erforschung sozialisationshistorischer Fragen und Auswertung biographischen Materials herangezogen werden kann, und für eine Erweiterung um eine Kontextanalyse plädiert. Dies wird abschließend an einem empirischen Beispiel erläutert.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Biographieforschung und Ego-Dokumente. Ein Analysevorschlag zur Fallrekonstruktion (Ingrid Miethe)
Im Beitrag wird eine Modifikation des für die Biographieforschung entwickelten Verfahrens der hermeneutischen Fallrekonstruktion nach Rosenthal vorgestellt. Durch eine solche Modifikation wird es möglich, dieses Verfahren auch für die Analyse schriftlicher Quellen auszuweiten. Damit steht ein Verfahren zur Verfügung, das es ermöglicht, Ego-Dokumente sehr spezifisch für biographische Fragestellungen auszuwerten.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen
2-2016: Biographie und Geschichte in der Bildungsforschung
hrsg. von: Ruprecht Mattig, Ingrid Miethe & Ulrike Mietzner
Ruprecht Mattig / Ingrid Miethe / Ulrike Mietzner: Biographie und Geschichte in der Bildungsforschung. Einleitung
Susanne Spieker: John Lockes gentry education im Hinblick auf sein Engagement für die Kolonisierung Nordamerikas
Miriam Mathias: Zwischen einem gescheiterten und einem vollendeten Lebensentwurf. Über die biographische (Re-)Konstruktion des Lebens der Fürstin Louise von Anhalt-Dessau
Carola Groppe: Die preußischen Reformer. Konzept und Fragestellungen einer kollektivbiographischen Analyse
Andreas Hoffmann-Ocon / Norbert Grube: „Lehrer auf Abwegen“. Bildungshistorische Annäherungen an ‚gebrochene‘ und ‚eigensinnige‘ Berufsbiographien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Bettina Dausien / Gerhard Kluchert: „Mein Bildungsgang“ – Biographische Muster der Selbstkonstruktion im historischen Vergleich. Beispiele und Argumente für eine historisch-empirische Forschungsperspektive
Elke Kleinau / Rafaela Schmid: „Ich bin nicht ehemaliges Besatzungskind, sondern ich bin es immer noch“. Brüche und Inkonsistenzen in Erzählungen von ‚professionellen‘ Zeitzeug_innen
Ulrich Leitner: Ego-Dokumente als Quellen historischer Bildungsforschung. Zur Rekonstruktion von Bildungsbiographien ehemaliger weiblicher Heimkinder der Fürsorgeregion Tirol und Vorarlberg
Hans-Rüdiger Müller: Zur historischen Rekonstruktion von Erziehungspraktiken in Elternbiographien
Dorle Klika: Autobiographien als Kinder ihrer Zeit
Morvarid Dehnavi: Zur Verbindung von Biographie- und Kontextanalyse in der zeithistorischen Bildungsforschung
Ingrid Miethe: Biographieforschung und Ego-Dokumente. Ein Analysevorschlag zur Fallrekonstruktion
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): bios.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den BIOS-Alert anmelden.
Bibliografie
Zusätzliche Information
| Verlag | |
|---|---|
| ISSN | 0933-5315 |
| eISSN | 2196-243X |
| Jahrgang | 29. Jahrgang 2016 |
| Ausgabe | 2 |
| Erscheinungsdatum | 10.08.2018 |
| Umfang | 156 |
| Sprache | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Autor*innen
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterAutobiographie, Berufsbiographien, Besatzungszeit, Bildung, Bildungsbiographie, Bildungsforschung, Biographie, Bundesrepublik Deutschland, Elternbiographie, Erziehung, Fürstin Louise von Anhalt-Dessau, Geschichte, Heimkinder, John Locke, Kolonisierung, Nachkriegszeit, Nordamerika, Preußen, Reformen, Selbstkonstruktion, Tirol, Vorarlberg, Österreich
Abstracts
Abstracts
John Lockes gentry education im Hinblick auf sein Engagement für die Kolonisierung Nordamerikas (Susanne Spieker)
In diesem Artikel wird die Verflechtung von Biographie und Werk des Engländers John Locke (1632-1704) in den Blick genommen. Erschlossen wird die Bedeutung seines Engagements in der europäischen Expansion, vor allem für die Siedlungskolonisation in Nordamerika und für sein Nachdenken über die Erziehung der gentry. Der Bezug auf seine hinterlassenen Korrespondenzen ermöglicht es, sein soziales Netzwerk zu rekonstruieren und die Zeiträume der zeitgleichen Auseinandersetzung mit Fragen des menschlichen Verstands, des Rechts der Engländer auf die Kolonisierung Amerikas und der Erziehung der zukünftigen Generation aufzuzeigen. Hinweise auf die Bedeutung des kolonialen Kontextes finden sich in allen seinen Hauptschriften, am besten sind sie für seine Two Treatises of Government (1689) erforscht. Bezüge auf die indigene Bevölkerung der Amerikas finden sich auch in seiner Erziehungsschrift. Diesen Verweisen und ihrer Bedeutung für seine Erziehung der gentry wird in diesem Artikel nachgegangen.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Zwischen einem gescheiterten und einem vollendeten Lebensentwurf. Über die biographische (Re-)Konstruktion des Lebens der Fürstin Louise von Anhalt-Dessau (Miriam Mathias)
Die Selbstzeugnisse der Fürstin Louise von Anhalt-Dessau erscheinen als lohnenswertes Material für empirische Forschung im Kontext des Beginns der Biographisierung des bürgerlichen und adeligen Lebens und dem Aufkommen emanzipatorischer Bestrebungen sowie neuer weiblicher Handlungsspielräume. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es publizierte biographische Darstellungen von Louise. In ihnen wird ein dem Stereotyp der adligen Frau entsprechendes Bild generiert, in dem die Fürstin als eine Gescheiterte charakterisiert wird, die im Schatten des gelobten aufklärerischen Wirkens des Fürsten stand und sich aus der Realität ihrer Ehe in Melancholie und Schwärmerei flüchtete. Diesem Konstrukt eines gescheiterten Lebensentwurfs wird in jüngeren Publikationen bewusst ein anderes Bild gegenübergestellt: das eines vollendeten Lebensentwurfs. In ihm werden ihre Kontakte mit Bürgerlichen, ihre Abneigung gegenüber höfischen Festen und Pflichtkontakten, aber auch ihre Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern als bewusste Umsetzung aufklärerischer Ideale interpretiert. In dem Beitrag wird deutlich, dass die bisherigen Arbeiten oftmals der Oberfläche verhaftet bleiben und entweder unreflektiert das Konstrukt der Gescheiterten fortführen oder aber gegen dieses Bild anschreiben. Die Schwäche der bisherigen Forschungsarbeiten scheint darin zu liegen, dass Louises Lebenswelt in ihren Bedeutungszusammenhängen nicht angemessen berücksichtigt wird. Für weitere Forschungsprojekte scheint daher erfolgversprechend zu sein, ein modernes Biographiekonzept, wie es von Bettina Dausien entwickelt wurde, für die Analysen historischer Selbstzeugnisse nutzbar zu machen.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Die preußischen Reformer. Konzept und Fragestellungen einer kollektivbiographischen Analyse (Carola Groppe)
Der Beitrag stellt ein sozialisationshistorisches Projekt zu den preußischen Reformern vor. Im Unterschied zu den Reformen selbst sind die Reformer als Kollektiv bislang noch keiner Analyse unterzogen worden, ebenso wenig wie die Gruppe ihrer Gegner. Für das Projekt sind über 70 preußische Reformer und als Vergleichsgruppe knapp 40 Reformgegner mit ihren Lebensdaten bereits erfasst worden. Der Beitrag stellt die Zuordnungskriterien vor und entwickelt die zentrale Fragestellung der sozialisationshistorischen Kollektivbiographie: nämlich zu untersuchen, warum sich eine Reihe von Männern zu Reformen entschlossen und diese aktiv vorantrieben, andere dagegen gegen diese opponierten. Im Projekt wird deshalb nach Sozialisationserfahrungen und – instanzen gefragt; neben quantitativ-vergleichenden Auswertungen der Lebensläufe werden qualitative Analysen der Sozialisationsprozesse ausgewählter Reformer und Reformgegner und der ermittelten zentralen Sozialisationsinstanzen vorgenommen, z.B. Schulen, Universitäten oder Regierungsbehörden, aber auch Familien. Im Beitrag werden in diesem Zusammenhang Theorie, Methodik, Forschungsfragen und erste Ergebnisse und Thesen des Projekts vorgestellt.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Lehrer auf Abwegen“. Bildungshistorische Annäherungen an ‚gebrochene‘ und ‚eigensinnige‘ Berufsbiographien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Andreas Hoffmann-Ocon, Norbert Grube)
Lehrpersonen, die den Pfad einer normalen innerschulischen Karriere verliessen, werden mit ihren eigensinnigen biographischen Konfigurationen bildungsgeschichtlich wenig thematisiert. In diesem Beitrag hingegen werden zwei Fallbeispiele von ehemaligen Lehrpersonen in den Blick genommen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von einem Zürcher Seminarort herkommend u.a. zu Akteuren der russischen Revolution und zu literarischen Erfolgsautoren avancierten. Wie diese im Wechselspiel mit außerschulischen Prägeorten und gesellschaftlichen Strömungen Freiheitsspielräume ausloteten, aber auch neue Zwänge zur Lebensgestaltung erfuhren, wird in einer historischen Annäherung untersucht, welche selbstreflexive und fiktionale Formen der Autobiographie aufnimmt. Die anhand von vielfältigem Quellenmaterial erschlossenen Suchbewegungen der Lehrer auf Abwegen werden in einem Zusammenhang mit der beruflichen Erstsozialisation gedeutet.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Mein Bildungsgang“ – Biographische Muster der Selbstkonstruktion im historischen Vergleich. Beispiele und Argumente für eine historisch-empirische Forschungsperspektive (Bettina Dausien, Gerhard Kluchert)
Der Beitrag behandelt die Frage, welche kulturellen Muster für die autobiographische Präsentation des eigenen Bildungsweges genutzt werden und wie diese im Zusammenhang mit historisch gesellschaftlichen Diskursen über Bildung interpretiert werden können. Dabei wird insbesondere untersucht, wie biographische Darstellungen des eigenen Bildungsweges im Rahmen von Bildungsinstitutionen hervorgebracht und eingeübt werden. Dies erfolgt zunächst aus der Perspektive der Historischen Bildungsforschung am Beispiel autobiographischer Dokumente aus den 1920/30er Jahren, anschließend aus der Perspektive der sozialwissenschaftlichen Biographieforschung anhand zeitgenössischer Materialien. Ziel ist es, systematische Überlegungen zur Konstruktion von Bildungsgeschichten anzuregen und exemplarisch zu zeigen, wie eine Verknüpfung zwischen Historischer Bildungsforschung und Biographieforschung aussehen könnte.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Ich bin nicht ehemaliges Besatzungskind, sondern ich bin es immer noch“. Brüche und Inkonsistenzen in Erzählungen von ‚professionellen‘ Zeitzeug_innen (Elke Kleinau, Rafaela Schmid)
Im Projekt „Besatzungskinder in Nachkriegsdeutschland – Bildungs- und Differenzerfahrungen“ werden biographische Interviews mit Betroffenen durchgeführt. Einige Interviewte haben mittlerweile den Status ‚professioneller‘ Zeitzeug_innen, die eine durch regelmäßige Wiederholungen eingeübte narrative Identität als ‚Besatzungskind‘ präsentieren. Diese Verfestigung narrativer Strategien lässt sich besonders deutlich bei denjenigen verfolgen, von denen – neben den im Projekt durchgeführten Interviews – noch andere autobiographische Zeugnisse vorliegen. In einer Analyse, die sich strikt an der Chronologie der vorliegenden Dokumente orientiert und den Inkonsistenzen und Brüchen in den verschiedenen biographischen Erzählungen eines Betroffenen nachgeht, wird die Genese und Verfestigung einer narrativen Identität als ‚Besatzungskind‘ herausgearbeitet.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Ego-Dokumente als Quellen historischer Bildungsforschung. Zur Rekonstruktion von Bildungsbiographien ehemaliger weiblicher Heimkinder der Fürsorgeregion Tirol und Vorarlberg (Ulrich Leitner)
Welche Möglichkeiten und Herausforderungen halten Ego-Dokumente für Historische BildungsforscherInnen bereit? Als Winfried Schulze den Begriff Ego-Dokument in den 1990er Jahren in die deutschsprachige Geschichtswissenschaft einbrachte und eine weite Definition desselben vorschlug, erntete er vielfache Kritik: Zum einen sei der Begriff des Selbstzeugnisses mit seiner Fokussierung auf explizit autobiographische Quellen dem des Ego-Dokuments vorzuziehen. Zum anderen erschwere die um unfreiwillig und zwangsweise entstandene Quellen erweiterte Definition Schulzes die historische Arbeit und führe zudem zu Fehlerwartungen bezüglich des in den Quellen anzutreffenden „Egos“. Der vorliegende Beitrag argumentiert dem gegenüber, dass das von Schulze vorgestellte Konzept des Ego-Dokuments als heuristische Linse dienen kann, um höchst unterschiedliche Quellen, in denen Spuren historischer Ichs zu erwarten sind, ordnen und näher in den Blick nehmen zu können. Dies trifft insbesondere für Untersuchungen deprivilegierter oder unter Bedingungen des Zwangs lebender Bevölkerungsgruppen zu. Anhand des Quellenbestandes zur historischen Fürsorgeerziehung der beiden österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg geht der Beitrag zunächst der Frage nach, wie und in welchen Quellensorten befürsorgte Kinder selbst sprechen, um sodann bildungsbiographisch relevante Informationen von Mädchen und jungen Frauen herauszufiltern, die Ende der 1950er und in den beginnenden 1960er Jahren in einem geschlossenen Tiroler Erziehungsheim untergebracht waren. Die in der Forschungsdiskussion rund um den Begriff des Ego-Dokuments eingemahnten methodischen Prämissen sensibilisieren im Umgang mit Quellen historischer Ichs, deren Analyse zu einer vielschichtigen Rekonstruktion von Vergangenheit beitragen kann.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Zur historischen Rekonstruktion von Erziehungspraktiken in Elternbiographien (Hans-Rüdiger Müller)
Vor dem Hintergrund einer Interviewstudie zur Familienerziehung im Generationenvergleich geht der Beitrag der Frage nach, wie anhand von biographischen Texten, die anhand von themenzentrierten Interviews generiert wurden, ein Zugang zu Erziehungspraktiken möglich ist. Während ein ethnographischer Zugang zu pädagogischen Praktiken in der Regel auf Beobachtungen und Beschreibungen beruht, um die Praxis im modus operandi zu erfassen, ist in narrativen und reflexiven Interviewäußerungen der Akteur die Erziehungspraxis nur indirekt repräsentiert. Dieses methodische Problem, auf das man unvermeidlich dann stößt, wenn die soziale Praxis (z.B. weil sie vergangen ist) nicht beobachtbar ist, verweist in gegenstandskonzeptioneller Hinsicht auf das Verhältnis von Wissen und Tun bzw. von Diskursen und Praktiken. In einem ersten Schritt wird daher versucht, das Verhältnis von Diskursanalyse und Praxistheorie zu klären und den wechselseitigen Zusammenhang beider Gegenstandsdimensionen herauszustellen. Darauf folgt ein Abschnitt zu methodischen Konsequenzen, die sich aus den gegenstandstheoretischen Erörterungen ergeben. Mit dem hier vorgestellten methodischen Ansatz wird ein Weg zur Analyse berichteter und kommentierter sozialer Praktiken vorgeschlagen, um eine Brücke zwischen praxistheoretischen Gegenstandsbestimmungen und diskurstheoretisch fundierten biographischen und historischen Analysen zu schlagen.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Autobiographien als Kinder ihrer Zeit (Dorle Klika)
Ausgehend vom gegenwärtigen Boom autobiographischen Schreibens, nimmt der Beitrag Begriffsklärungen vor (Ego-Dokumente, Autobiographie, Memoiren, Biographie) und referiert den Diskurs der Germanistik um Referenzialität, Authentizität, Fiktionalität und das Konzept ‚narrativer Wahrheit‘. Der historische Wandel autobiographischen Schreibens zur Pluralität autobiographischer Erzählstile wird am Beispiel der Autobiographien von Fanny Lewald und Christa Wolf verdeutlicht. Der Beitrag schießt mit einem Plädoyer für die Verwendung autobiographischer Texte als erziehungswissenschaftliches Quellenmaterial.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Zur Verbindung von Biographie- und Kontextanalyse in der zeithistorischen Bildungsforschung (Morvarid Dehnavi)
Der Beitrag stellt methodologische und methodische Überlegungen zur Verbindung von Biographie- und Kontextanalyse vor und diskutiert den Nutzen eines solchen Konzepts für sozialisationshistorische Fragen in der Historischen Bildungsforschung. Zunächst werden die in der Forschung sichtbaren Diskussionen um eine Verbindung der rein kultur- oder sozialgeschichtlichen Perspektive skizziert und aufgezeigt, welche Möglichkeit zur Anknüpfung an Sozialisationstheorien und zur Erweiterung des Quellen- und Methodenrepertoires dadurch eröffnet werden. Die Überlegungen zur Verbindung von Biographie- und Kontextanalyse werden anschließend am Beispiel einer abgeschlossenen Untersuchung zur politischen Sozialisation in den 1960er Jahren dargestellt. Dabei wird herausgearbeitet, inwiefern das Konzept der Dokumentarischen Methode bei der Erforschung sozialisationshistorischer Fragen und Auswertung biographischen Materials herangezogen werden kann, und für eine Erweiterung um eine Kontextanalyse plädiert. Dies wird abschließend an einem empirischen Beispiel erläutert.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Biographieforschung und Ego-Dokumente. Ein Analysevorschlag zur Fallrekonstruktion (Ingrid Miethe)
Im Beitrag wird eine Modifikation des für die Biographieforschung entwickelten Verfahrens der hermeneutischen Fallrekonstruktion nach Rosenthal vorgestellt. Durch eine solche Modifikation wird es möglich, dieses Verfahren auch für die Analyse schriftlicher Quellen auszuweiten. Damit steht ein Verfahren zur Verfügung, das es ermöglicht, Ego-Dokumente sehr spezifisch für biographische Fragestellungen auszuwerten.
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)




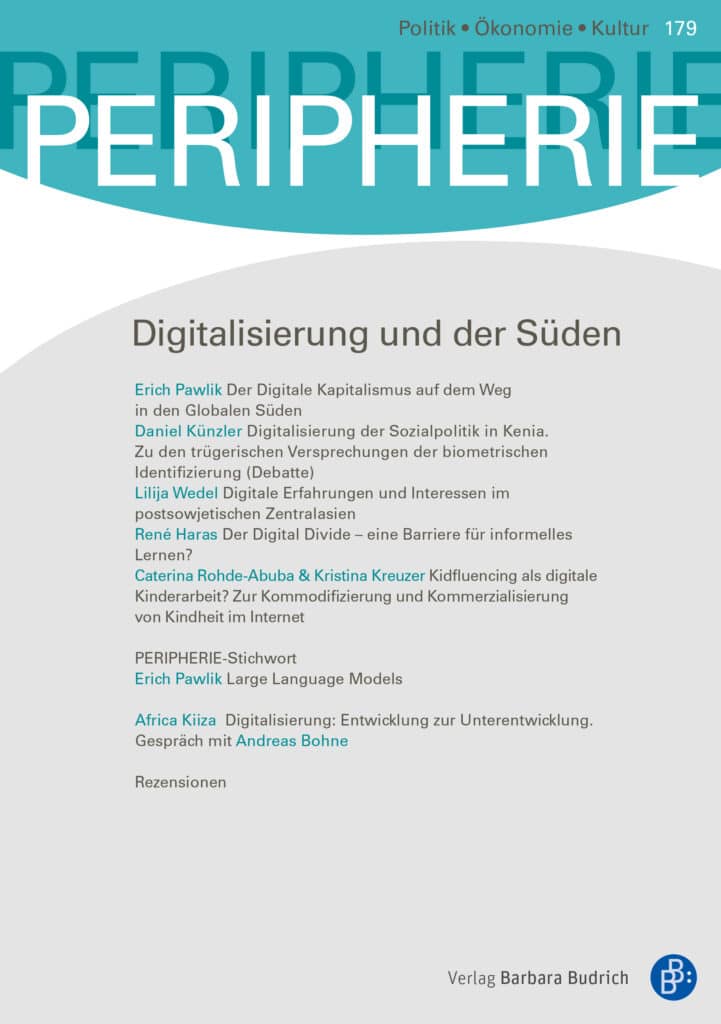
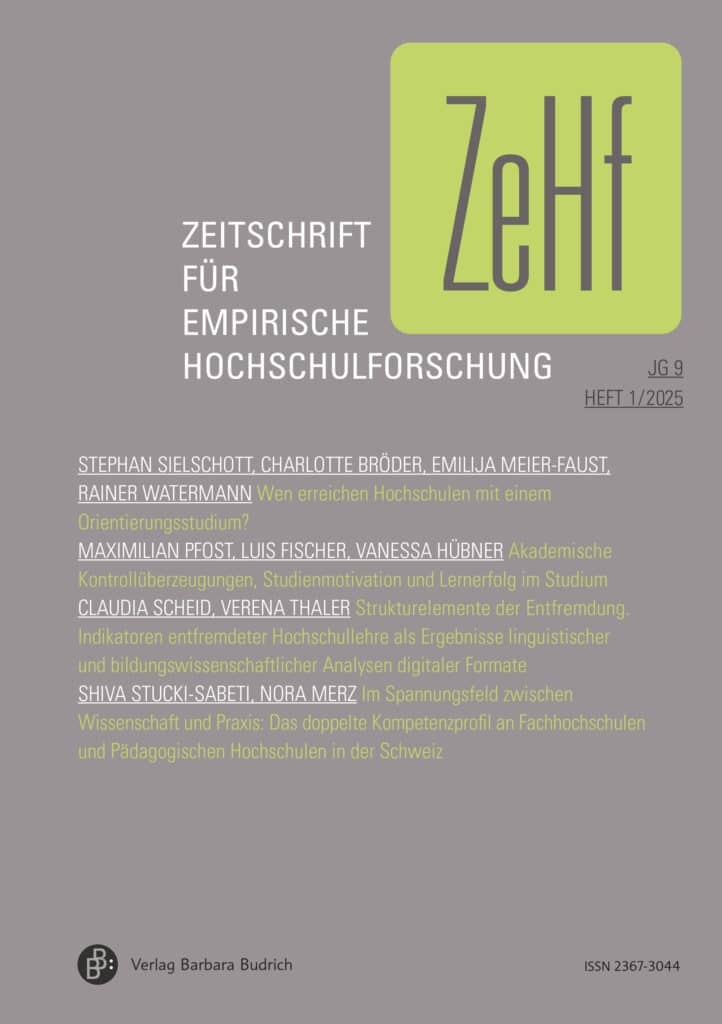
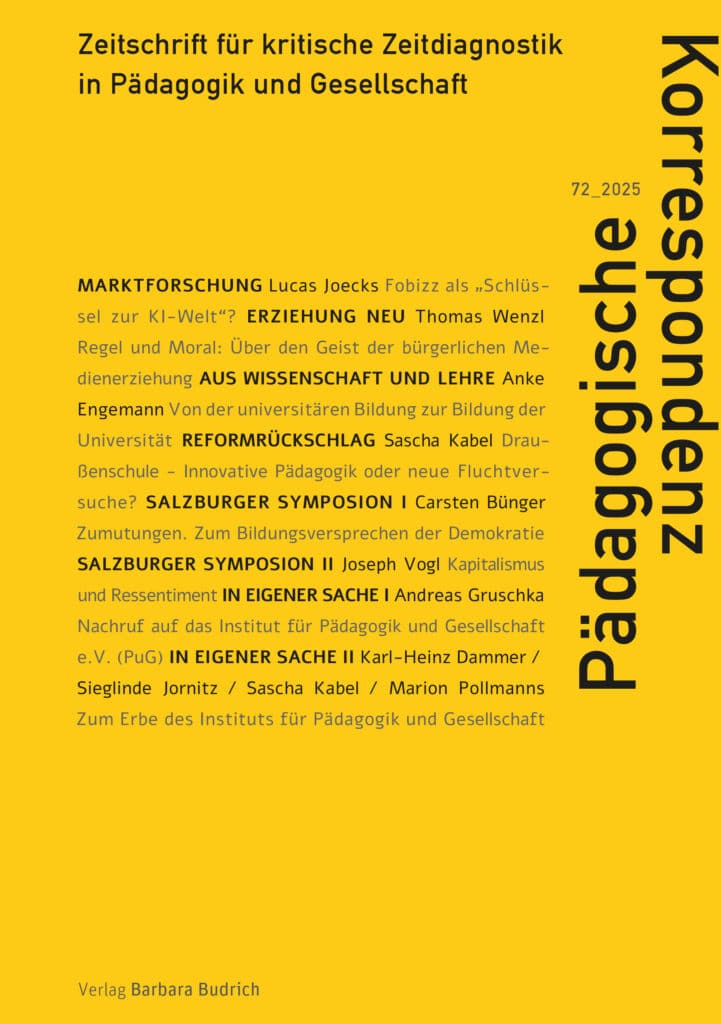
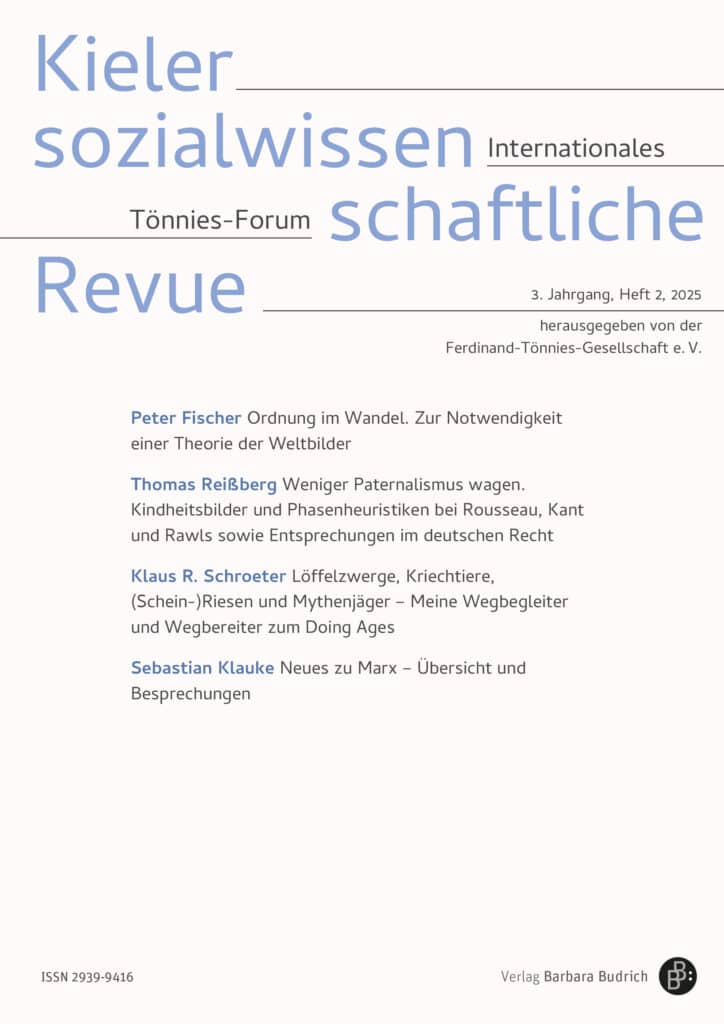
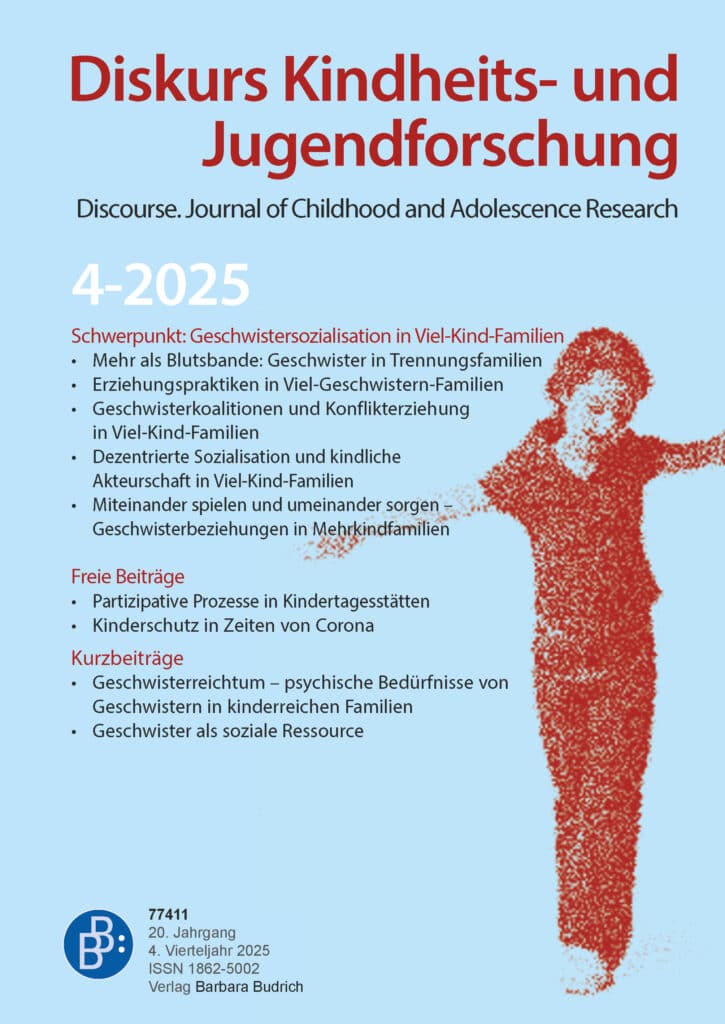

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.