BIOS 2-2021 | Freie Beiträge
Erscheinungsdatum : 14.08.2023
34,00 € incl. VAT
Content
BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen
2-2021: Freie Beiträge
Beiträge
Wolf Kaiser: Holocaust-Tagebücher junger Jüdinnen und Juden
Vera Blaser / Sonja Matter: Die Formation eines politischen Subjektes. Die Emanzipationsbewegung der Gehörlosen in der Schweiz im ausgehenden 20. Jahrhundert
Barbara Stauber: Praxeologisieren – Situieren – Relationieren. Zum methodologischen Gewinn machttheoretischer Überlegungen für eine reflexive Übergangsforschung
Klaus Kraimer: Annotationen zum Theorie- und Forschungsprogramm der Objektiven Hermeneutik Ulrich Oevermanns
Projektberichte
Marcel Mierwald: Schmelztiegel Ruhrbergbau? Die Integration türkischer „Gastarbeiter“ mit Oral-History-Interviews im Schülerlabor erforschen
Alicia Gorny: „Von der Geisterjagd“. Möglichkeiten der Sichtbarmachung und Partizipation von Aktivist:innen in der Kunstinstallation „Geister“
Literaturbesprechung
Dorothee Neumaier: Dorothee Schmitz-Köster: Unbrauchbare Väter. Über Muster-Männer, Seitenspringer und flüchtende Erzeuger im Lebensborn
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Leseproben
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): bios.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den BIOS-Alert anmelden.
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 0933-5315 |
| eISSN | 2196-243X |
| Volume | 34. Jahrgang 2021 |
| Edition | 2-2021 |
| Date of publication | 14.08.2023 |
| Scope | 148 Seiten |
| Language | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Autor*innen
SchlagwörterEmanzipationsbewegung, Gehörlose, Holocaust, Holocaust-Tagebücher, Kunstinstallation, Methodologie, objektive Hermeneutik, Oral History-Interviews, Reflexive uebergangsforschung, Ruhrbergbau, Ruhrgebiet, Schweiz, türkische Gastarbeiter, Ulrich Oevermann
Abstracts
Holocaust-Tagebücher junger Jüdinnen und Juden (Wolf Kaiser)
Der Aufsatz befasst sich mit Tagebüchern junger Menschen in vielen Ländern Europas, die von den Nationalsozialisten und ihren Helfern als Jüdinnen und Juden verfolgt und von denen viele ermordet worden sind. Er erörtert, was Tagebücher als historische Quellen mit anderen Selbstzeugnissen wie Memoiren und Zeitzeugeninterviews gemeinsam haben und worin sie sich wesentlich unterscheiden. An einigen Beispielen wird gezeigt, wie Tagebücher aufgrund der zeitlichen Nähe zwischen dem Erleben und der Niederschrift des Erlebten sowie der Offenheit des Erwartungshorizonts Einblicke in die unmittelbaren Reaktionen der Betroffenen und ihre unterschiedlichen Deutungen des Geschehens gewähren. Angesichts solcher Erkenntnismöglichkeiten, wie sie nur Tagebücher und Briefe bieten, wird der Frage nachgegangen, warum die Zahl der überlieferten Diarien regional unterschiedlich groß und insgesamt sehr viel geringer ist als die der Memoiren und Interviews, in denen Überlebende rückblickend von ihren Erfahrungen berichtet haben. Es wird untersucht, wie die Entscheidung für eine bestimmte Form des Tagebuchs von den Lebensbedingungen der Autorinnen und Autoren, aber auch von ihren Motivationen abhing. Die Vielfalt der Motivationen wird anhand von Tagebucheinträgen verdeutlicht, die das Bedürfnis zu schreiben explizit reflektieren. Abschließend wird die Besonderheit der untersuchten Tagebücher dadurch hervorgehoben, dass die Auseinandersetzung der Verfasserinnen und Verfasser mit der akuten Bedrohung ihres Lebens durch die Judenmörder beispielhaft dokumentiert wird.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Formation eines politischen Subjektes. Die Emanzipationsbewegung der Gehörlosen in der Schweiz im ausgehenden 20. Jahrhundert (Vera Blaser und Sonja Matter)
In den ausgehenden 1970er Jahren kamen in der Schweiz – wie auch in anderen Ländern – Transformationsprozesse in Gang, die zu einer Politisierung und Neupositionierung der Gehörlosengemeinschaft und in den 1980er Jahren zur Formierung der Gehörlosenemanzipationsbewegung führten. In der Folge begannen gehörlose Menschen vermehrt, sich als politische Subjekte zu positionieren, Forderungen zu formulieren sowie Diskriminierungen und paternalistische Haltung hörender Fachleute zu kritisieren. Die Vernetzung mit einer zunehmend transnational agierenden Gehörlosencommunity und die Anlehnung an Aktionsformen anderer Emanzipationsbewegungen spielten dabei eine wichtige Rolle. Der Artikel nimmt diese Prozesse der Subjektivierung (Rancière) gehörloser Menschen als Teil einer emanzipatorischen Politik in den Blick. Wir fokussieren dabei drei maßgebliche Zielsetzungen der Bewegung, die in den 1980er Jahren entwickelt wurden und noch heute für die Politik der Gehörlosengemeinschaft zentral sind: der Zugang zur modernen Kommunikations- und Wissensgesellschaft, die offizielle Anerkennung der Gebärdensprachen und das „Empowerment“, verstanden als individueller und kollektiver Prozess, der Selbstbewusstsein und die Fähigkeit politisch zu agieren fördert. Als Quellenkorpus fungieren in erster Linie zehn leitfadengestützte-themenzentrierte Interviews mit einflussreichen gehörlosen Aktivist*innen aus den 1980er Jahren. In einem einführenden Teil diskutieren wir die methodischen Herausforderungen und notwendigen Voraussetzungen für eine gelingende Durchführung von Interviews mit Hilfe von Gebärdensprachdolmetscher*innen.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Praxeologisieren – Situieren – Relationieren. Zum methodologischen Gewinn machttheoretischer Überlegungen für eine reflexive Übergangsforschung (Barbara Stauber)
Die Frage, was durch eine empirische Forschungspraxis überhaupt erschlossen werden kann, ist abhängig von den jeweiligen theoretischen Perspektiven, in denen diese forscherische Aktivität stattfindet. Der Artikel nimmt nach einer grundlegenden Erinnerung an das Konzept der theoretischen Empirie die Bedeutung poststrukturalistischer machttheoretischer Perspektivierungen für das Feld der Übergangsforschung in den Blick. Genauer: Er fragt danach, inwiefern mit solchen machttheoretischen Positionierungen auch bestimmte methodologische Perspektivierungen verbunden sind. Nach einem Aufschlag, der den Zugang einer reflexiven Übergangsforschung umreißt und deren machttheoretische Prämissen in ihrer Relevanz für deren Forschungsfelder ausweist, werden zentrale methodologische Herausforderungen an empirische Forschung in diesen Feldern formuliert und auf existierende Methodenangebote bezogen. Letztere werden einer dezidiert praxeologischen Lesart unterzogen, die die eigene Forschungspraxis wie auch ihre „Gegenstände“ situiert und relationiert. Damit kann der Tendenz im empirischen Arbeiten, Entitäten zu isolieren, gegengesteuert werden und das existierende Methodenrepertoire bewusst dazu genutzt werden, den Prozesscharakter, die Situiertheit und relationale Verwobenheit ihrer „Gegenstände“ deutlich zu machen. Praxeologisieren, situieren und relationieren sind mithin Strategien, denen ein Irritationspotential zugeschrieben werden kann, das in der Forschung generell erwünscht, einer reflexiven Übergangsforschung aber besonders zuträglich ist.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Annotationen zum Theorie- und Forschungsprogramm der Objektiven Hermeneutik Ulrich Oevermanns (Klaus Kraimer)
Das Theorie- und Forschungsprogramm der Objektiven Hermeneutik ist unverbrüchlich mit dem Lebenswerk Ulrich Oevermanns (1940-2021) verbunden Seine theoretischen Modelle wie die Theorie der Deutungsmuster, der Lebenspraxis oder der Professionalisierung zeigen vielfältige Perspektiven zur Erforschung der sinnstrukturierten Welt auf. Dabei eröffnet Oevermanns hermeneutisch-erfahrungswissenschaftliche Methodologie die Perspektive für eine unvoreingenommene, distanzierte, strukturtheoretisch inspirierte Sicht. Biographische Verläufe etwa lassen sich im Kontext seiner Theorie der Lebenspraxis unter dem Gesichtspunkt der Krisenbewältigung im Zuge der Rekonstruktion humaner Sozialisation als Verlaufsform einer systematischen Erzeugung des Neuen verstehen. Dieser Text gibt Einblick in den Grundstock an Begriffen und Wissensbeständen der Objektiven Hermeneutik. Oevermanns Lebenswerk beinhaltet viel von dem, was er seinen akademischen Lehrern Adorno, Habermas oder Lepsius verdankte, was er im Rückgriff auf seine Vorbilder lebendig halten und weiterentwickeln konnte: ein kritisches Aufklärungsinteresse, die Unterwerfung unter die Logik des besseren Argumentes, riskantes Denken, weitreichende bildungs- und gesellschaftstheoretische Schlüsse. Dass er es seiner Leserschaft und sich selbst nicht leicht gemacht hat, davon zeugen seine Disziplinierung zur sachhaltigen Auseinandersetzung mit empirischem Forschungsmaterial, seine methodische Stringenz und die Freude an der Entdeckung des Neuen, die sich in seinen Texten widerspiegeln und in der nächsten forschenden Generation fortleben können.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Schmelztiegel Ruhrbergbau? Die Integration türkischer „Gastarbeiter“ mit Oral-History-Interviews im Schülerlabor erforschen (Marcel Mierwald)
In dem Geschichtsprojekt „Schmelztiegel Ruhrbergbau!? Migration und Integration türkischer ‚Gastarbeiter‘ erforschen“ lernen Schüler:innen zu einer zeit- und regionalhistorischen Fragestellung methodenorientiert mit Oral-History-Interviews im Rahmen eines Schülerlabors. Ein Lernmodul der digitalen Lernplattform „MiBLabor“ unterstützt sie dabei, die multiperspektivisch ausgewählten Berichte von drei ehemaligen Beschäftigten im Ruhrbergbau mithilfe von vier methodischen Strategien zu interpretieren. Der Beitrag stellt die fachwissenschaftliche Grundlage und fachdidaktisch-methodische Konzeption des Geschichtsprojektes dar und zeigt damit eine Möglichkeit auf, wie eine historische Methodenkompetenz im kritisch-reflektierten Umgang mit videografierten Zeitzeugenberichten angebahnt werden kann.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„Von der Geisterjagd“. Möglichkeiten der Sichtbarmachung und Partizipation von Aktivist:innen in der Kunstinstallation „Geister“ (Alicia Gorny)
Die (historische) Auseinandersetzung mit dem Strukturwandel und den damit verbundenen Arbeitskämpfen im Ruhrgebiet unterlag und unterliegt implizit einer maskulinen Prägung der Erinnerungskultur, die sich vornehmlich auf männliche Arbeit und Biographien stützt. Weibliches Engagement in Arbeitskämpfen, das über die Rolle als unterstützende Randfiguren hinausgeht, kann demgegenüber noch immer als blinder Fleck der Geschichtsforschung betrachtet werden. Die Ausstellung „Geister“ präsentierte die erlebte Geschichte derer, die von der klassischen Geschichtsschreibung verdrängt wurden. Durch den aktiven Einbezug damaliger Beteiligter entstand ein partizipatives, multiperspektivisches Ausstellungskonzept. In der Genese des Konzepts traten Dissonanzen und Deutungsverschiebungen zu Tage, die sich in der Lücke zwischen einer wissenschaftlich-analytischen Sicht einerseits und dem Blick von Zeitzeug:innen auf ihre eigenen Erzählungen andererseits, ergaben. Zentral für den Arbeitsprozess wurde die Frage nach der Aneignung von Geschichte und Erinnerung. Eigene wissenschaftliche und künstlerische Deutungshoheiten mussten zurückgestellt werden, um andere Deutungen zuzulassen.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Content
Content
BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen
2-2021: Freie Beiträge
Beiträge
Wolf Kaiser: Holocaust-Tagebücher junger Jüdinnen und Juden
Vera Blaser / Sonja Matter: Die Formation eines politischen Subjektes. Die Emanzipationsbewegung der Gehörlosen in der Schweiz im ausgehenden 20. Jahrhundert
Barbara Stauber: Praxeologisieren – Situieren – Relationieren. Zum methodologischen Gewinn machttheoretischer Überlegungen für eine reflexive Übergangsforschung
Klaus Kraimer: Annotationen zum Theorie- und Forschungsprogramm der Objektiven Hermeneutik Ulrich Oevermanns
Projektberichte
Marcel Mierwald: Schmelztiegel Ruhrbergbau? Die Integration türkischer „Gastarbeiter“ mit Oral-History-Interviews im Schülerlabor erforschen
Alicia Gorny: „Von der Geisterjagd“. Möglichkeiten der Sichtbarmachung und Partizipation von Aktivist:innen in der Kunstinstallation „Geister“
Literaturbesprechung
Dorothee Neumaier: Dorothee Schmitz-Köster: Unbrauchbare Väter. Über Muster-Männer, Seitenspringer und flüchtende Erzeuger im Lebensborn
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Leseproben
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): bios.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den BIOS-Alert anmelden.
Bibliography
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 0933-5315 |
| eISSN | 2196-243X |
| Volume | 34. Jahrgang 2021 |
| Edition | 2-2021 |
| Date of publication | 14.08.2023 |
| Scope | 148 Seiten |
| Language | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Authors
Autor*innen
Schlagwörter
SchlagwörterEmanzipationsbewegung, Gehörlose, Holocaust, Holocaust-Tagebücher, Kunstinstallation, Methodologie, objektive Hermeneutik, Oral History-Interviews, Reflexive uebergangsforschung, Ruhrbergbau, Ruhrgebiet, Schweiz, türkische Gastarbeiter, Ulrich Oevermann
Pressestimmen
Abstracts
Abstracts
Holocaust-Tagebücher junger Jüdinnen und Juden (Wolf Kaiser)
Der Aufsatz befasst sich mit Tagebüchern junger Menschen in vielen Ländern Europas, die von den Nationalsozialisten und ihren Helfern als Jüdinnen und Juden verfolgt und von denen viele ermordet worden sind. Er erörtert, was Tagebücher als historische Quellen mit anderen Selbstzeugnissen wie Memoiren und Zeitzeugeninterviews gemeinsam haben und worin sie sich wesentlich unterscheiden. An einigen Beispielen wird gezeigt, wie Tagebücher aufgrund der zeitlichen Nähe zwischen dem Erleben und der Niederschrift des Erlebten sowie der Offenheit des Erwartungshorizonts Einblicke in die unmittelbaren Reaktionen der Betroffenen und ihre unterschiedlichen Deutungen des Geschehens gewähren. Angesichts solcher Erkenntnismöglichkeiten, wie sie nur Tagebücher und Briefe bieten, wird der Frage nachgegangen, warum die Zahl der überlieferten Diarien regional unterschiedlich groß und insgesamt sehr viel geringer ist als die der Memoiren und Interviews, in denen Überlebende rückblickend von ihren Erfahrungen berichtet haben. Es wird untersucht, wie die Entscheidung für eine bestimmte Form des Tagebuchs von den Lebensbedingungen der Autorinnen und Autoren, aber auch von ihren Motivationen abhing. Die Vielfalt der Motivationen wird anhand von Tagebucheinträgen verdeutlicht, die das Bedürfnis zu schreiben explizit reflektieren. Abschließend wird die Besonderheit der untersuchten Tagebücher dadurch hervorgehoben, dass die Auseinandersetzung der Verfasserinnen und Verfasser mit der akuten Bedrohung ihres Lebens durch die Judenmörder beispielhaft dokumentiert wird.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Formation eines politischen Subjektes. Die Emanzipationsbewegung der Gehörlosen in der Schweiz im ausgehenden 20. Jahrhundert (Vera Blaser und Sonja Matter)
In den ausgehenden 1970er Jahren kamen in der Schweiz – wie auch in anderen Ländern – Transformationsprozesse in Gang, die zu einer Politisierung und Neupositionierung der Gehörlosengemeinschaft und in den 1980er Jahren zur Formierung der Gehörlosenemanzipationsbewegung führten. In der Folge begannen gehörlose Menschen vermehrt, sich als politische Subjekte zu positionieren, Forderungen zu formulieren sowie Diskriminierungen und paternalistische Haltung hörender Fachleute zu kritisieren. Die Vernetzung mit einer zunehmend transnational agierenden Gehörlosencommunity und die Anlehnung an Aktionsformen anderer Emanzipationsbewegungen spielten dabei eine wichtige Rolle. Der Artikel nimmt diese Prozesse der Subjektivierung (Rancière) gehörloser Menschen als Teil einer emanzipatorischen Politik in den Blick. Wir fokussieren dabei drei maßgebliche Zielsetzungen der Bewegung, die in den 1980er Jahren entwickelt wurden und noch heute für die Politik der Gehörlosengemeinschaft zentral sind: der Zugang zur modernen Kommunikations- und Wissensgesellschaft, die offizielle Anerkennung der Gebärdensprachen und das „Empowerment“, verstanden als individueller und kollektiver Prozess, der Selbstbewusstsein und die Fähigkeit politisch zu agieren fördert. Als Quellenkorpus fungieren in erster Linie zehn leitfadengestützte-themenzentrierte Interviews mit einflussreichen gehörlosen Aktivist*innen aus den 1980er Jahren. In einem einführenden Teil diskutieren wir die methodischen Herausforderungen und notwendigen Voraussetzungen für eine gelingende Durchführung von Interviews mit Hilfe von Gebärdensprachdolmetscher*innen.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Praxeologisieren – Situieren – Relationieren. Zum methodologischen Gewinn machttheoretischer Überlegungen für eine reflexive Übergangsforschung (Barbara Stauber)
Die Frage, was durch eine empirische Forschungspraxis überhaupt erschlossen werden kann, ist abhängig von den jeweiligen theoretischen Perspektiven, in denen diese forscherische Aktivität stattfindet. Der Artikel nimmt nach einer grundlegenden Erinnerung an das Konzept der theoretischen Empirie die Bedeutung poststrukturalistischer machttheoretischer Perspektivierungen für das Feld der Übergangsforschung in den Blick. Genauer: Er fragt danach, inwiefern mit solchen machttheoretischen Positionierungen auch bestimmte methodologische Perspektivierungen verbunden sind. Nach einem Aufschlag, der den Zugang einer reflexiven Übergangsforschung umreißt und deren machttheoretische Prämissen in ihrer Relevanz für deren Forschungsfelder ausweist, werden zentrale methodologische Herausforderungen an empirische Forschung in diesen Feldern formuliert und auf existierende Methodenangebote bezogen. Letztere werden einer dezidiert praxeologischen Lesart unterzogen, die die eigene Forschungspraxis wie auch ihre „Gegenstände“ situiert und relationiert. Damit kann der Tendenz im empirischen Arbeiten, Entitäten zu isolieren, gegengesteuert werden und das existierende Methodenrepertoire bewusst dazu genutzt werden, den Prozesscharakter, die Situiertheit und relationale Verwobenheit ihrer „Gegenstände“ deutlich zu machen. Praxeologisieren, situieren und relationieren sind mithin Strategien, denen ein Irritationspotential zugeschrieben werden kann, das in der Forschung generell erwünscht, einer reflexiven Übergangsforschung aber besonders zuträglich ist.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Annotationen zum Theorie- und Forschungsprogramm der Objektiven Hermeneutik Ulrich Oevermanns (Klaus Kraimer)
Das Theorie- und Forschungsprogramm der Objektiven Hermeneutik ist unverbrüchlich mit dem Lebenswerk Ulrich Oevermanns (1940-2021) verbunden Seine theoretischen Modelle wie die Theorie der Deutungsmuster, der Lebenspraxis oder der Professionalisierung zeigen vielfältige Perspektiven zur Erforschung der sinnstrukturierten Welt auf. Dabei eröffnet Oevermanns hermeneutisch-erfahrungswissenschaftliche Methodologie die Perspektive für eine unvoreingenommene, distanzierte, strukturtheoretisch inspirierte Sicht. Biographische Verläufe etwa lassen sich im Kontext seiner Theorie der Lebenspraxis unter dem Gesichtspunkt der Krisenbewältigung im Zuge der Rekonstruktion humaner Sozialisation als Verlaufsform einer systematischen Erzeugung des Neuen verstehen. Dieser Text gibt Einblick in den Grundstock an Begriffen und Wissensbeständen der Objektiven Hermeneutik. Oevermanns Lebenswerk beinhaltet viel von dem, was er seinen akademischen Lehrern Adorno, Habermas oder Lepsius verdankte, was er im Rückgriff auf seine Vorbilder lebendig halten und weiterentwickeln konnte: ein kritisches Aufklärungsinteresse, die Unterwerfung unter die Logik des besseren Argumentes, riskantes Denken, weitreichende bildungs- und gesellschaftstheoretische Schlüsse. Dass er es seiner Leserschaft und sich selbst nicht leicht gemacht hat, davon zeugen seine Disziplinierung zur sachhaltigen Auseinandersetzung mit empirischem Forschungsmaterial, seine methodische Stringenz und die Freude an der Entdeckung des Neuen, die sich in seinen Texten widerspiegeln und in der nächsten forschenden Generation fortleben können.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Schmelztiegel Ruhrbergbau? Die Integration türkischer „Gastarbeiter“ mit Oral-History-Interviews im Schülerlabor erforschen (Marcel Mierwald)
In dem Geschichtsprojekt „Schmelztiegel Ruhrbergbau!? Migration und Integration türkischer ‚Gastarbeiter‘ erforschen“ lernen Schüler:innen zu einer zeit- und regionalhistorischen Fragestellung methodenorientiert mit Oral-History-Interviews im Rahmen eines Schülerlabors. Ein Lernmodul der digitalen Lernplattform „MiBLabor“ unterstützt sie dabei, die multiperspektivisch ausgewählten Berichte von drei ehemaligen Beschäftigten im Ruhrbergbau mithilfe von vier methodischen Strategien zu interpretieren. Der Beitrag stellt die fachwissenschaftliche Grundlage und fachdidaktisch-methodische Konzeption des Geschichtsprojektes dar und zeigt damit eine Möglichkeit auf, wie eine historische Methodenkompetenz im kritisch-reflektierten Umgang mit videografierten Zeitzeugenberichten angebahnt werden kann.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„Von der Geisterjagd“. Möglichkeiten der Sichtbarmachung und Partizipation von Aktivist:innen in der Kunstinstallation „Geister“ (Alicia Gorny)
Die (historische) Auseinandersetzung mit dem Strukturwandel und den damit verbundenen Arbeitskämpfen im Ruhrgebiet unterlag und unterliegt implizit einer maskulinen Prägung der Erinnerungskultur, die sich vornehmlich auf männliche Arbeit und Biographien stützt. Weibliches Engagement in Arbeitskämpfen, das über die Rolle als unterstützende Randfiguren hinausgeht, kann demgegenüber noch immer als blinder Fleck der Geschichtsforschung betrachtet werden. Die Ausstellung „Geister“ präsentierte die erlebte Geschichte derer, die von der klassischen Geschichtsschreibung verdrängt wurden. Durch den aktiven Einbezug damaliger Beteiligter entstand ein partizipatives, multiperspektivisches Ausstellungskonzept. In der Genese des Konzepts traten Dissonanzen und Deutungsverschiebungen zu Tage, die sich in der Lücke zwischen einer wissenschaftlich-analytischen Sicht einerseits und dem Blick von Zeitzeug:innen auf ihre eigenen Erzählungen andererseits, ergaben. Zentral für den Arbeitsprozess wurde die Frage nach der Aneignung von Geschichte und Erinnerung. Eigene wissenschaftliche und künstlerische Deutungshoheiten mussten zurückgestellt werden, um andere Deutungen zuzulassen.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
This might also be of interest to you:
Verlag Barbara Budrich
- +49 (0)2171.79491-50
- info@budrich.de
-
Stauffenbergstr. 7
51379 Leverkusen
Germany






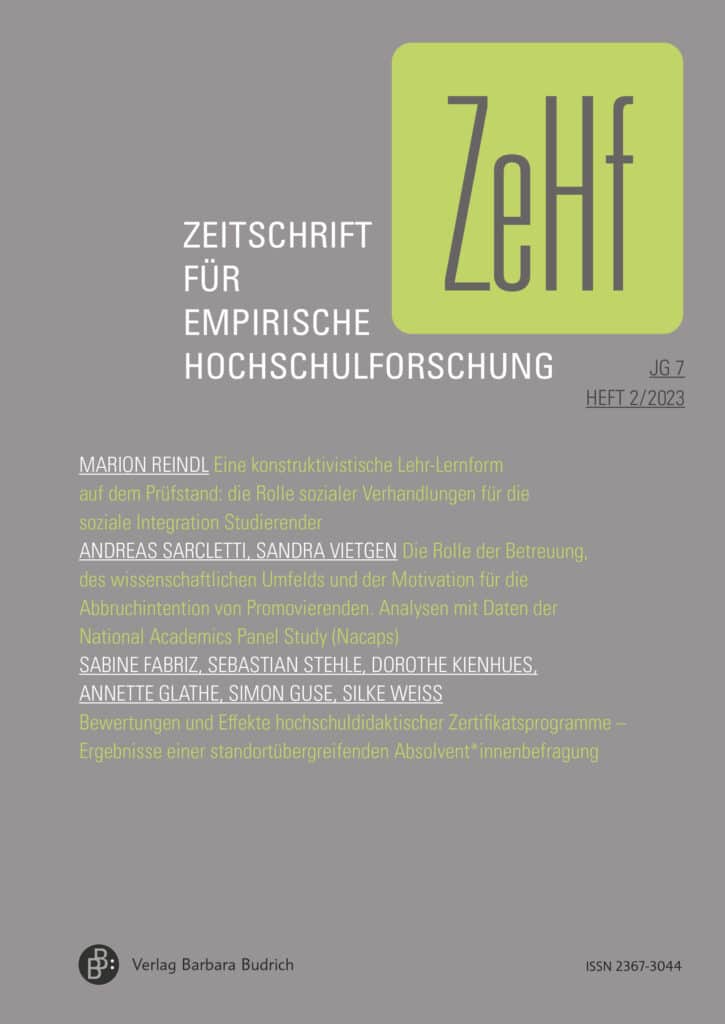



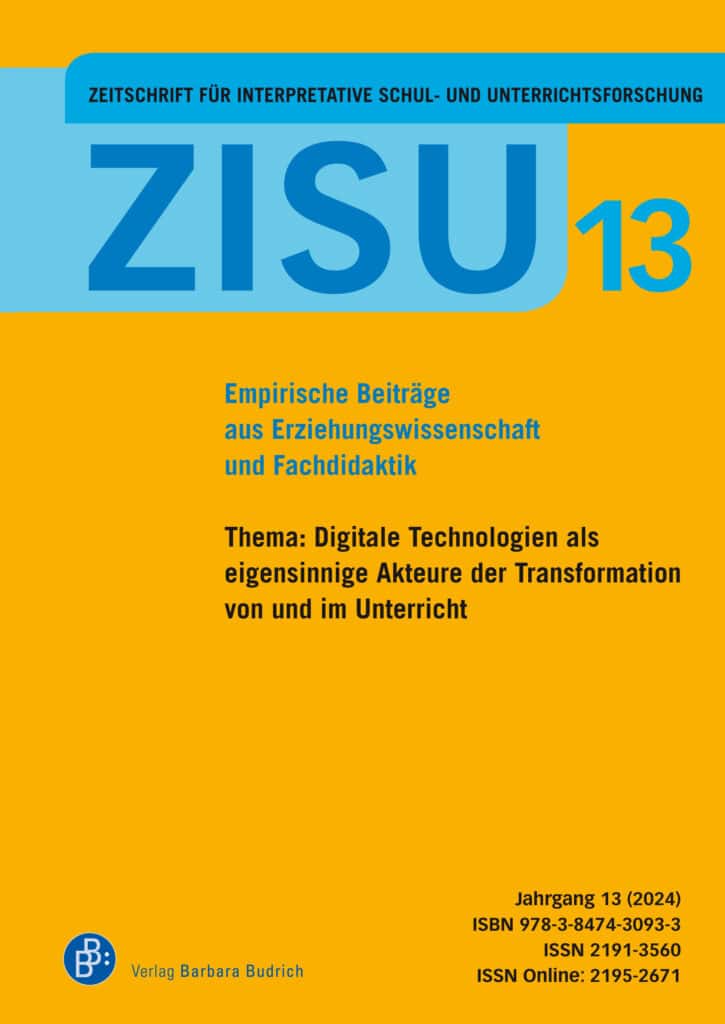

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.