Informationen zur Zeitschrift
Home » Publications » Diskurs 4-2021 | Perspektiven von Kindern und Jugendlichen auf sprachliche Diversität und Sprachbildungsprozesse
Diskurs 4-2021 | Perspektiven von Kindern und Jugendlichen auf sprachliche Diversität und Sprachbildungsprozesse
Erscheinungsdatum : 07.12.2021
0,00 € - 22,00 €
Inhalt
Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research
4-2021: Perspektiven von Kindern und Jugendlichen auf sprachliche Diversität und Sprachbildungsprozesse
Galina Putjata / Simone Plöger: Editorial
Schwerpunktbeiträge
Astrid Adler / Maria Ribeiro Silveira: Warum wir so wenig über die Sprachen in Deutschland wissen. Spracheinstellungen als Erkenntnisbarriere
Svetlana Vishek: „Doch nicht auf Russisch!“ – Perspektiven von Kindern auf Sprachbildungsprozesse im Rahmen familialer Vorlesesituationen mit mehrsprachigen Bilderbüchern
Esra Hack-Cengizalp: Konzeptuelles Wissen aus der Perspektive ein- und mehrsprachiger Grundschulkinder – ein qualitativer Vergleich
Liesa Rühlmann: Mit Kindern über Mehrsprachigkeit sprechen – Methodische (Selbst-)Reflexion einer Befragung von Viertklässler*innen
Freie Beiträge
Cindy Ballaschk / Sebstian Wachs / Norman Krause / Friederike Schulze-Reichelt / Julia Kansok-Dusche / Ludwig Bilz / Wilfried Schubarth: „Dann machen halt alle mit.“ Eine qualitative Studie zu Beweggründen und Motiven für Hatespeech unter Schüler*innen
Andrea G. Eckhardt / Louise Thea Maas / Sophie Hauke / Susann Stolle: „Kleine Meister“ – Evaluation eines pädagogischen Angebots zur Berufsfrühorientierung in Kindertageseinrichtungen
Nora Heyne / Maximilian Pfost / Hanna Maria Heiler: Affektive Perspektivenübernahme beim Verstehen literarischer Texte im Grundschulalter und ihre Bedeutung für Leseeinstellungen und Textverstehen
Frances Press / Mandy Cooke / Leanne Gibbs / Robbie Warren: Inequality, social justice and the purpose of Early Childhood Education
Kurzbeitrag
Eva Frick: Primäre Herkunftseffekte unter besonderer Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit und Input als wesentliche Faktoren der kindlichen Sprachentwicklung
Rezensionen
Manfred Liebel: Irit Wyrobnik (2021). Korczaks Pädagogik heute. Wertschätzung, Partizipation und Lebensfreude in der Kita
Steffen Kallenbach: Ingo Richter, Lothar Krappmann und Friederike Wapler (Hrsg.) (2020). Kinderrechte. Handbuch des deutschen und internationalen Kinder- und Jugendrechts
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Einzelbeitrags-Download (Open Access/Gebühr): diskurs.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den Diskurs-Alert anmelden.
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 1862-5002 |
| eISSN | 2193-9713 |
| Volume | 16. Jahrgang 2021 |
| Edition | 4 |
| Date of publication | 07.12.2021 |
| Scope | 144 |
| Language | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Autor*innen
Keywords(Selbst-)Reflexion, affektive Perspektivenübernahme, Berufsorientierung, Bildung, early childhood education, Elementarbereich, empathisches Textverstehen, Forschungsethik, Grundschule, Hassrede, hatespeech, inequality, Kindheitsforschung, Leseeinstellungen, Lesesozialisation, literarisches Textverstehen, mehrsprachige Bilderbücher, Mehrsprachigkeit, Primarstufe, quality, Sachwissen, Schule, semantische Inkongruenz, social justice, Spracheinstellungen, Sprachentwicklung, Sprachstatistiken, Tagung Diversität, translanguaging, Viabilität
Abstracts
Warum wir so wenig über die Sprachen in Deutschland wissen. Spracheinstellungen als Erkenntnisbarriere (Astrid Adler, Maria Ribeiro Silveira)
Bislang gibt es keine akkuraten, repräsentativen Statistiken dazu, welche Sprachen in Deutschland gesprochen werden. Zwar wird in verschiedenen Erhebungen nach Muttersprachen oder nach zuhause gesprochenen Sprachen gefragt; aufgrund einiger Mängel im Erhebungsdesign bilden die Ergebnisse der vorliegenden Erhebungen jedoch die sprachliche Realität der in Deutschland lebenden Bevölkerung nicht angemessen ab. Im Beitrag wird anhand von drei Erhebungen gezeigt, dass bereits die Instrumente zur Erhebung von Sprache von Spracheinstellungen geprägt sind und dass dadurch die Gültigkeit der Ergebnisse stark eingeschränkt wird. Diese Mängel gelten für Sprachstatistiken im Hinblick auf die gesamte Bevölkerung Deutschlands – Kinder und Jugendliche eingeschlossen. Schlagwörter: Spracheinstellungen, Sprachstatistiken, Erhebungsmethoden
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Doch nicht auf Russisch!“ – Perspektiven von Kindern auf Sprachbildungsprozesse im Rahmen familialer Vorlesesituationen mit mehrsprachigen Bilderbüchern (Svetlana Vishek)
Sprachbildung findet nicht nur in Bildungseinrichtungen statt. Der sprachliche Alltag in der Familie ist mindestens genauso ausschlaggebend für die Enkulturation von Kindern wie das Bemühen von pädagogischen Fachkräften. Dieser Beitrag widmet sich aus diesem Grund der familialen Vorlesepraxis im Kontext der Mehrsprachigkeit als Moment sprachlicher Bildung und des Austauschs. Im Fokus stehen die Positionierungen der Kinder zu ihrem Sprachgebrauch sowie zu den Sprachbildungsprozessen, die sich im Rahmen der exemplarischen Vorlesesituationen beobachten lassen. Sichtbar wird dabei besonders die Rolle der einzelsprachübergreifenden Sprachverwendung für die Partizipation der Kinder im Rahmen der informellen Sprachlernsituation. Den theoretischen Rahmen bildet die Schnittstelle zwischen Lesesozialisationsforschung und soziokulturellen lerntheoretischen Ansätzen. Die Rekonstruktion der Perspektive der Kinder erfolgt mithilfe des gesprächsanalytischen Zuganges (Deppermann, 2000). Schlagwörter: Lesesozialisation in der Familie, Mehrsprachigkeit, Translanguaging, mehrsprachige Bilderbücher
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Konzeptuelles Wissen aus der Perspektive ein- und mehrsprachiger Grundschulkinder – ein qualitativer Vergleich (Esra Hack-Cengizalp)
Konzeptuelles Wissen wird maßgeblich von sprachlichen Erfahrungen beeinflusst. Dabei können Kinder mit steigendem Alter mühelos erkennen, ob beobachtete Phänomene in der außersprachlichen Wirklichkeit eine viable Beziehung aufweisen. Kinder nutzen ihre Welterfahrungen sowie ihre sprachlichen Fähigkeiten, um sprachimmanente Kongruenz herzustellen bzw. aufzubauen. Im vorliegenden Beitrag werden 43 Erklärungen von ein- und mehrsprachigen Kindern analysiert, die als Antwort auf präsentierte semantisch (in-)kongruente Begriffspaare mit dem Basiswort beobachten gegeben wurden. Die halbstandardisierten Interviews wurden im Rahmen der Studie „Mehrsprachiges Bedeutungswissen“ durchgeführt. Die Analysen zeigen, dass sowohl ein- als auch mehrsprachige Kinder die Kongruenz eher auf konzeptueller Basis beurteilen, weniger auf sprachlicher Basis. Dabei konstruieren sie neue Kontexte, die die Annahme bzw. Ablehnung der Kongruenz plausibel machen. Die Ergebnisse werden diskutiert und sprachdidaktische Schlussfolgerungen gezogen. Schlagwörter: Konzept, semantische Inkongruenz, Viabilität, Mehrsprachigkeit, Grundschule
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Mit Kindern über Mehrsprachigkeit sprechen – Methodische (Selbst-)Reflexion einer Befragung von Viertklässler*innen (Liesa Rühlmann)
Forschung mit Kindern stellt zwar die Perspektive von Kindern in den Fokus, jedoch ist auch hier der Blick Forschender zentral. In der Erhebung von Interviews nehmen Forschende durch ihre Anwesenheit Einfluss auf den Verlauf des Gesprächs und entscheiden in der Auswertung, welche Aussagen sie als bedeutsam einordnen und wie sie diese interpretieren. Im Artikel blicke ich (selbst-)reflexiv auf eine von mir durchgeführte Studie, in welcher Kinder zum Erleben ihrer Mehrsprachigkeit in der Schule befragt wurden. Zunächst gehe ich auf die zentralen Ergebnisse der Studie ein. Der Fokus liegt anschließend auf zwei Reflexionsfolien: Erst reflektiere ich anhand meines Vorgehens übergreifend die Forschung mit mehrsprachigen Kindern. Anschließend werden sich daraus ergebende ethische Aspekte beleuchtet. Schlagwörter: Mehrsprachigkeit, Kindheitsforschung, Forschungsethik, (Selbst-)Reflexion
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Dann machen halt alle mit.“ Eine qualitative Studie zu Beweggründen und Motiven für Hatespeech unter Schüler*innen (Cindy Ballaschk, Sebastian Wachs, Norman Krause, Friederike Schulze-Reichelt, Julia Kansok-Dusche, Ludwig Bilz, Wilfried Schubarth)
Das Thema Hatespeech rückt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und der Forschung. Im Gegensatz zu Hatespeech im Internet wird jedoch Hatespeech unter Jugendlichen, die von Angesicht zu Angesicht im Schulkontext ausgeübt wird, kaum beachtet. Hier setzt die vorliegende Studie an, in der Schüler*innen (n = 55), Lehrkräfte (n = 18) und Sozialpädagog*innen (n =16) auf der Basis leitfadengestützter Interviews dazu befragt wurden, was mögliche Beweggründe und Motive dafür sind, dass Schüler*innen Hatespeech in der Lebenswelt Schule und online ausüben. Die Ergebnisse zeigen, dass mögliche Beweggründe für Hatespeech Angst vor Statusverlust, Gruppendruck, Provokation, Spaß, politisch-ideologische Überzeugung und Kompensation von Frust- und Minderwertigkeitsgefühlen sind. Darüber hinaus wird verdeutlicht, dass sich hinter diesen Gründen für Hatespeech oftmals Grundmotive nach Macht und Zugehörigkeit abzeichnen. Die Ergebnisse werden in Bezug auf anschließende Forschung und praktische Implikationen diskutiert. Schlagwörter: Hatespeech, Hassrede, Gründe, Motive, Schule
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Kleine Meister“ – Evaluation eines pädagogischen Angebots zur Berufsfrühorientierung in Kindertageseinrichtungen (Andrea G. Eckhardt, Louisa Thea Maas, Sophie Hauke, Susann Stolle)
Die Wahl eines Berufes ist ein lebenslanger komplexer Prozess und Ergebnis von familiärer Sozialisation, Lebenslage und Bildungsprozessen. Im Primar- und Elementarbereich ist Berufsorientierung ein nachrangiges Thema. In den Bildungs-, Erziehungs- und Orientierungsplänen der Bundesländer finden sich jedoch Hinweise und Beispiele für die pädagogische Arbeit zum Thema Berufe. Mit ihrem ganzheitlichen Förderauftrag und der lebensweltbezogenen Arbeit sind Kindertageseinrichtungen geeignete Orte für frühkindliche Bildungsprozesse und Ansatzpunkt für erste Auseinandersetzungen mit Berufen. In diesem Beitrag werden Ergebnisse der Evaluation des Projektes „Kleine Meister“, einem Projekt zur Berufsfrühorientierung, präsentiert. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass Vorschulkinder durch die pädagogische Arbeit ihr Wissen zu den Berufen im Projektzeitraum signifikant verbessern konnten. Damit zeigt sich, dass der Elementarbereich einen wirksamen Beitrag zur Berufsorientierung leisten kann. Schlagwörter: Berufsorientierung, Elementarbereich, Bildung, Sachwissen, Projekt
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Affektive Perspektivenübernahme beim Verstehen literarischer Texte im Grundschulalter und ihre Bedeutung für Leseeinstellungen und Textverstehen (Nora Heyne, Maximilian Pfost, Hanna Maria Heiler)
Ziel der Studie ist es, den Stand der Fähigkeiten von Grundschulkindern zur affektiven Perspektivenübernahme beim Verstehen literarischer Texte, als empathisches Textverstehen, und ihre Zusammenhänge mit Textverstehen und Leseeinstellungen zu untersuchen. Die Erhebung dieser Merkmale erfolgte anhand von Tests und Fragebögen im Anschluss an Lesungen. Die Befunde verdeutlichen, dass Kinder (N = 160), insbesondere Mädchen, substantielle Fähigkeiten im empathischen Textverstehen aufweisen, die positiv mit den Leseeinstellungen und dem übergreifenden Textverstehen korrelieren. Dass diese Fähigkeiten, vermittelt über Leseeinstellungen, das Textverstehen begünstigen, zeigen die Daten nicht. Die Studie bietet zudem neue methodische Zugänge zur Erfassung des empathischen und des übergreifenden Textverstehens. Diese zukünftig bei Leseprozessen und im Entwicklungsverlauf zu untersuchen, lässt Erkenntnisse zum Potenzial empathischen Lesens für den Erwerb von Lesekompetenz und weiteren Fähigkeiten erwarten. Schlagwörter: literarisches Textverstehen, empathisches Textverstehen, affektive Perspektivenübernahme, Leseeinstellungen, Primarstufe
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Inequality, social justice and the purpose of Early Childhood Education (Frances Press, Mandy Cooke, Leanne Gibbs and Robbie Warren)
Early childhood education and care (ECEC) – as with education more generally – should be a central plank of a suite of social policies designed to support more socially just societies. However, universal access to ECEC in itself, will not redress inequalities. This paper draws upon reports from the Australian Children’s Education and Care Quality Authority (ACECQA), and data from three doctoral studies nested within the Australian Exemplary Early Childhood Educators at Work research project, to argue for attention to the quality of the early childhood system and to consider the contribution that a deeply embedded socially just purpose makes to quality. Keywords: early childhood education, social justice, quality, inequality
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Inhalt
Inhalt
Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research
4-2021: Perspektiven von Kindern und Jugendlichen auf sprachliche Diversität und Sprachbildungsprozesse
Galina Putjata / Simone Plöger: Editorial
Schwerpunktbeiträge
Astrid Adler / Maria Ribeiro Silveira: Warum wir so wenig über die Sprachen in Deutschland wissen. Spracheinstellungen als Erkenntnisbarriere
Svetlana Vishek: „Doch nicht auf Russisch!“ – Perspektiven von Kindern auf Sprachbildungsprozesse im Rahmen familialer Vorlesesituationen mit mehrsprachigen Bilderbüchern
Esra Hack-Cengizalp: Konzeptuelles Wissen aus der Perspektive ein- und mehrsprachiger Grundschulkinder – ein qualitativer Vergleich
Liesa Rühlmann: Mit Kindern über Mehrsprachigkeit sprechen – Methodische (Selbst-)Reflexion einer Befragung von Viertklässler*innen
Freie Beiträge
Cindy Ballaschk / Sebstian Wachs / Norman Krause / Friederike Schulze-Reichelt / Julia Kansok-Dusche / Ludwig Bilz / Wilfried Schubarth: „Dann machen halt alle mit.“ Eine qualitative Studie zu Beweggründen und Motiven für Hatespeech unter Schüler*innen
Andrea G. Eckhardt / Louise Thea Maas / Sophie Hauke / Susann Stolle: „Kleine Meister“ – Evaluation eines pädagogischen Angebots zur Berufsfrühorientierung in Kindertageseinrichtungen
Nora Heyne / Maximilian Pfost / Hanna Maria Heiler: Affektive Perspektivenübernahme beim Verstehen literarischer Texte im Grundschulalter und ihre Bedeutung für Leseeinstellungen und Textverstehen
Frances Press / Mandy Cooke / Leanne Gibbs / Robbie Warren: Inequality, social justice and the purpose of Early Childhood Education
Kurzbeitrag
Eva Frick: Primäre Herkunftseffekte unter besonderer Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit und Input als wesentliche Faktoren der kindlichen Sprachentwicklung
Rezensionen
Manfred Liebel: Irit Wyrobnik (2021). Korczaks Pädagogik heute. Wertschätzung, Partizipation und Lebensfreude in der Kita
Steffen Kallenbach: Ingo Richter, Lothar Krappmann und Friederike Wapler (Hrsg.) (2020). Kinderrechte. Handbuch des deutschen und internationalen Kinder- und Jugendrechts
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Einzelbeitrags-Download (Open Access/Gebühr): diskurs.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den Diskurs-Alert anmelden.
Bibliography
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 1862-5002 |
| eISSN | 2193-9713 |
| Volume | 16. Jahrgang 2021 |
| Edition | 4 |
| Date of publication | 07.12.2021 |
| Scope | 144 |
| Language | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Open Access-Lizenz | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Authors
Autor*innen
Tags
Keywords(Selbst-)Reflexion, affektive Perspektivenübernahme, Berufsorientierung, Bildung, early childhood education, Elementarbereich, empathisches Textverstehen, Forschungsethik, Grundschule, Hassrede, hatespeech, inequality, Kindheitsforschung, Leseeinstellungen, Lesesozialisation, literarisches Textverstehen, mehrsprachige Bilderbücher, Mehrsprachigkeit, Primarstufe, quality, Sachwissen, Schule, semantische Inkongruenz, social justice, Spracheinstellungen, Sprachentwicklung, Sprachstatistiken, Tagung Diversität, translanguaging, Viabilität
Abstracts
Abstracts
Warum wir so wenig über die Sprachen in Deutschland wissen. Spracheinstellungen als Erkenntnisbarriere (Astrid Adler, Maria Ribeiro Silveira)
Bislang gibt es keine akkuraten, repräsentativen Statistiken dazu, welche Sprachen in Deutschland gesprochen werden. Zwar wird in verschiedenen Erhebungen nach Muttersprachen oder nach zuhause gesprochenen Sprachen gefragt; aufgrund einiger Mängel im Erhebungsdesign bilden die Ergebnisse der vorliegenden Erhebungen jedoch die sprachliche Realität der in Deutschland lebenden Bevölkerung nicht angemessen ab. Im Beitrag wird anhand von drei Erhebungen gezeigt, dass bereits die Instrumente zur Erhebung von Sprache von Spracheinstellungen geprägt sind und dass dadurch die Gültigkeit der Ergebnisse stark eingeschränkt wird. Diese Mängel gelten für Sprachstatistiken im Hinblick auf die gesamte Bevölkerung Deutschlands – Kinder und Jugendliche eingeschlossen. Schlagwörter: Spracheinstellungen, Sprachstatistiken, Erhebungsmethoden
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Doch nicht auf Russisch!“ – Perspektiven von Kindern auf Sprachbildungsprozesse im Rahmen familialer Vorlesesituationen mit mehrsprachigen Bilderbüchern (Svetlana Vishek)
Sprachbildung findet nicht nur in Bildungseinrichtungen statt. Der sprachliche Alltag in der Familie ist mindestens genauso ausschlaggebend für die Enkulturation von Kindern wie das Bemühen von pädagogischen Fachkräften. Dieser Beitrag widmet sich aus diesem Grund der familialen Vorlesepraxis im Kontext der Mehrsprachigkeit als Moment sprachlicher Bildung und des Austauschs. Im Fokus stehen die Positionierungen der Kinder zu ihrem Sprachgebrauch sowie zu den Sprachbildungsprozessen, die sich im Rahmen der exemplarischen Vorlesesituationen beobachten lassen. Sichtbar wird dabei besonders die Rolle der einzelsprachübergreifenden Sprachverwendung für die Partizipation der Kinder im Rahmen der informellen Sprachlernsituation. Den theoretischen Rahmen bildet die Schnittstelle zwischen Lesesozialisationsforschung und soziokulturellen lerntheoretischen Ansätzen. Die Rekonstruktion der Perspektive der Kinder erfolgt mithilfe des gesprächsanalytischen Zuganges (Deppermann, 2000). Schlagwörter: Lesesozialisation in der Familie, Mehrsprachigkeit, Translanguaging, mehrsprachige Bilderbücher
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Konzeptuelles Wissen aus der Perspektive ein- und mehrsprachiger Grundschulkinder – ein qualitativer Vergleich (Esra Hack-Cengizalp)
Konzeptuelles Wissen wird maßgeblich von sprachlichen Erfahrungen beeinflusst. Dabei können Kinder mit steigendem Alter mühelos erkennen, ob beobachtete Phänomene in der außersprachlichen Wirklichkeit eine viable Beziehung aufweisen. Kinder nutzen ihre Welterfahrungen sowie ihre sprachlichen Fähigkeiten, um sprachimmanente Kongruenz herzustellen bzw. aufzubauen. Im vorliegenden Beitrag werden 43 Erklärungen von ein- und mehrsprachigen Kindern analysiert, die als Antwort auf präsentierte semantisch (in-)kongruente Begriffspaare mit dem Basiswort beobachten gegeben wurden. Die halbstandardisierten Interviews wurden im Rahmen der Studie „Mehrsprachiges Bedeutungswissen“ durchgeführt. Die Analysen zeigen, dass sowohl ein- als auch mehrsprachige Kinder die Kongruenz eher auf konzeptueller Basis beurteilen, weniger auf sprachlicher Basis. Dabei konstruieren sie neue Kontexte, die die Annahme bzw. Ablehnung der Kongruenz plausibel machen. Die Ergebnisse werden diskutiert und sprachdidaktische Schlussfolgerungen gezogen. Schlagwörter: Konzept, semantische Inkongruenz, Viabilität, Mehrsprachigkeit, Grundschule
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Mit Kindern über Mehrsprachigkeit sprechen – Methodische (Selbst-)Reflexion einer Befragung von Viertklässler*innen (Liesa Rühlmann)
Forschung mit Kindern stellt zwar die Perspektive von Kindern in den Fokus, jedoch ist auch hier der Blick Forschender zentral. In der Erhebung von Interviews nehmen Forschende durch ihre Anwesenheit Einfluss auf den Verlauf des Gesprächs und entscheiden in der Auswertung, welche Aussagen sie als bedeutsam einordnen und wie sie diese interpretieren. Im Artikel blicke ich (selbst-)reflexiv auf eine von mir durchgeführte Studie, in welcher Kinder zum Erleben ihrer Mehrsprachigkeit in der Schule befragt wurden. Zunächst gehe ich auf die zentralen Ergebnisse der Studie ein. Der Fokus liegt anschließend auf zwei Reflexionsfolien: Erst reflektiere ich anhand meines Vorgehens übergreifend die Forschung mit mehrsprachigen Kindern. Anschließend werden sich daraus ergebende ethische Aspekte beleuchtet. Schlagwörter: Mehrsprachigkeit, Kindheitsforschung, Forschungsethik, (Selbst-)Reflexion
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Dann machen halt alle mit.“ Eine qualitative Studie zu Beweggründen und Motiven für Hatespeech unter Schüler*innen (Cindy Ballaschk, Sebastian Wachs, Norman Krause, Friederike Schulze-Reichelt, Julia Kansok-Dusche, Ludwig Bilz, Wilfried Schubarth)
Das Thema Hatespeech rückt immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und der Forschung. Im Gegensatz zu Hatespeech im Internet wird jedoch Hatespeech unter Jugendlichen, die von Angesicht zu Angesicht im Schulkontext ausgeübt wird, kaum beachtet. Hier setzt die vorliegende Studie an, in der Schüler*innen (n = 55), Lehrkräfte (n = 18) und Sozialpädagog*innen (n =16) auf der Basis leitfadengestützter Interviews dazu befragt wurden, was mögliche Beweggründe und Motive dafür sind, dass Schüler*innen Hatespeech in der Lebenswelt Schule und online ausüben. Die Ergebnisse zeigen, dass mögliche Beweggründe für Hatespeech Angst vor Statusverlust, Gruppendruck, Provokation, Spaß, politisch-ideologische Überzeugung und Kompensation von Frust- und Minderwertigkeitsgefühlen sind. Darüber hinaus wird verdeutlicht, dass sich hinter diesen Gründen für Hatespeech oftmals Grundmotive nach Macht und Zugehörigkeit abzeichnen. Die Ergebnisse werden in Bezug auf anschließende Forschung und praktische Implikationen diskutiert. Schlagwörter: Hatespeech, Hassrede, Gründe, Motive, Schule
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
„Kleine Meister“ – Evaluation eines pädagogischen Angebots zur Berufsfrühorientierung in Kindertageseinrichtungen (Andrea G. Eckhardt, Louisa Thea Maas, Sophie Hauke, Susann Stolle)
Die Wahl eines Berufes ist ein lebenslanger komplexer Prozess und Ergebnis von familiärer Sozialisation, Lebenslage und Bildungsprozessen. Im Primar- und Elementarbereich ist Berufsorientierung ein nachrangiges Thema. In den Bildungs-, Erziehungs- und Orientierungsplänen der Bundesländer finden sich jedoch Hinweise und Beispiele für die pädagogische Arbeit zum Thema Berufe. Mit ihrem ganzheitlichen Förderauftrag und der lebensweltbezogenen Arbeit sind Kindertageseinrichtungen geeignete Orte für frühkindliche Bildungsprozesse und Ansatzpunkt für erste Auseinandersetzungen mit Berufen. In diesem Beitrag werden Ergebnisse der Evaluation des Projektes „Kleine Meister“, einem Projekt zur Berufsfrühorientierung, präsentiert. Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass Vorschulkinder durch die pädagogische Arbeit ihr Wissen zu den Berufen im Projektzeitraum signifikant verbessern konnten. Damit zeigt sich, dass der Elementarbereich einen wirksamen Beitrag zur Berufsorientierung leisten kann. Schlagwörter: Berufsorientierung, Elementarbereich, Bildung, Sachwissen, Projekt
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Affektive Perspektivenübernahme beim Verstehen literarischer Texte im Grundschulalter und ihre Bedeutung für Leseeinstellungen und Textverstehen (Nora Heyne, Maximilian Pfost, Hanna Maria Heiler)
Ziel der Studie ist es, den Stand der Fähigkeiten von Grundschulkindern zur affektiven Perspektivenübernahme beim Verstehen literarischer Texte, als empathisches Textverstehen, und ihre Zusammenhänge mit Textverstehen und Leseeinstellungen zu untersuchen. Die Erhebung dieser Merkmale erfolgte anhand von Tests und Fragebögen im Anschluss an Lesungen. Die Befunde verdeutlichen, dass Kinder (N = 160), insbesondere Mädchen, substantielle Fähigkeiten im empathischen Textverstehen aufweisen, die positiv mit den Leseeinstellungen und dem übergreifenden Textverstehen korrelieren. Dass diese Fähigkeiten, vermittelt über Leseeinstellungen, das Textverstehen begünstigen, zeigen die Daten nicht. Die Studie bietet zudem neue methodische Zugänge zur Erfassung des empathischen und des übergreifenden Textverstehens. Diese zukünftig bei Leseprozessen und im Entwicklungsverlauf zu untersuchen, lässt Erkenntnisse zum Potenzial empathischen Lesens für den Erwerb von Lesekompetenz und weiteren Fähigkeiten erwarten. Schlagwörter: literarisches Textverstehen, empathisches Textverstehen, affektive Perspektivenübernahme, Leseeinstellungen, Primarstufe
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)
Inequality, social justice and the purpose of Early Childhood Education (Frances Press, Mandy Cooke, Leanne Gibbs and Robbie Warren)
Early childhood education and care (ECEC) – as with education more generally – should be a central plank of a suite of social policies designed to support more socially just societies. However, universal access to ECEC in itself, will not redress inequalities. This paper draws upon reports from the Australian Children’s Education and Care Quality Authority (ACECQA), and data from three doctoral studies nested within the Australian Exemplary Early Childhood Educators at Work research project, to argue for attention to the quality of the early childhood system and to consider the contribution that a deeply embedded socially just purpose makes to quality. Keywords: early childhood education, social justice, quality, inequality
» Einzelbeitrag kostenlos herunterladen (Budrich Journals)




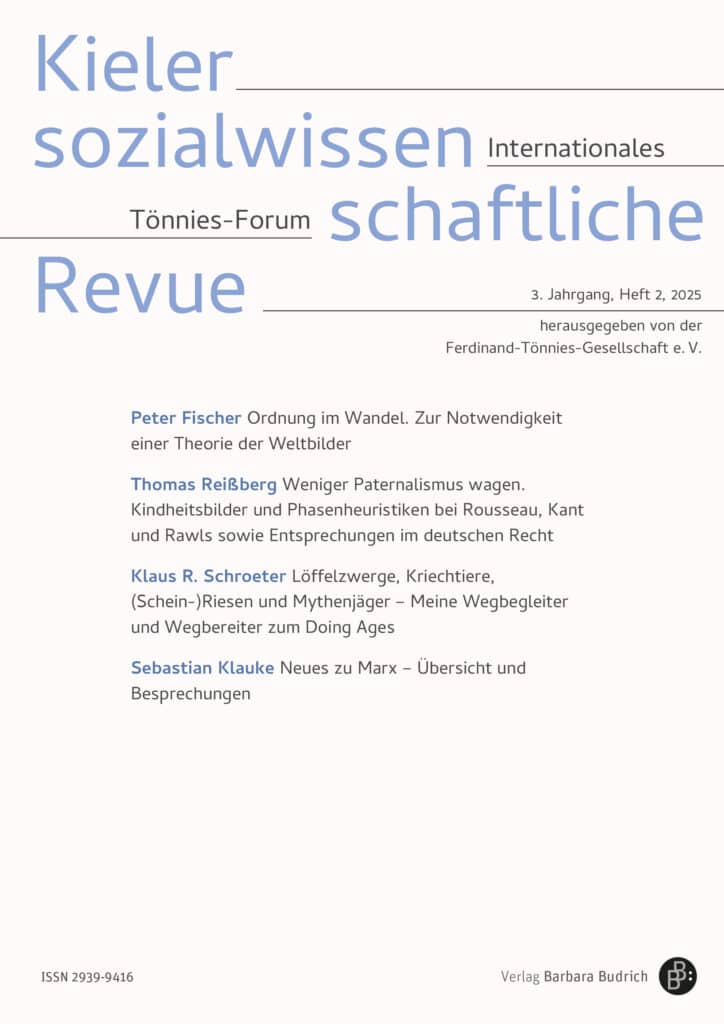
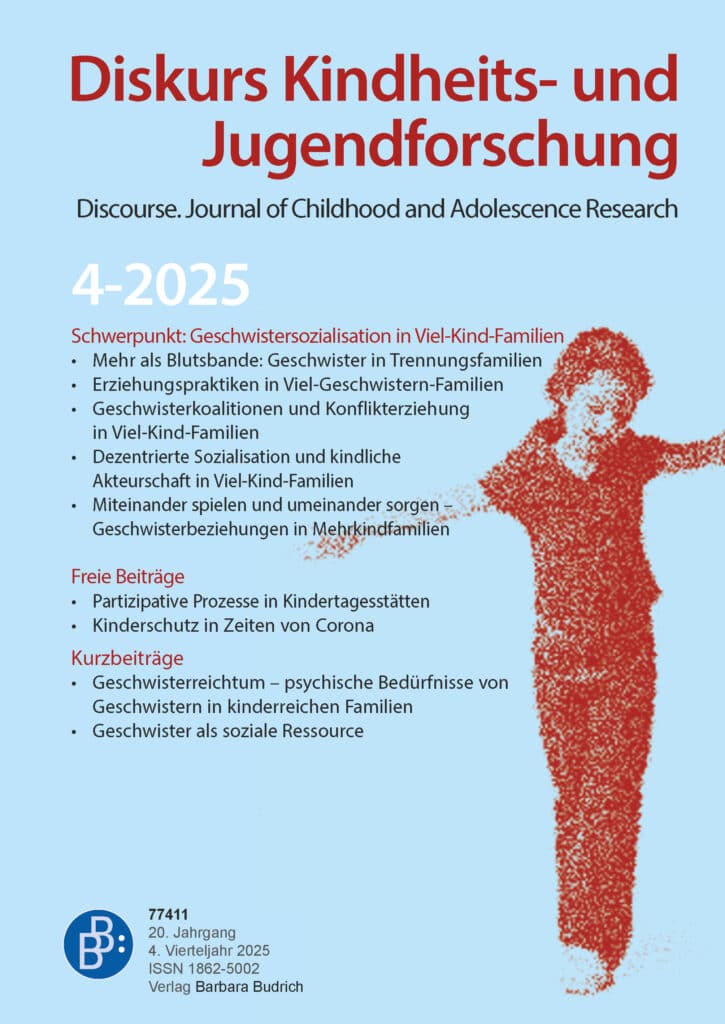
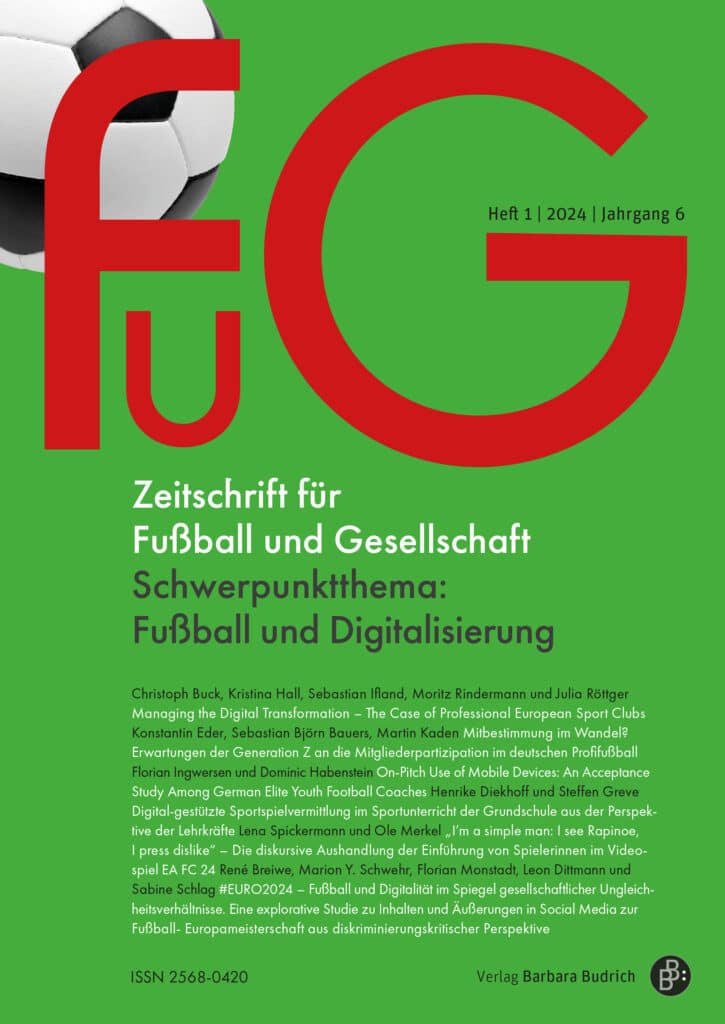



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.