Informationen zum Buch
Home » Publications » Politisches Lernen 3+4-2024 | Recht in der Politischen Bildung
Politisches Lernen 3+4-2024 | Recht in der Politischen Bildung
Erscheinungsdatum : 12.12.2024
15,00 € incl. VAT
- Beschreibung
- Bibliography
- Produktsicherheit
- Additional Content
- Bewertungen (0)
- Authors
- Tags
- Abstracts
Beschreibung
Politisches Lernen
3+4-2024: Recht in der Politischen Bildung
Themenschwerpunkt
Lea Caroline Jonas: Über das Verhältnis von Kritik- und Subsumtionskompetenz
Sascha Regier: Jetzt erst Recht?! Zur Notwendigkeit, die Ambivalenz des Rechts zwischen Herrschaft und Emanzipation in der Politischen Bildung zu thematisieren
Otto Böhm: Flucht, Migration und Menschenrechte – Zerreißproben in Bildungsräumen?
Sebstian Ihle: Rechtliches Lernen anhand von Narrationen
Dörte Kanschik: „Die haben ne Ausbildung und so dazu gemacht.“ – Herausforderungen der Thematisierung des Konzepts Rechtsstaat im Kontext von Polizeigewalt im inklusiven, rechtlich-politischen Unterricht
Diskussion
Luisa Girnus: Zur Bedeutung von Sprache und Sprachbildung im Politikunterricht vor dem Hintergrund der International Civic and Citizenship Education Study 2022
Clara Margull: Kompetenzförderung im bilingualen Geschichts- und Politikunterricht: Eine vergleichende Untersuchung
Cornelia Stiller / Thea Stroot / Manuela Köstner: Forschendes Lernen als Teilhabeform: Demokratieerfahrung in schulischen Kontexten
Christian Rusche: Wie weit ist die Europäische Union beim Klimaschutz?
Fachdidaktische Werkstatt
Stephan Benzmann: Rechtliche Bildung durch Fälle in der Schule
Kenan Holger Irmak: Projekttag „Seitenwechsel“: Diskussionen mit vertauschten Rollen
Hilde Schramm / Bettina Deutsch / Annette Courtis / Lars Limbach: „Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland“. Ein Bildungsprojekt von Respekt für Griechenland e. V.
DVPB NW aktuell
Kuno Rinke: Nachrichten aus dem Landesverband
Bettina Zurstrassen: An den Landtag Nordrhein-Westfalen
Karim Fereidooni: An den Landtag Nordrhein-Westfalen
Bettina Zurstrassen: Erneuter Vorstoß für ein Separatfach „Wirtschaft“?
Rezensionen
Rezensierte Bücher
Autorinnen und Autoren
Kuno Rinke: Rassismus neu denken
Annegret Ehmann: Entmythologisierung des Migrationsdiskurses
Wolf Kaiser: Der letzte Weg. Aufzeichnungen deutschsprachiger Juden
Antje Menn: Putin und die NATO-Osterweiterung – ein Erklärungsansatz für den Angriffskrieg?
Franziska Gräfenhan: Vom politikdidaktischen Nutzwert einer nuancierten Analyse gesellschaftlicher Verhärtungen
Franz Segbers: Reichtum rückverteilen!
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): pl.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den PL-Alert anmelden.
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 0937-2946 |
| eISSN | 2750-1965 |
| Volume | 42. Jahrgang 2024 |
| Edition | 3+4-2024 |
| Date of publication | 12.12.2024 |
| Scope | 72 Seiten |
| Language | Deutsch |
| Format | 21 x 29,7 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Additional Content
Autor*innen
KeywordsDezember 2024, Emanzipation, Europäische Union, Flucht, forschendes Lernen, Geschichtsunterricht, Griechenland, Herrschaft, International Civic and Citizenship Education Study 2022, Klimaschutz, Kritikkompetenz, Menschenrechte, Migration, Politikunterricht, politische Bildung, Polizeigewalt, Recht, rechtlich-politischen Unterricht, Rechtsstaat, Sprachbildung, Language, Subsumtionskompetenz, Wehrmachtsverbrechen
Abstracts
Über das Verhältnis von Kritik- und Subsumtionskompetenz. Eine Auseinandersetzung mit der Integration rechtswissenschaftlicher Perspektiven in eine kritische sozialwissenschaftliche Bildung (Lea Caroline Jonas )
Eine kritische sozialwissenschaftliche Bildung, die rechtswissenschaftlichen Inhalten Raum verschaffen möchte, muss neben einer Förderung von Kritikkompetenz auch Subsumtionskompetenz anregen. Um diese Überlegung zu begründen, wird zunächst ein Verständnis von Kritikkompetenz aus radikaldemokratischer Perspektive sowie von Subsumtionskompetenz darlegt. Aufbauend auf die theoretischen Ausführungen werden die Überlegungen am Beispiel Femizid als ein Gegenstand für eine juristische Unterrichtskonzeption im sozialwissenschaftlichen Unterricht in eine praktischere Perspektive überführt. Abschließend wird die Verhältnisbestimmung von Kritik- und Subsumtionskompetenz noch einmal in den Blick genommen.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Jetzt erst Recht?! Zur Notwendigkeit, die Ambivalenz des Rechts zwischen Herrschaft und Emanzipation in der Politischen Bildung zu thematisieren (Sascha Regier)
Der Aufsatz ist ein Plädoyer, warum für die Politische Bildung ein kritisches Rechtsverständnis notwendig ist. Recht darf nicht – wie es in der dominierenden Politikdidaktik erfolgt – als Institution des Gemeinwohls vermittelt werden, sondern muss in seiner Ambivalenz, sowohl Emanzipation zu ermöglichen als auch Herrschaft abzusichern, thematisiert werden.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Flucht, Migration und Menschenrechte – Zerreißproben in Bildungsräumen? (Otto Böhm)
Aktuell wird vielfach ein menschenrechtliches Einknicken in der Migrations- und Asylpolitik festgestellt. Auch in der Menschenrechtsbildung sollten nicht einfach die politischen Notwendigkeiten der Migrationskontrolle hingenommen werden. Aber ein aufrechtes Verteidigen universeller Normen ohne Vermittlung mit der öffentlichen Diskussion reicht auch nicht aus. Anlässlich eines Nürnberger Bildungsprojekts sollen normative und didaktische Gesichtspunkte der Menschenrechtsgarantien reflektiert werden.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Rechtliches Lernen anhand von Narrationen (Sebstian Ihle)
Der Beitrag stellt eine Möglichkeit vor, wie rechtliche Inhalte in den Politikunterricht integriert werden können. Ausgangspunkt sind die Ausführungen Ingo Juchlers zum narrativen Ansatz der politischen Bildung. Der Text fasst zunächst überblicksartig Ziele rechtlichen Lernens zusammen, bevor die Potenziale von Narrationen für das politische Lernen sowie Aspekte der unterrichtlichen Umsetzung erläutert werden. Vor diesem Hintergrund wird exemplarisch dargestellt, auf welche Weise Ferdinand von Schirachs Theaterstück GOTT zum rechtlichen Lernen im Politikunterricht herangezogen werden kann.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„Die haben ne Ausbildung und so dazu gemacht.“ – Herausforderungen der Thematisierung des Konzepts Rechtsstaat im Kontext von Polizeigewalt im inklusiven, rechtlich-politischen Unterricht (Dörte Kanschik)
Nachfolgend werden Teilbefunde einer Studie zu Vorstellungen von Jugendlichen zu Aspekten von Recht und Gesetz vorgestellt, die zeigen, wie ein Fall von potenzieller Polizeigewalt ausgehandelt wird. Die Befunde lassen Rückschlüsse auf Herausforderungen zu, das Konzept Rechtsstaat in diesem Kontext im Unterricht zu thematisieren. Auch zeigen sich in der Verknüpfung mit dem Fallprinzip Potenziale für rechtlich-politisches Lernen.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Zur Bedeutung von Sprache und Sprachbildung im Politikunterricht vor dem Hintergrund der International Civic and Citizenship Education Study 2022 (Luisa Girnus)
Politik ist in hohem Maße sprachbasiert, vom politischen Diskurs bis zu politischen Produkten wie Gesetzestexten, Verordnungen etc. Mit ihrer multifunktionalen Bedeutung kann Sprache gar als Grundlage von Politik bezeichnet werden. Ebenso folgt aus dem sprachbasierten Wesen von Politik eine hohe Relevanz von Sprache in der politischen Bildung. Das jedoch nicht nur in Bezug auf den politischen Kern des Faches: Sprachliche Fähigkeiten beeinflussen den Bildungserfolg und können soziale Ungleichheiten verstärken. In diesem Sinne zeigt auch die International Civic and Citizenship Education Study 2022 , dass politische und sprachliche Kompetenzen eng miteinander verbunden sind.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Kompetenzförderung im bilingualen Geschichts- und Politikunterricht: Eine vergleichende Untersuchung (Clara Margull)
Bei der Vermittlung historischer und politischer Inhalte spielt Sprache eine entscheidende Rolle: Die beiden Fächer Geschichte und Politik sind durch einen hohen Diskussionsanteil geprägt und verfolgen das Ziel der Ausbildung mündiger Bürger:innen. Dieser Beitrag rückt das Spannungsfeld zwischen Fachlichkeit und Sprachförderung im bilingualen Geschichts- und Politikunterricht in den Vordergrund. Es werden die Ergebnisse einer Masterarbeit vorgestellt, die untersucht, inwieweit die Domänenspezifität der beiden Fächer im bilingualen Unterricht trotz Sprachbarrieren erhalten bleibt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der narrativen Kompetenz im Geschichtsunterricht und der Urteilskompetenz im Politikunterricht.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Forschendes Lernen als Teilhabeform: Demokratieerfahrung in schulischen Kontexten (Cornelia Stiller, Thea Stroot und Manuela Köstner)
Dieser Beitrag fokussiert Forschendes Lernen im Zusammenhang mit Demokratiebildung. Dazu wurden im Rahmen eines Projektes am Oberstufen-Kolleg Bielefeld Konzepte zum Forschenden Lernen im Kontext von Schulentwicklung entwickelt und umgesetzt. Zwei dieser Kursbeispiele werden zunächst beschrieben. Anschließend werden Ergebnisse einer Teilstudie aus dem Projekt berichtet, die sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern für Kollegiat*innen Partizipation an ihrer Schule bzw. an Schulentwicklung und diesbezüglich speziell Forschendes Lernen relevant ist. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Ansätze Forschendes Lernens für die Politische Bildung von Relevanz sein können, wenn diese direkt auf Partizipation abzielen. Allerdings erscheint es notwendig über veränderte Formen der Leistungsbewertung nachzudenken.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Wie weit ist die Europäische Union beim Klimaschutz? (Christian Rusche)
Die Europäische Union (EU) hat sich mit dem Green Deal ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt. So will die EU bis 2050 alle Treibhausgasemissionen vermeiden. Deutschland strebt dieses Ziel bis 2045 an. Im Jahr 2022 hatte die EU ihre Emissionen im Vergleich zu 1990 jedoch nur um rund 27 % gesenkt, in Deutschland waren es rund 36 %. Zur Erreichung der Ziele müssen die Anstrengungen somit verstärkt werden. Die aktuellen Wahlen zum Europäischen Parlament und zur Kommissionspräsidentin deuten eher auf das Gegenteil hin.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Rechtliche Bildung durch Fälle in der Schule (Stephan Benzmann)
Anhand eines Unterrichtsmaterials werden in diesem Artikel exemplarisch Chancen und Herausforderung rechtlicher Bildung als Teil sozialwissenschaftlicher Bildung diskutiert. Dabei wird ein Modell entfaltet und genutzt, mit dem rechtskundliches Wissen fachdidaktisch differenziert und ausgewählt werden kann.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Projekttag „Seitenwechsel“: Diskussionen mit vertauschten Rollen (Kenan Holger Irmak)
Es wird ein Format für einen Projekttag vorgestellt, das Demokratiebildung anbahnen sollte. Politikerinnen und Politiker wurden darin gebeten, im Vorfeld Fragen an die Schülerinnen und Schüler zu formulieren. Durch diesen „Seitenwechsel“ wurden letztere befähigt, Position zu beziehen, indem sie sich kritisch mit den Wahlprogrammen auseinandersetzten und selbst Ideen sowie Wünsche an die Politik herantrugen, um diese mit den Gästen zu erörtern. Über mehrere Wochen hinweg wurden die Schülerinnen und Schüler vorbereitet, um mit den Gästen sachorientiert und auf Augenhöhe diskutieren zu können. Hierzu bedurfte es einer Reihe von organisatorischen, methodischen und didaktischen Entscheidungen, die im Folgenden erläutert werden.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland“. Ein Bildungsprojekt von Respekt für Griechenland e. V. (Hilde Schramm, Bettina Deutsch, Annette Courtis und Lars Limbach)
Durch die Kontroversen um die Sparpolitik der EU unter der Syriza Regierung nahm ab 2015 das politische Interesse an Griechenland zu. Die neue Aufmerksamkeit holte aber auch den verdrängten Besatzungsterror des faschistischen Deutschlands aus der Versenkung. Respekt für Griechenland e. V. (RfG) möchte durch Bildungsarbeit mit dem Film „Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland“ die Lücke im kollektiven Gedächtnis verringern. Im Beitrag werden die Entstehung des Bildungsprojektes sowie Beispiele aus der pädagogischen Praxis und das Bildungsmaterial vorgestellt.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Beschreibung
Beschreibung
Politisches Lernen
3+4-2024: Recht in der Politischen Bildung
Themenschwerpunkt
Lea Caroline Jonas: Über das Verhältnis von Kritik- und Subsumtionskompetenz
Sascha Regier: Jetzt erst Recht?! Zur Notwendigkeit, die Ambivalenz des Rechts zwischen Herrschaft und Emanzipation in der Politischen Bildung zu thematisieren
Otto Böhm: Flucht, Migration und Menschenrechte – Zerreißproben in Bildungsräumen?
Sebstian Ihle: Rechtliches Lernen anhand von Narrationen
Dörte Kanschik: „Die haben ne Ausbildung und so dazu gemacht.“ – Herausforderungen der Thematisierung des Konzepts Rechtsstaat im Kontext von Polizeigewalt im inklusiven, rechtlich-politischen Unterricht
Diskussion
Luisa Girnus: Zur Bedeutung von Sprache und Sprachbildung im Politikunterricht vor dem Hintergrund der International Civic and Citizenship Education Study 2022
Clara Margull: Kompetenzförderung im bilingualen Geschichts- und Politikunterricht: Eine vergleichende Untersuchung
Cornelia Stiller / Thea Stroot / Manuela Köstner: Forschendes Lernen als Teilhabeform: Demokratieerfahrung in schulischen Kontexten
Christian Rusche: Wie weit ist die Europäische Union beim Klimaschutz?
Fachdidaktische Werkstatt
Stephan Benzmann: Rechtliche Bildung durch Fälle in der Schule
Kenan Holger Irmak: Projekttag „Seitenwechsel“: Diskussionen mit vertauschten Rollen
Hilde Schramm / Bettina Deutsch / Annette Courtis / Lars Limbach: „Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland“. Ein Bildungsprojekt von Respekt für Griechenland e. V.
DVPB NW aktuell
Kuno Rinke: Nachrichten aus dem Landesverband
Bettina Zurstrassen: An den Landtag Nordrhein-Westfalen
Karim Fereidooni: An den Landtag Nordrhein-Westfalen
Bettina Zurstrassen: Erneuter Vorstoß für ein Separatfach „Wirtschaft“?
Rezensionen
Rezensierte Bücher
Autorinnen und Autoren
Kuno Rinke: Rassismus neu denken
Annegret Ehmann: Entmythologisierung des Migrationsdiskurses
Wolf Kaiser: Der letzte Weg. Aufzeichnungen deutschsprachiger Juden
Antje Menn: Putin und die NATO-Osterweiterung – ein Erklärungsansatz für den Angriffskrieg?
Franziska Gräfenhan: Vom politikdidaktischen Nutzwert einer nuancierten Analyse gesellschaftlicher Verhärtungen
Franz Segbers: Reichtum rückverteilen!
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): pl.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den PL-Alert anmelden.
Bibliography
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 0937-2946 |
| eISSN | 2750-1965 |
| Volume | 42. Jahrgang 2024 |
| Edition | 3+4-2024 |
| Date of publication | 12.12.2024 |
| Scope | 72 Seiten |
| Language | Deutsch |
| Format | 21 x 29,7 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Produktsicherheit
Additional Content
Additional Content
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Authors
Autor*innen
Tags
KeywordsDezember 2024, Emanzipation, Europäische Union, Flucht, forschendes Lernen, Geschichtsunterricht, Griechenland, Herrschaft, International Civic and Citizenship Education Study 2022, Klimaschutz, Kritikkompetenz, Menschenrechte, Migration, Politikunterricht, politische Bildung, Polizeigewalt, Recht, rechtlich-politischen Unterricht, Rechtsstaat, Sprachbildung, Language, Subsumtionskompetenz, Wehrmachtsverbrechen
Abstracts
Abstracts
Über das Verhältnis von Kritik- und Subsumtionskompetenz. Eine Auseinandersetzung mit der Integration rechtswissenschaftlicher Perspektiven in eine kritische sozialwissenschaftliche Bildung (Lea Caroline Jonas )
Eine kritische sozialwissenschaftliche Bildung, die rechtswissenschaftlichen Inhalten Raum verschaffen möchte, muss neben einer Förderung von Kritikkompetenz auch Subsumtionskompetenz anregen. Um diese Überlegung zu begründen, wird zunächst ein Verständnis von Kritikkompetenz aus radikaldemokratischer Perspektive sowie von Subsumtionskompetenz darlegt. Aufbauend auf die theoretischen Ausführungen werden die Überlegungen am Beispiel Femizid als ein Gegenstand für eine juristische Unterrichtskonzeption im sozialwissenschaftlichen Unterricht in eine praktischere Perspektive überführt. Abschließend wird die Verhältnisbestimmung von Kritik- und Subsumtionskompetenz noch einmal in den Blick genommen.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Jetzt erst Recht?! Zur Notwendigkeit, die Ambivalenz des Rechts zwischen Herrschaft und Emanzipation in der Politischen Bildung zu thematisieren (Sascha Regier)
Der Aufsatz ist ein Plädoyer, warum für die Politische Bildung ein kritisches Rechtsverständnis notwendig ist. Recht darf nicht – wie es in der dominierenden Politikdidaktik erfolgt – als Institution des Gemeinwohls vermittelt werden, sondern muss in seiner Ambivalenz, sowohl Emanzipation zu ermöglichen als auch Herrschaft abzusichern, thematisiert werden.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Flucht, Migration und Menschenrechte – Zerreißproben in Bildungsräumen? (Otto Böhm)
Aktuell wird vielfach ein menschenrechtliches Einknicken in der Migrations- und Asylpolitik festgestellt. Auch in der Menschenrechtsbildung sollten nicht einfach die politischen Notwendigkeiten der Migrationskontrolle hingenommen werden. Aber ein aufrechtes Verteidigen universeller Normen ohne Vermittlung mit der öffentlichen Diskussion reicht auch nicht aus. Anlässlich eines Nürnberger Bildungsprojekts sollen normative und didaktische Gesichtspunkte der Menschenrechtsgarantien reflektiert werden.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Rechtliches Lernen anhand von Narrationen (Sebstian Ihle)
Der Beitrag stellt eine Möglichkeit vor, wie rechtliche Inhalte in den Politikunterricht integriert werden können. Ausgangspunkt sind die Ausführungen Ingo Juchlers zum narrativen Ansatz der politischen Bildung. Der Text fasst zunächst überblicksartig Ziele rechtlichen Lernens zusammen, bevor die Potenziale von Narrationen für das politische Lernen sowie Aspekte der unterrichtlichen Umsetzung erläutert werden. Vor diesem Hintergrund wird exemplarisch dargestellt, auf welche Weise Ferdinand von Schirachs Theaterstück GOTT zum rechtlichen Lernen im Politikunterricht herangezogen werden kann.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„Die haben ne Ausbildung und so dazu gemacht.“ – Herausforderungen der Thematisierung des Konzepts Rechtsstaat im Kontext von Polizeigewalt im inklusiven, rechtlich-politischen Unterricht (Dörte Kanschik)
Nachfolgend werden Teilbefunde einer Studie zu Vorstellungen von Jugendlichen zu Aspekten von Recht und Gesetz vorgestellt, die zeigen, wie ein Fall von potenzieller Polizeigewalt ausgehandelt wird. Die Befunde lassen Rückschlüsse auf Herausforderungen zu, das Konzept Rechtsstaat in diesem Kontext im Unterricht zu thematisieren. Auch zeigen sich in der Verknüpfung mit dem Fallprinzip Potenziale für rechtlich-politisches Lernen.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Zur Bedeutung von Sprache und Sprachbildung im Politikunterricht vor dem Hintergrund der International Civic and Citizenship Education Study 2022 (Luisa Girnus)
Politik ist in hohem Maße sprachbasiert, vom politischen Diskurs bis zu politischen Produkten wie Gesetzestexten, Verordnungen etc. Mit ihrer multifunktionalen Bedeutung kann Sprache gar als Grundlage von Politik bezeichnet werden. Ebenso folgt aus dem sprachbasierten Wesen von Politik eine hohe Relevanz von Sprache in der politischen Bildung. Das jedoch nicht nur in Bezug auf den politischen Kern des Faches: Sprachliche Fähigkeiten beeinflussen den Bildungserfolg und können soziale Ungleichheiten verstärken. In diesem Sinne zeigt auch die International Civic and Citizenship Education Study 2022 , dass politische und sprachliche Kompetenzen eng miteinander verbunden sind.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Kompetenzförderung im bilingualen Geschichts- und Politikunterricht: Eine vergleichende Untersuchung (Clara Margull)
Bei der Vermittlung historischer und politischer Inhalte spielt Sprache eine entscheidende Rolle: Die beiden Fächer Geschichte und Politik sind durch einen hohen Diskussionsanteil geprägt und verfolgen das Ziel der Ausbildung mündiger Bürger:innen. Dieser Beitrag rückt das Spannungsfeld zwischen Fachlichkeit und Sprachförderung im bilingualen Geschichts- und Politikunterricht in den Vordergrund. Es werden die Ergebnisse einer Masterarbeit vorgestellt, die untersucht, inwieweit die Domänenspezifität der beiden Fächer im bilingualen Unterricht trotz Sprachbarrieren erhalten bleibt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der narrativen Kompetenz im Geschichtsunterricht und der Urteilskompetenz im Politikunterricht.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Forschendes Lernen als Teilhabeform: Demokratieerfahrung in schulischen Kontexten (Cornelia Stiller, Thea Stroot und Manuela Köstner)
Dieser Beitrag fokussiert Forschendes Lernen im Zusammenhang mit Demokratiebildung. Dazu wurden im Rahmen eines Projektes am Oberstufen-Kolleg Bielefeld Konzepte zum Forschenden Lernen im Kontext von Schulentwicklung entwickelt und umgesetzt. Zwei dieser Kursbeispiele werden zunächst beschrieben. Anschließend werden Ergebnisse einer Teilstudie aus dem Projekt berichtet, die sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern für Kollegiat*innen Partizipation an ihrer Schule bzw. an Schulentwicklung und diesbezüglich speziell Forschendes Lernen relevant ist. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Ansätze Forschendes Lernens für die Politische Bildung von Relevanz sein können, wenn diese direkt auf Partizipation abzielen. Allerdings erscheint es notwendig über veränderte Formen der Leistungsbewertung nachzudenken.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Wie weit ist die Europäische Union beim Klimaschutz? (Christian Rusche)
Die Europäische Union (EU) hat sich mit dem Green Deal ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt. So will die EU bis 2050 alle Treibhausgasemissionen vermeiden. Deutschland strebt dieses Ziel bis 2045 an. Im Jahr 2022 hatte die EU ihre Emissionen im Vergleich zu 1990 jedoch nur um rund 27 % gesenkt, in Deutschland waren es rund 36 %. Zur Erreichung der Ziele müssen die Anstrengungen somit verstärkt werden. Die aktuellen Wahlen zum Europäischen Parlament und zur Kommissionspräsidentin deuten eher auf das Gegenteil hin.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Rechtliche Bildung durch Fälle in der Schule (Stephan Benzmann)
Anhand eines Unterrichtsmaterials werden in diesem Artikel exemplarisch Chancen und Herausforderung rechtlicher Bildung als Teil sozialwissenschaftlicher Bildung diskutiert. Dabei wird ein Modell entfaltet und genutzt, mit dem rechtskundliches Wissen fachdidaktisch differenziert und ausgewählt werden kann.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Projekttag „Seitenwechsel“: Diskussionen mit vertauschten Rollen (Kenan Holger Irmak)
Es wird ein Format für einen Projekttag vorgestellt, das Demokratiebildung anbahnen sollte. Politikerinnen und Politiker wurden darin gebeten, im Vorfeld Fragen an die Schülerinnen und Schüler zu formulieren. Durch diesen „Seitenwechsel“ wurden letztere befähigt, Position zu beziehen, indem sie sich kritisch mit den Wahlprogrammen auseinandersetzten und selbst Ideen sowie Wünsche an die Politik herantrugen, um diese mit den Gästen zu erörtern. Über mehrere Wochen hinweg wurden die Schülerinnen und Schüler vorbereitet, um mit den Gästen sachorientiert und auf Augenhöhe diskutieren zu können. Hierzu bedurfte es einer Reihe von organisatorischen, methodischen und didaktischen Entscheidungen, die im Folgenden erläutert werden.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
„Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland“. Ein Bildungsprojekt von Respekt für Griechenland e. V. (Hilde Schramm, Bettina Deutsch, Annette Courtis und Lars Limbach)
Durch die Kontroversen um die Sparpolitik der EU unter der Syriza Regierung nahm ab 2015 das politische Interesse an Griechenland zu. Die neue Aufmerksamkeit holte aber auch den verdrängten Besatzungsterror des faschistischen Deutschlands aus der Versenkung. Respekt für Griechenland e. V. (RfG) möchte durch Bildungsarbeit mit dem Film „Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland“ die Lücke im kollektiven Gedächtnis verringern. Im Beitrag werden die Entstehung des Bildungsprojektes sowie Beispiele aus der pädagogischen Praxis und das Bildungsmaterial vorgestellt.
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
This might also be of interest to you:
Verlag Barbara Budrich
- +49 (0)2171.79491-50
- info@budrich.de
-
Stauffenbergstr. 7
51379 Leverkusen
Germany





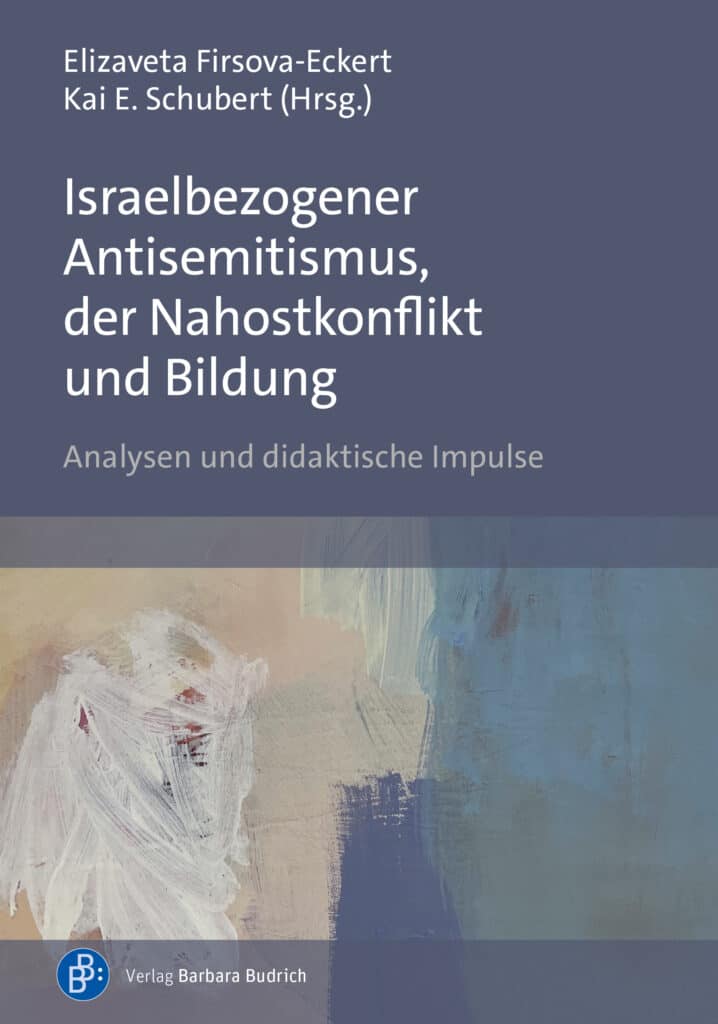
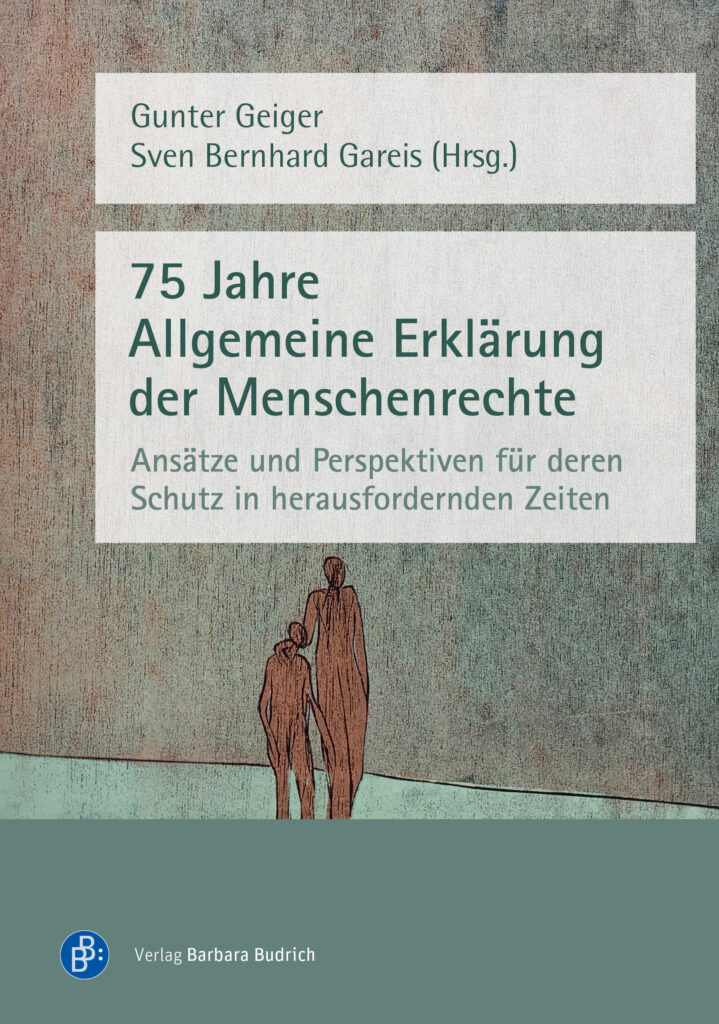
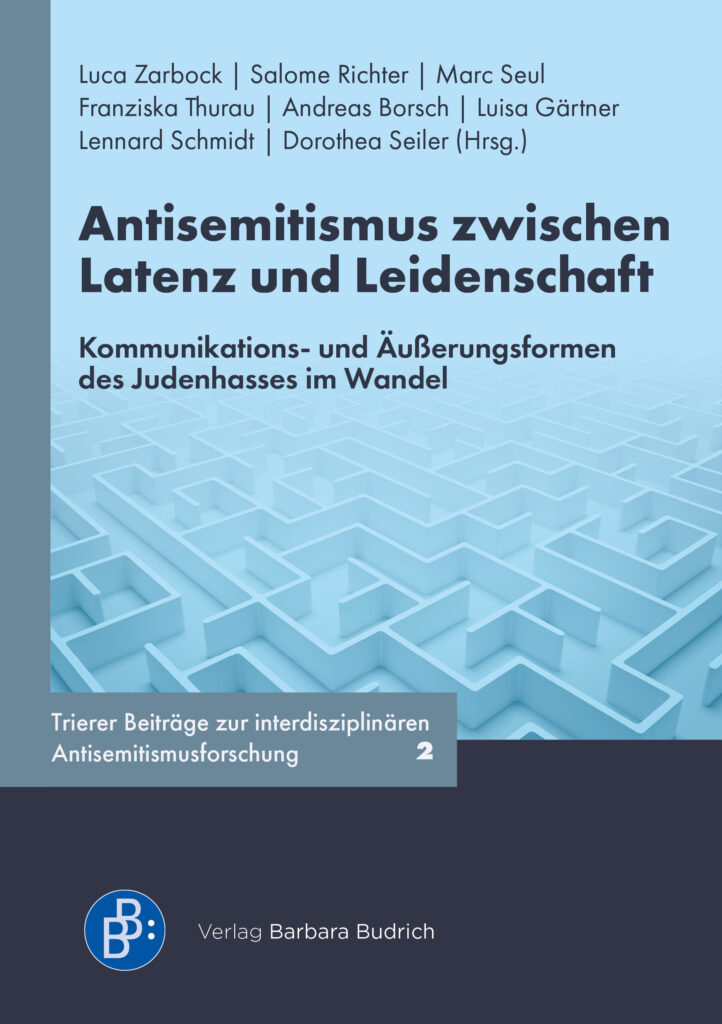


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.