ZISU 13 (2024) | Digitale Technologien als eigensinnige Akteure der Transformation von und im Unterricht
Erscheinungsdatum : 11.06.2024
27,00 € incl. VAT
Content
ZISU – Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung
Heft 13 (2024): Digitale Technologien als eigensinnige Akteure der Transformation von und im Unterricht
hrsg. von: Matthias Proske, Kerstin Rabenstein & Oliver Reis
Editorial
Matthias Proske / Kerstin Rabenstein / Oliver Reis: Digitale Technologien als eigensinnige Akteure der Transformation von und im Unterricht
Thementeil
Jochen Lange / Farah Brandt: Avatare im Unterricht. Zum performativen Vollzug von Zeigepraktiken mit Telepräsenzrobotern in der Grundschule
Laura Lehnhoff: Praktiken des Filmens und Gefilmtwerdens im Sportunterricht
Olga Neuberger: Unsichtbares sichtbar machen. Zur Praxis der Repräsentation mittels (digitaler) Visualisierungen an Erinnerungsorten
Marion Yvonne Schwehr: Lernen und Lehren zwischen Realität und Virtualität: Zur räumlichen Dimension von Unterricht mit digitalen Medien
Barbara Asbrand / Katharina Kanz / Laura Hentschke: Das abwesende Klassenzimmer: Zur Transformation der Unterrichtsinteraktion in der Digitalität
Hannes König / Richard Lischka-Schmidt: Die Ausweitung der Grauzone: Eine vergleichende Untersuchung zur Reproduktion und Transformation der Interaktionsstrukturen von Unterricht und Lehre im Zuge ihrer pandemiebedingten Digitalisierung
Isabel Neto Carvalho / Mandy Schiefner-Rohs: Digitale Artefakte als widerständige Akteure des Unterrichts
Allgemeiner Teil
Judith Küper: Missglückte Distanzierung? Praktische pädagogische Reflexion als theoriefähiges Phänomen in Relation zum dominanten Reflexionsideal im Lehrerbildungsdiskurs
Bernhard Müllner / Christine Heidinger / Lisa Hammerschmid / Martin Scheuch / Andrea Möller: Kognitive Prozesse beim Schreiben naturwissenschaftlicher Versuchsprotokolle: Eine explorative Studie zum sprachsensiblen Fachunterricht
Rezensionen
Onur Aksünger: Straehler-Pohl, Hauke (2023): Lehrer:innen im ‚Brennpunkt‘. Gespräche über Herausforderungen, Bewältigungsstrategien und Dilemmata des Schulalltags. Bielefeld: transcript, 326 Seiten
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Leseproben
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zisu.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZISU-Alert anmelden.
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 2191-3560 |
| eISSN | 2195-2671 |
| ISBN | 978-3-8474-3093-3 |
| Volume | 13. Jahrgang 2024 |
| Edition | 13 (2024) |
| Date of publication | 11.06.2024 |
| Scope | 164 Seiten |
| Language | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Autor*innen
Schlagwörteraußerschulischer Lernort, Bilder, Corona-Pandemie, Covid-19-Pandemie, digitale Medien, digitale Transformation, Digitalisierung, Distanzunterricht, dokumentarische Methode, Ethnographie, Eye-Viewing, Filmaufnahmen, Gesprächsanalyse, Grundschule, Interaktion, Lehre, Lehrerbildung, Medienkonstellationen, NS-Gedenkstätte, Praktiken, Praxistheorie, Professionalisierung, Raumsoziologie, Reflexion, Reflexivität, Rundgang, Schule, Sportunterricht, Struktur, Technologie, Telepräsenzroboter, Transformation, Unterricht, Unterrichtsentwicklung, Unterrichtsforschung, Unterrichtspraxis, Unterrichtsvorbereitung, Videographie, Videokonferenz, Virtual Reality, Zeigen
Abstracts
Avatare im Unterricht. Zum performativen Vollzug von Zeigepraktiken mit Telepräsenzrobotern in der Grundschule (Jochen Lange, Farah Brandt)
Der Beitrag fokussiert das transformatorische Potenzial von digitalen Unterrichtstechnologien, indem der Einsatz von Telepräsenzrobotern – die neue Formen des unterrichtlichen ‚Da-Seins‘ versprechen – ethnographisch auf das Wie seines Vollzugs befragt wird: Wie wird Unterricht in der Grundschule mit Schüler*innen performativ prozessiert, die zwar über eine körperliche Präsenz im (Klassen-)Raum verfügen, aber dennoch zuhause sind? Mit den empirisch noch wenig beachteten Hardware-Avataren wird ein Zeigen beobachtet, anhand dessen Praktiken des unterrichtlichen Wahrnehmbarmachens als ein verteiltes – digital erweitertes – Netzwerkgeschehen analysiert werden. Zugleich und im Kontrast wird sichtbar, wie es zum Aufrufen einer zunehmend inkompatibel erscheinenden Unterrichtsordnung kommt, die z. B. bemüht ist, Leistungen und verbundene Agency einzelnen Individuen zuzurechnen. Dabei erfahren die einhergehenden Praktiken eine Bedeutungsaktualisierung im Kontakt mit dem Digitalen, etwa dann, wenn es im Zuge von Aufgaben bzw. Fragen der Lehrperson eher dem Anschein nach um ein prüfendes Wissenzeigen geht und dieses vielmehr als Vehikel zur situativ-demonstrativen Einübung bzw. Exemplifizierung der unterrichtlichen Funktionsordnung unter erschwerten Bedingungen nutzbar gemacht wird: Der Kontrast zwischen dem Neuen und dem Alten wird zur hervorhebenden Konturierung des Tradierten genutzt. Schlagwörter: Ethnographie, Telepräsenzroboter, Zeigen, digitale Medien, Grundschule, Unterrichtspraxis
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Praktiken des Filmens und Gefilmtwerdens im Sportunterricht (Laura Lehnhoff)
Der sportpädagogische Diskurs um digitale Medien vollzieht sich in weiten Teilen auf Grundlage eines simplifizierten Medienbegriffs. Demzufolge werden digitale Medien als ‚neutrale‘ Werkzeuge im Sportunterricht eingesetzt, in der Annahme, dass sie Unterrichtsprozesse unterstützen, in Teilen erleichtern und schließlich optimieren. Vernachlässigt wird dabei die Tatsache, dass digitale Medien als meist nicht wahrgenommene Akteure wirksam werden. Der vorliegende Beitrag nimmt am Beispiel des Filmens und Gefilmtwerdens im Sportunterricht das Zusammenspiel von Materialitäten, Inhalten, Praktiken und Wissensordnungen sowie Subjektpositionen in den Blick. Auf der Grundlage eines medienwissenschaftlichen Modells wird anhand von Fallbeispielen veranschaulicht, wie Schüler*innen als Subjekte des medialisierten Sportunterrichts positioniert werden bzw. sich in diesem Zusammenspiel zueinander sowie zu den Anforderungen und Spielräumen der Unterrichtspraxis positionieren. Auf diese Weise kann gezeigt werden, dass digitale Technologien im Sportunterricht wesentlich an Subjektpositionierungen und Bedeutungsaushandlungen mitwirken. Schlagwörter: Sportunterricht, Medienkonstellationen, Filmaufnahmen, Praktiken
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Unsichtbares sichtbar machen. Zur Praxis der Repräsentation mittels (digitaler) Visualisierungen an Erinnerungsorten (Olga Neuberger)
Der Beitrag widmet sich der Praxis der Repräsentation in Rundgängen an einem Erinnerungsort. Vor dem Hintergrund des pädagogisch zu bearbeitenden Handlungsproblems der Sicht- und Unsichtbarkeit von Vergangenheit wird entlang von dichten Beschreibungen zweier Situationen herausgearbeitet, dass es zu einer Synchronisierung verschiedener Zeitschichten kommt. Unsichtbares aus der Vergangenheit wird dabei in Form von (digitalen) Bildern materialisiert und in ein Verhältnis zum lokalen Standort gesetzt. Die Materialisierung von Unsichtbarem hat im Fall der digitalen Raumbilder einen Anteil daran, dass die Repräsentationspraxis der Logik der Simulation folgt, sodass es zu einer räumlichen Verortung in der vergangenen Zukunft kommt. Schlagwörter: Außerschulischer Lernort, Rundgang, NS-Gedenkstätte, Zeigen, Bilder, Virtual Reality, Ethnographie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Lernen und Lehren zwischen Realität und Virtualität: Zur räumlichen Dimension von Unterricht mit digitalen Medien (Marion Yvonne Schwehr)
Während sich virtuelle Erlebnisse in der Alltagswelt von Jugendlichen immer weiter etablieren, wissen wir bislang noch wenig darüber, welche Bedeutung digitale Medien (raumbezogen) für die Unterrichtsorganisation haben. Die Verflechtung von Raum, Bildung und Digitalität führt zu der Frage, welchen Einfluss digitale Medien auf die unterrichtliche Organisation haben. Ziel des Beitrags ist es, anhand rekonstruktiver Analysen von ethnographischen Beobachtungen darzulegen, wie mit digitalen Medien gelernt wird und welche (Lern-)Räume durch das Handeln der Akteur*innen im Unterricht entstehen. Fokussiert werden die Perspektiven der beteiligten Akteur*innen und die Strukturiertheit der Räume. Eine theoretische Rahmung bieten raumsoziologische Bezugnahmen. Diese werden genutzt, um aufzuzeigen, welchen räumlichen Bedingungen das Handeln der Akteur*innen innerhalb des Unterrichts mit digitalen Medien unterliegt und welche Räume sie durch ihr Handeln konstituieren. Präsentiert werden unterrichtliche Situationen, die von Synchronität gekennzeichnet sind und solche, die komplett darauf verzichten. Schlagwörter: Digitalisierung, Raumsoziologie, Unterrichtsentwicklung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Das abwesende Klassenzimmer: Zur Transformation der Unterrichtsinteraktion in der Digitalität (Barbara Asbrand, Katharina Kanz, Laura Hentschke)
Der Beitrag stellt die dokumentarische Interpretation von digitalem Distanzunterricht vor, der während der Corona-Pandemie in Form von Videokonferenzen durchgeführt wurde. Im kontrastierenden Fallvergleich mit Präsenzunterricht desselben Lehrers im selben Fach, der vor der Pandemie videografiert wurde, können Veränderungen des Unterrichts rekonstruiert werden, die auf das digitale Format zurückgeführt werden können. Es zeigt sich, dass nicht der Orientierungsrahmen des Lehrers, sondern der an das Videokonferenzsystem delegierte Kommunikationsmodus sowohl die Lehrer-Schüler*innen-Interaktion und die Art und Weise der Auseinandersetzung mit den fachlichen Inhalten bestimmt. Schlagwörter: Corona-Pandemie, Distanzunterricht, Videokonferenz, Unterrichtsforschung, Dokumentarische Methode
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Ausweitung der Grauzone: Eine vergleichende Untersuchung zur Reproduktion und Transformation der Interaktionsstrukturen von Unterricht und Lehre im Zuge ihrer pandemiebedingten Digitalisierung (Hannes König, Richard Lischka-Schmidt)
Der Beitrag untersucht aus einer strukturtheoretischen Perspektive vergleichend die Differenzen und Gemeinsamkeiten von Online- und Offline-Interaktion im Grundschulunterricht und in der Hochschullehre. Es zeigt sich zum einen eine Reproduktion der Strukturen sogar über den Vergleich der recht differenten Institutionen Hoch- und Grundschule hinweg, zum anderen eine übergreifende Form der Irritation dieser Strukturen, die wir als ‚Ausweitung der Grauzone‘ bezeichnen. Abschließend werden vorliegende gegenläufige Befunde und normative Forderungen einer Transformation im Zuge der Digitalisierung zum Ergebnis unserer Untersuchung relationiert und mithin relativiert. Schlagwörter: Unterricht, Lehre, Digitalisierung, Distanzunterricht, Interaktion, Struktur, Transformation, COVID-19-Pandemie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Digitale Artefakte als widerständige Akteure des Unterrichts (Isabel Neto Carvalho, Mandy Schiefner-Rohs)
In der erziehungs-, medien- und kulturwissenschaftlichen Forschung besteht Einigkeit darüber, dass digitale Medien Schul- und Unterrichtskulturen beeinflussen. Oft bleibt jedoch unklar, woran dies empirisch festgemacht werden kann. Der Beitrag widmet sich der Frage, wie digitale Artefakte als ‚Mitspieler‘ des Unterrichts auftreten. Ein ethnographisches Forschungsprojekt rekonstruiert Praktiken des Medienhandelns von Lehrerpersonen. In den Analysen zeigen sich digitale Artefakte als eigensinnige und widerständige Akteure. Diese Widerständigkeit wird weniger in der sozio-medialen bzw. -materiellen Praxis des klassenöffentlichen Unterrichts, sondern eher vorgelagert in Praktiken der Unterrichtsvorbereitung empirisch sichtbar. Unter dieser Perspektive wird u.a. die Handlungsmacht digitaler Medien in schulischen Praktiken reflektiert. Schlagwörter: Digitalisierung, Schule, Unterrichtsvorbereitung, Praxistheorie, Videographie, Eye-Viewing
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Missglückte Distanzierung? Praktische pädagogische Reflexion als theoriefähiges Phänomen in Relation zum dominanten Reflexionsideal im Lehrerbildungsdiskurs (Judith Küper)
Dieser Beitrag fragt danach, inwiefern die Art und Weise, wie pädagogische Praktiker*innen ihr Handeln reflektieren, aufschlussreich für die Theoretisierung praktischer pädagogischer Reflexion sein kann. Dieses Vorhaben fußt auf der Beobachtung, dass das im Lehrerbildungsdiskurs dominante Reflexionsideal nicht zu dem passt, was in schulpraktisch verorteten Reflexionssituationen passiert: Reflexion wird in unterschiedlichen Argumentationskontexten des Lehrerbildungsdiskurses mit dem Anspruch verknüpft, dass das Reflexionssubjekt aus einer Handelndenperspektive heraustritt und von einer Beobachtendenperspektive aus kritisch auf pädagogische Praxis blickt. Dieses Reflexionsideal, das ich als objektivierende Distanzierung beschreibe, wird gemäß empirischer Befunde zur Reflexionspraxis von pädagogischen Praktiker*innen fortwährend nicht erfüllt. Vor dem Hintergrund der Annahme, dass diese Differenz zwischen Reflexionsideal und Reflexionspraxis von systematischer Bedeutung sein könnte, nehme ich praktische pädagogische Reflexion als theoriefähiges Phänomen in den Blick. Dafür analysiere ich Beispielszenen aus Unterrichtsnachgesprächen im Kontext des Referendariats, anhand derer sich ein möglicherweise kontext- und gegenstandssensibler Reflexionsmodus nachzeichnen lässt. Schlagwörter: Reflexion, Reflexivität, Professionalisierung, Lehrerbildung, Gesprächsanalyse
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Kognitive Prozesse beim Schreiben naturwissenschaftlicher Versuchsprotokolle: Eine explorative Studie zum sprachsensiblen Fachunterricht (Bernhard Müllner, Christine Heidinger, Lisa Hammerschmid, Martin Scheuch, Andrea Möller)
Das Erstellen von Versuchsprotokollen im Rahmen des Experimentierens bietet das Potential, in den naturwissenschaftlichen Fächern fachliches mit sprachlichem Lernen zu verknüpfen. Studien zeigen jedoch, dass das Schreiben von Versuchsprotokollen mit großen Herausforderungen für Schüler*innen verbunden ist, insbesondere für jene mit Deutsch als Zweitsprache. Ein Schlüssel zum Verständnis dieser Herausforderungen können die während des Schreibens ablaufenden kognitiven Prozesse sein, die bislang nicht erhoben wurden. Die vorliegende explorative Fallstudie macht mit Hilfe der Methode des Lauten Denkens bei fünf Schüler*innen die im Schreibprozessmodell nach Hayes angeführten kognitiven Teilprozesse beim Verfassen von Versuchsprotokollen sichtbar. Die Ergebnisse bieten eine Diskussionsgrundlage für die Entwicklung geeigneter Lernumgebungen und Unterstützungswerkzeuge für einen erfolgreichen sprachsensiblen Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern. Schlagwörter: Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung, Experimentieren, Versuchsprotokoll, bildungssprachliche Praktiken, Schreibprozess, Lautes Denken, sprachsensibler Fachunterricht
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Content
Content
ZISU – Zeitschrift für interpretative Schul- und Unterrichtsforschung
Heft 13 (2024): Digitale Technologien als eigensinnige Akteure der Transformation von und im Unterricht
hrsg. von: Matthias Proske, Kerstin Rabenstein & Oliver Reis
Editorial
Matthias Proske / Kerstin Rabenstein / Oliver Reis: Digitale Technologien als eigensinnige Akteure der Transformation von und im Unterricht
Thementeil
Jochen Lange / Farah Brandt: Avatare im Unterricht. Zum performativen Vollzug von Zeigepraktiken mit Telepräsenzrobotern in der Grundschule
Laura Lehnhoff: Praktiken des Filmens und Gefilmtwerdens im Sportunterricht
Olga Neuberger: Unsichtbares sichtbar machen. Zur Praxis der Repräsentation mittels (digitaler) Visualisierungen an Erinnerungsorten
Marion Yvonne Schwehr: Lernen und Lehren zwischen Realität und Virtualität: Zur räumlichen Dimension von Unterricht mit digitalen Medien
Barbara Asbrand / Katharina Kanz / Laura Hentschke: Das abwesende Klassenzimmer: Zur Transformation der Unterrichtsinteraktion in der Digitalität
Hannes König / Richard Lischka-Schmidt: Die Ausweitung der Grauzone: Eine vergleichende Untersuchung zur Reproduktion und Transformation der Interaktionsstrukturen von Unterricht und Lehre im Zuge ihrer pandemiebedingten Digitalisierung
Isabel Neto Carvalho / Mandy Schiefner-Rohs: Digitale Artefakte als widerständige Akteure des Unterrichts
Allgemeiner Teil
Judith Küper: Missglückte Distanzierung? Praktische pädagogische Reflexion als theoriefähiges Phänomen in Relation zum dominanten Reflexionsideal im Lehrerbildungsdiskurs
Bernhard Müllner / Christine Heidinger / Lisa Hammerschmid / Martin Scheuch / Andrea Möller: Kognitive Prozesse beim Schreiben naturwissenschaftlicher Versuchsprotokolle: Eine explorative Studie zum sprachsensiblen Fachunterricht
Rezensionen
Onur Aksünger: Straehler-Pohl, Hauke (2023): Lehrer:innen im ‚Brennpunkt‘. Gespräche über Herausforderungen, Bewältigungsstrategien und Dilemmata des Schulalltags. Bielefeld: transcript, 326 Seiten
Inhaltsverzeichnis herunterladen
Leseproben
Einzelbeitrag-Download (Open Access/Gebühr): zisu.budrich-journals.de
Sie können sich hier für den ZISU-Alert anmelden.
Bibliography
Zusätzliche Informationen
| Publisher | |
|---|---|
| ISSN | 2191-3560 |
| eISSN | 2195-2671 |
| ISBN | 978-3-8474-3093-3 |
| Volume | 13. Jahrgang 2024 |
| Edition | 13 (2024) |
| Date of publication | 11.06.2024 |
| Scope | 164 Seiten |
| Language | Deutsch |
| Format | 17 x 24 cm |
| DOI | |
| Homepage |
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Authors
Autor*innen
Schlagwörter
Schlagwörteraußerschulischer Lernort, Bilder, Corona-Pandemie, Covid-19-Pandemie, digitale Medien, digitale Transformation, Digitalisierung, Distanzunterricht, dokumentarische Methode, Ethnographie, Eye-Viewing, Filmaufnahmen, Gesprächsanalyse, Grundschule, Interaktion, Lehre, Lehrerbildung, Medienkonstellationen, NS-Gedenkstätte, Praktiken, Praxistheorie, Professionalisierung, Raumsoziologie, Reflexion, Reflexivität, Rundgang, Schule, Sportunterricht, Struktur, Technologie, Telepräsenzroboter, Transformation, Unterricht, Unterrichtsentwicklung, Unterrichtsforschung, Unterrichtspraxis, Unterrichtsvorbereitung, Videographie, Videokonferenz, Virtual Reality, Zeigen
Pressestimmen
Abstracts
Abstracts
Avatare im Unterricht. Zum performativen Vollzug von Zeigepraktiken mit Telepräsenzrobotern in der Grundschule (Jochen Lange, Farah Brandt)
Der Beitrag fokussiert das transformatorische Potenzial von digitalen Unterrichtstechnologien, indem der Einsatz von Telepräsenzrobotern – die neue Formen des unterrichtlichen ‚Da-Seins‘ versprechen – ethnographisch auf das Wie seines Vollzugs befragt wird: Wie wird Unterricht in der Grundschule mit Schüler*innen performativ prozessiert, die zwar über eine körperliche Präsenz im (Klassen-)Raum verfügen, aber dennoch zuhause sind? Mit den empirisch noch wenig beachteten Hardware-Avataren wird ein Zeigen beobachtet, anhand dessen Praktiken des unterrichtlichen Wahrnehmbarmachens als ein verteiltes – digital erweitertes – Netzwerkgeschehen analysiert werden. Zugleich und im Kontrast wird sichtbar, wie es zum Aufrufen einer zunehmend inkompatibel erscheinenden Unterrichtsordnung kommt, die z. B. bemüht ist, Leistungen und verbundene Agency einzelnen Individuen zuzurechnen. Dabei erfahren die einhergehenden Praktiken eine Bedeutungsaktualisierung im Kontakt mit dem Digitalen, etwa dann, wenn es im Zuge von Aufgaben bzw. Fragen der Lehrperson eher dem Anschein nach um ein prüfendes Wissenzeigen geht und dieses vielmehr als Vehikel zur situativ-demonstrativen Einübung bzw. Exemplifizierung der unterrichtlichen Funktionsordnung unter erschwerten Bedingungen nutzbar gemacht wird: Der Kontrast zwischen dem Neuen und dem Alten wird zur hervorhebenden Konturierung des Tradierten genutzt. Schlagwörter: Ethnographie, Telepräsenzroboter, Zeigen, digitale Medien, Grundschule, Unterrichtspraxis
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Praktiken des Filmens und Gefilmtwerdens im Sportunterricht (Laura Lehnhoff)
Der sportpädagogische Diskurs um digitale Medien vollzieht sich in weiten Teilen auf Grundlage eines simplifizierten Medienbegriffs. Demzufolge werden digitale Medien als ‚neutrale‘ Werkzeuge im Sportunterricht eingesetzt, in der Annahme, dass sie Unterrichtsprozesse unterstützen, in Teilen erleichtern und schließlich optimieren. Vernachlässigt wird dabei die Tatsache, dass digitale Medien als meist nicht wahrgenommene Akteure wirksam werden. Der vorliegende Beitrag nimmt am Beispiel des Filmens und Gefilmtwerdens im Sportunterricht das Zusammenspiel von Materialitäten, Inhalten, Praktiken und Wissensordnungen sowie Subjektpositionen in den Blick. Auf der Grundlage eines medienwissenschaftlichen Modells wird anhand von Fallbeispielen veranschaulicht, wie Schüler*innen als Subjekte des medialisierten Sportunterrichts positioniert werden bzw. sich in diesem Zusammenspiel zueinander sowie zu den Anforderungen und Spielräumen der Unterrichtspraxis positionieren. Auf diese Weise kann gezeigt werden, dass digitale Technologien im Sportunterricht wesentlich an Subjektpositionierungen und Bedeutungsaushandlungen mitwirken. Schlagwörter: Sportunterricht, Medienkonstellationen, Filmaufnahmen, Praktiken
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Unsichtbares sichtbar machen. Zur Praxis der Repräsentation mittels (digitaler) Visualisierungen an Erinnerungsorten (Olga Neuberger)
Der Beitrag widmet sich der Praxis der Repräsentation in Rundgängen an einem Erinnerungsort. Vor dem Hintergrund des pädagogisch zu bearbeitenden Handlungsproblems der Sicht- und Unsichtbarkeit von Vergangenheit wird entlang von dichten Beschreibungen zweier Situationen herausgearbeitet, dass es zu einer Synchronisierung verschiedener Zeitschichten kommt. Unsichtbares aus der Vergangenheit wird dabei in Form von (digitalen) Bildern materialisiert und in ein Verhältnis zum lokalen Standort gesetzt. Die Materialisierung von Unsichtbarem hat im Fall der digitalen Raumbilder einen Anteil daran, dass die Repräsentationspraxis der Logik der Simulation folgt, sodass es zu einer räumlichen Verortung in der vergangenen Zukunft kommt. Schlagwörter: Außerschulischer Lernort, Rundgang, NS-Gedenkstätte, Zeigen, Bilder, Virtual Reality, Ethnographie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Lernen und Lehren zwischen Realität und Virtualität: Zur räumlichen Dimension von Unterricht mit digitalen Medien (Marion Yvonne Schwehr)
Während sich virtuelle Erlebnisse in der Alltagswelt von Jugendlichen immer weiter etablieren, wissen wir bislang noch wenig darüber, welche Bedeutung digitale Medien (raumbezogen) für die Unterrichtsorganisation haben. Die Verflechtung von Raum, Bildung und Digitalität führt zu der Frage, welchen Einfluss digitale Medien auf die unterrichtliche Organisation haben. Ziel des Beitrags ist es, anhand rekonstruktiver Analysen von ethnographischen Beobachtungen darzulegen, wie mit digitalen Medien gelernt wird und welche (Lern-)Räume durch das Handeln der Akteur*innen im Unterricht entstehen. Fokussiert werden die Perspektiven der beteiligten Akteur*innen und die Strukturiertheit der Räume. Eine theoretische Rahmung bieten raumsoziologische Bezugnahmen. Diese werden genutzt, um aufzuzeigen, welchen räumlichen Bedingungen das Handeln der Akteur*innen innerhalb des Unterrichts mit digitalen Medien unterliegt und welche Räume sie durch ihr Handeln konstituieren. Präsentiert werden unterrichtliche Situationen, die von Synchronität gekennzeichnet sind und solche, die komplett darauf verzichten. Schlagwörter: Digitalisierung, Raumsoziologie, Unterrichtsentwicklung
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Das abwesende Klassenzimmer: Zur Transformation der Unterrichtsinteraktion in der Digitalität (Barbara Asbrand, Katharina Kanz, Laura Hentschke)
Der Beitrag stellt die dokumentarische Interpretation von digitalem Distanzunterricht vor, der während der Corona-Pandemie in Form von Videokonferenzen durchgeführt wurde. Im kontrastierenden Fallvergleich mit Präsenzunterricht desselben Lehrers im selben Fach, der vor der Pandemie videografiert wurde, können Veränderungen des Unterrichts rekonstruiert werden, die auf das digitale Format zurückgeführt werden können. Es zeigt sich, dass nicht der Orientierungsrahmen des Lehrers, sondern der an das Videokonferenzsystem delegierte Kommunikationsmodus sowohl die Lehrer-Schüler*innen-Interaktion und die Art und Weise der Auseinandersetzung mit den fachlichen Inhalten bestimmt. Schlagwörter: Corona-Pandemie, Distanzunterricht, Videokonferenz, Unterrichtsforschung, Dokumentarische Methode
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Die Ausweitung der Grauzone: Eine vergleichende Untersuchung zur Reproduktion und Transformation der Interaktionsstrukturen von Unterricht und Lehre im Zuge ihrer pandemiebedingten Digitalisierung (Hannes König, Richard Lischka-Schmidt)
Der Beitrag untersucht aus einer strukturtheoretischen Perspektive vergleichend die Differenzen und Gemeinsamkeiten von Online- und Offline-Interaktion im Grundschulunterricht und in der Hochschullehre. Es zeigt sich zum einen eine Reproduktion der Strukturen sogar über den Vergleich der recht differenten Institutionen Hoch- und Grundschule hinweg, zum anderen eine übergreifende Form der Irritation dieser Strukturen, die wir als ‚Ausweitung der Grauzone‘ bezeichnen. Abschließend werden vorliegende gegenläufige Befunde und normative Forderungen einer Transformation im Zuge der Digitalisierung zum Ergebnis unserer Untersuchung relationiert und mithin relativiert. Schlagwörter: Unterricht, Lehre, Digitalisierung, Distanzunterricht, Interaktion, Struktur, Transformation, COVID-19-Pandemie
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Digitale Artefakte als widerständige Akteure des Unterrichts (Isabel Neto Carvalho, Mandy Schiefner-Rohs)
In der erziehungs-, medien- und kulturwissenschaftlichen Forschung besteht Einigkeit darüber, dass digitale Medien Schul- und Unterrichtskulturen beeinflussen. Oft bleibt jedoch unklar, woran dies empirisch festgemacht werden kann. Der Beitrag widmet sich der Frage, wie digitale Artefakte als ‚Mitspieler‘ des Unterrichts auftreten. Ein ethnographisches Forschungsprojekt rekonstruiert Praktiken des Medienhandelns von Lehrerpersonen. In den Analysen zeigen sich digitale Artefakte als eigensinnige und widerständige Akteure. Diese Widerständigkeit wird weniger in der sozio-medialen bzw. -materiellen Praxis des klassenöffentlichen Unterrichts, sondern eher vorgelagert in Praktiken der Unterrichtsvorbereitung empirisch sichtbar. Unter dieser Perspektive wird u.a. die Handlungsmacht digitaler Medien in schulischen Praktiken reflektiert. Schlagwörter: Digitalisierung, Schule, Unterrichtsvorbereitung, Praxistheorie, Videographie, Eye-Viewing
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Missglückte Distanzierung? Praktische pädagogische Reflexion als theoriefähiges Phänomen in Relation zum dominanten Reflexionsideal im Lehrerbildungsdiskurs (Judith Küper)
Dieser Beitrag fragt danach, inwiefern die Art und Weise, wie pädagogische Praktiker*innen ihr Handeln reflektieren, aufschlussreich für die Theoretisierung praktischer pädagogischer Reflexion sein kann. Dieses Vorhaben fußt auf der Beobachtung, dass das im Lehrerbildungsdiskurs dominante Reflexionsideal nicht zu dem passt, was in schulpraktisch verorteten Reflexionssituationen passiert: Reflexion wird in unterschiedlichen Argumentationskontexten des Lehrerbildungsdiskurses mit dem Anspruch verknüpft, dass das Reflexionssubjekt aus einer Handelndenperspektive heraustritt und von einer Beobachtendenperspektive aus kritisch auf pädagogische Praxis blickt. Dieses Reflexionsideal, das ich als objektivierende Distanzierung beschreibe, wird gemäß empirischer Befunde zur Reflexionspraxis von pädagogischen Praktiker*innen fortwährend nicht erfüllt. Vor dem Hintergrund der Annahme, dass diese Differenz zwischen Reflexionsideal und Reflexionspraxis von systematischer Bedeutung sein könnte, nehme ich praktische pädagogische Reflexion als theoriefähiges Phänomen in den Blick. Dafür analysiere ich Beispielszenen aus Unterrichtsnachgesprächen im Kontext des Referendariats, anhand derer sich ein möglicherweise kontext- und gegenstandssensibler Reflexionsmodus nachzeichnen lässt. Schlagwörter: Reflexion, Reflexivität, Professionalisierung, Lehrerbildung, Gesprächsanalyse
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Kognitive Prozesse beim Schreiben naturwissenschaftlicher Versuchsprotokolle: Eine explorative Studie zum sprachsensiblen Fachunterricht (Bernhard Müllner, Christine Heidinger, Lisa Hammerschmid, Martin Scheuch, Andrea Möller)
Das Erstellen von Versuchsprotokollen im Rahmen des Experimentierens bietet das Potential, in den naturwissenschaftlichen Fächern fachliches mit sprachlichem Lernen zu verknüpfen. Studien zeigen jedoch, dass das Schreiben von Versuchsprotokollen mit großen Herausforderungen für Schüler*innen verbunden ist, insbesondere für jene mit Deutsch als Zweitsprache. Ein Schlüssel zum Verständnis dieser Herausforderungen können die während des Schreibens ablaufenden kognitiven Prozesse sein, die bislang nicht erhoben wurden. Die vorliegende explorative Fallstudie macht mit Hilfe der Methode des Lauten Denkens bei fünf Schüler*innen die im Schreibprozessmodell nach Hayes angeführten kognitiven Teilprozesse beim Verfassen von Versuchsprotokollen sichtbar. Die Ergebnisse bieten eine Diskussionsgrundlage für die Entwicklung geeigneter Lernumgebungen und Unterstützungswerkzeuge für einen erfolgreichen sprachsensiblen Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern. Schlagwörter: Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung, Experimentieren, Versuchsprotokoll, bildungssprachliche Praktiken, Schreibprozess, Lautes Denken, sprachsensibler Fachunterricht
» Einzelbeitrag kaufen (Budrich Journals)
Verlag Barbara Budrich
- +49 (0)2171.79491-50
- info@budrich.de
-
Stauffenbergstr. 7
51379 Leverkusen
Germany



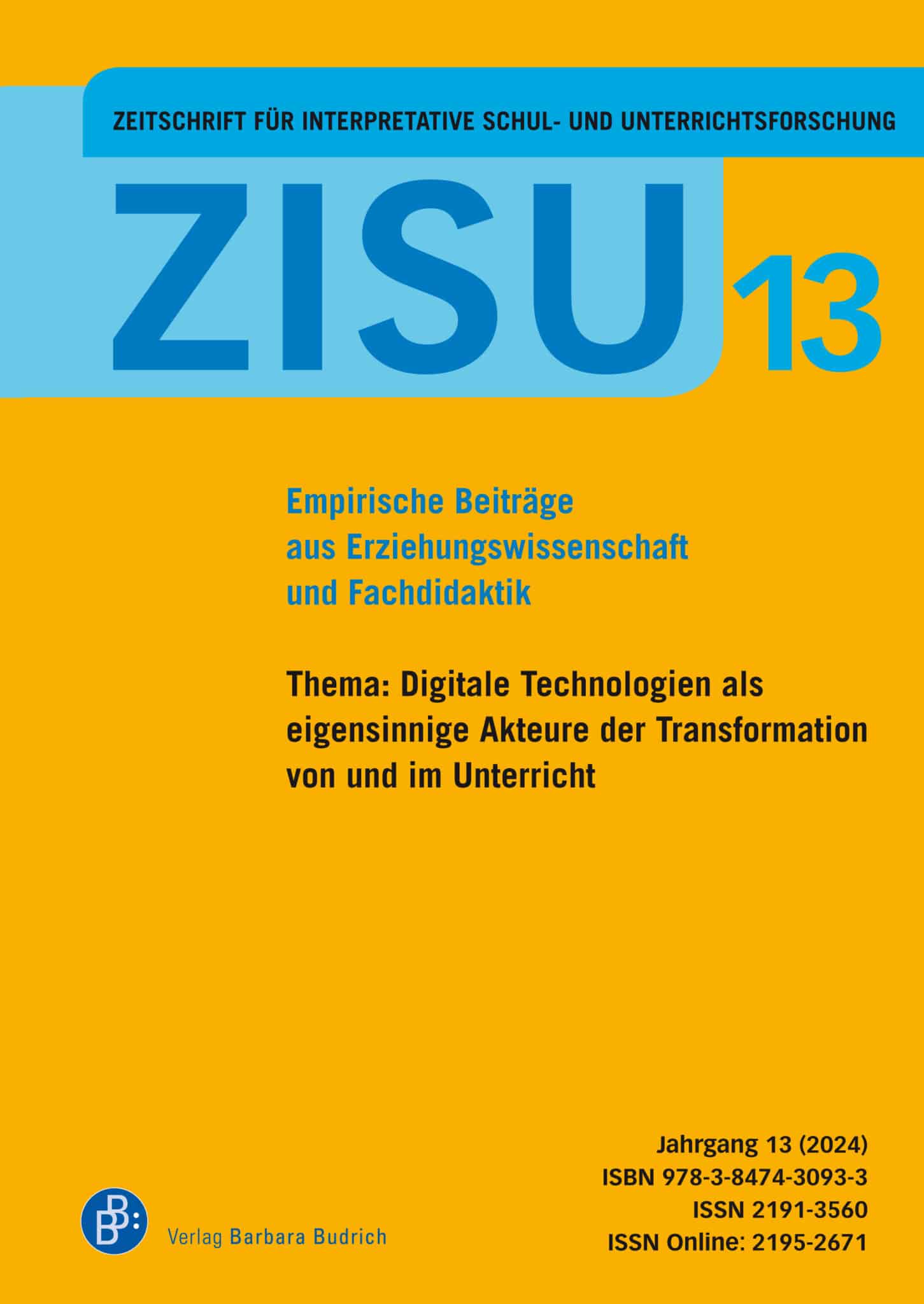

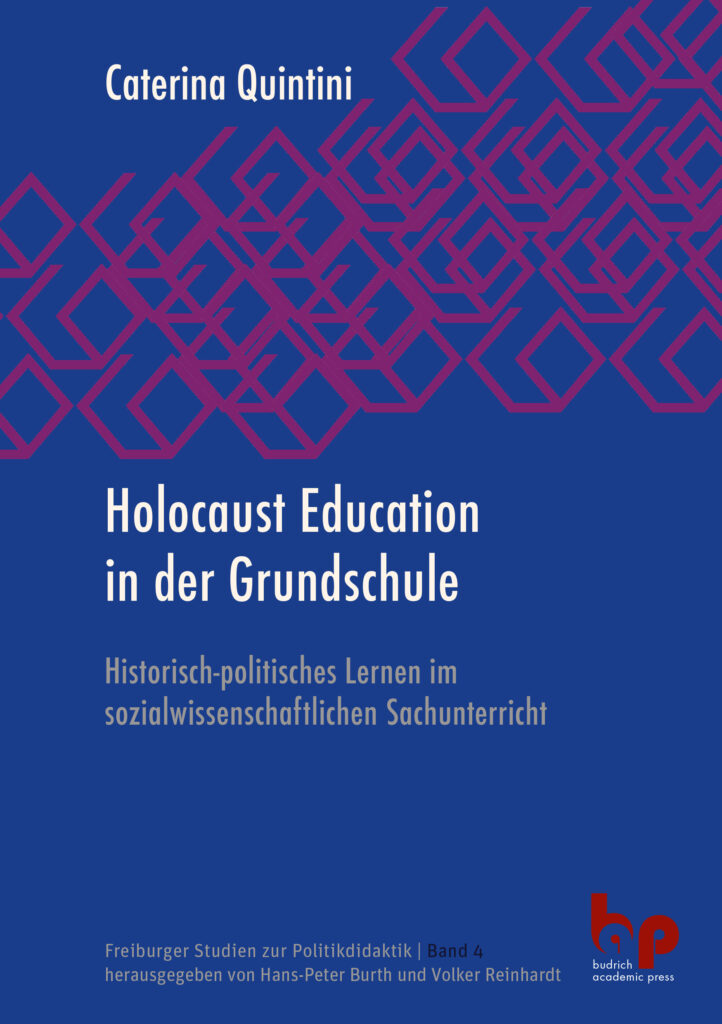
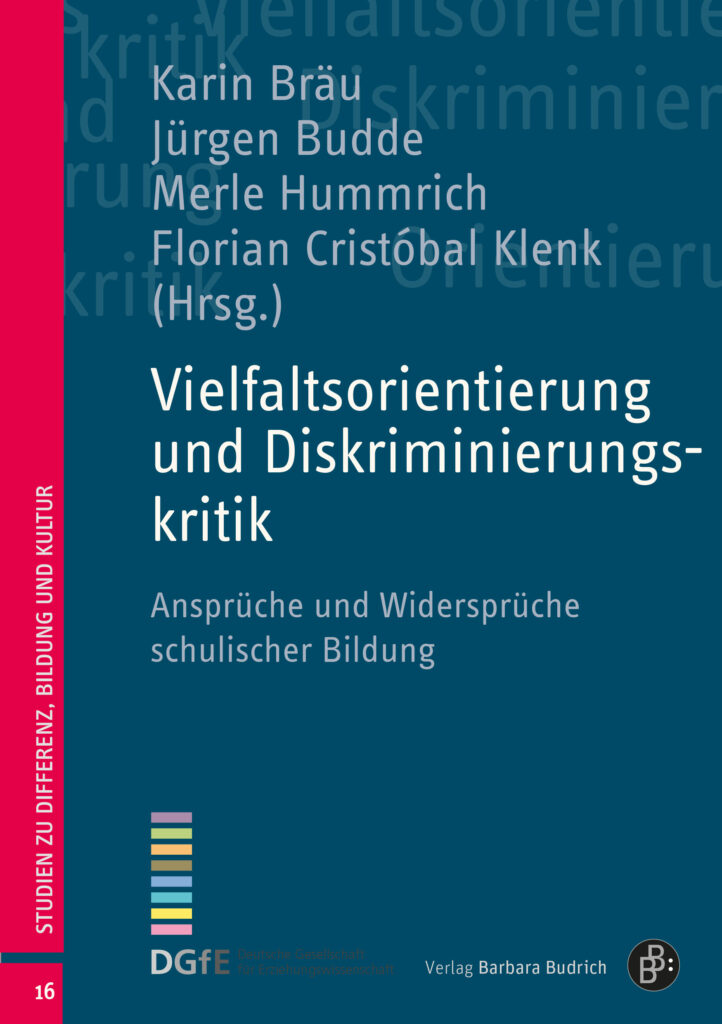
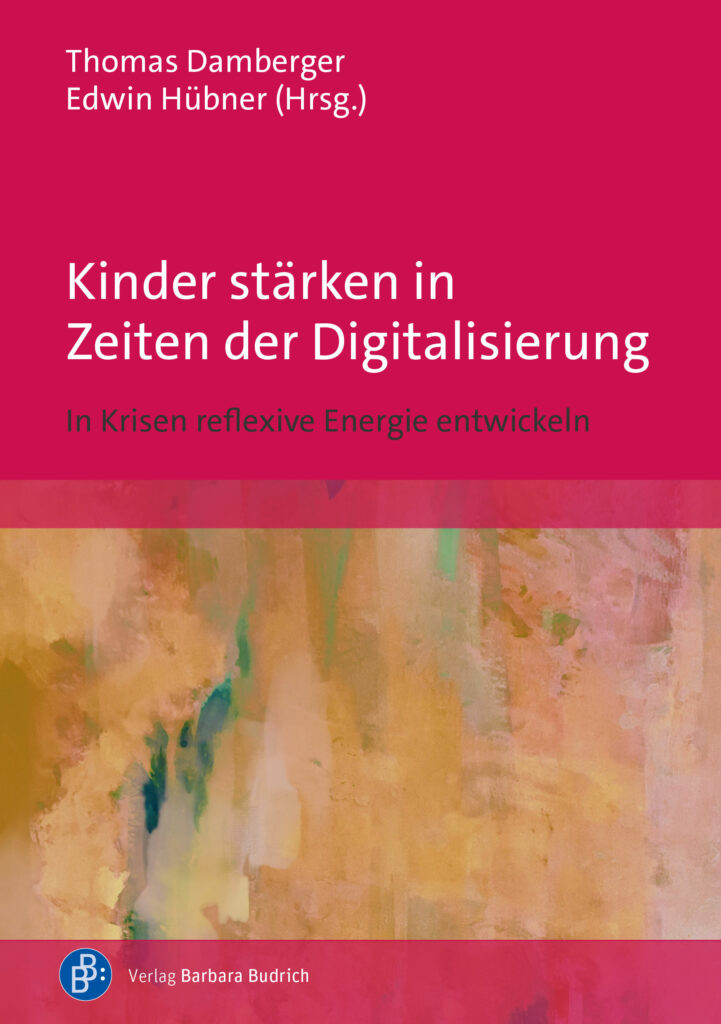
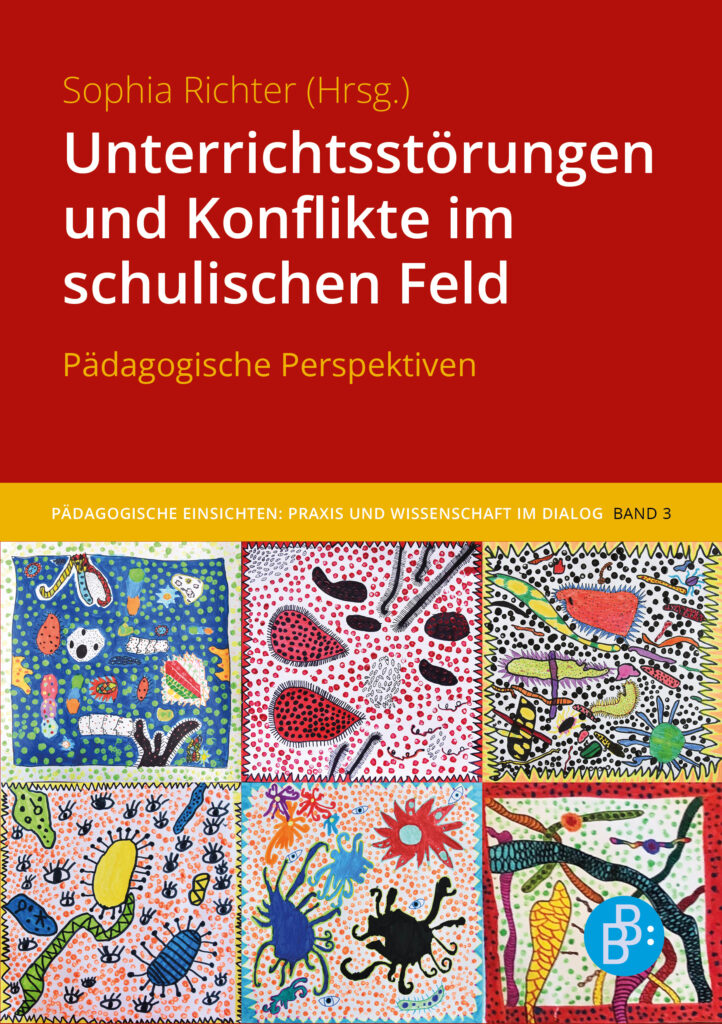


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.